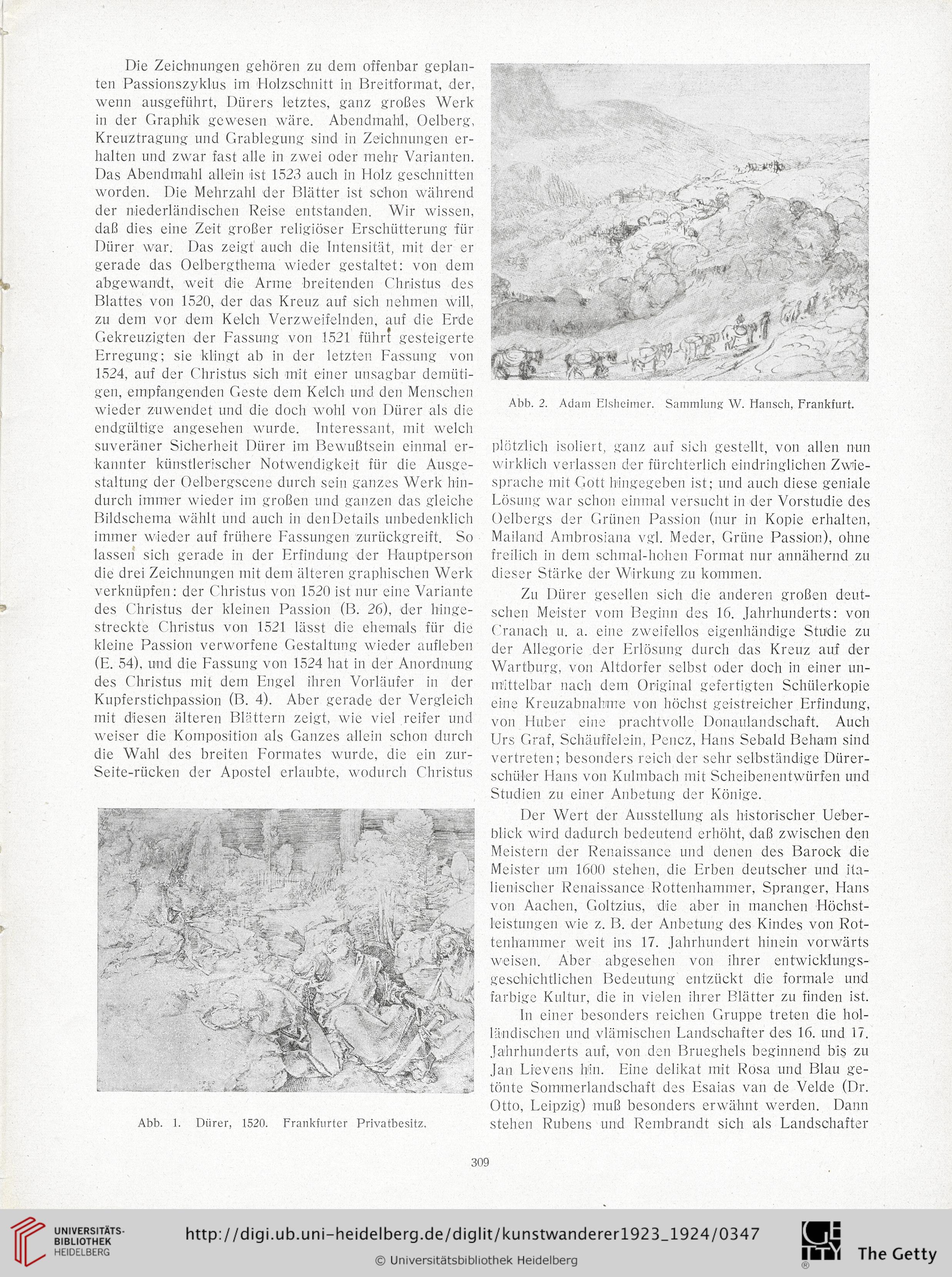m
&
Die Zeichnungen gehören zu dem offenbar geplan-
ten Passionszyklus im Holzschnitt in Breitformat, der,
wenn ausgeführt, Diirers letztes, ganz großes Werk
in der Graphik gewesen wäre. Abendmahl, Oelberg,
Kreuztragung und Grablegung sind in Ze'ichnungen er-
halten und zwar fast alle in zwei oder mehr Varianten.
Das Abendmahl allein ist 1523 auch in Holz geschnitten
worden. Die Mehrzahl der Blätter ist schon während
der niederländischen Reise entstanden. Wir wissen,
daß dies eine Zeit großer religiöser Erschütterung für
Dürer war. Das zeigt auch die Intensität, mit der er
gerade das Oelbergthema wieder gestaltet: von dem
abgewandt, weit die Arme breitenden Christus des
Blattes von 1520, der das Kreuz auf sich nehmen will,
zu dem vor dem Kelch Verzweifelnden, auf die Erde
Gekreuzigten der Fassung von 1521 führf gesteigerte
Erregung; sie klingt ab in der letzten Fassung von
1524, auf der Christus sich mit einer unsagbar demüti-
gen, empfangenden Geste dem Kelch und den Menschen
wieder zuwendet und die doch wohl von Dürer als die
endgültige angesehen wurde. Interessant, mit welch
suveräner Sicherheit Dürer itn Bewußtsein einmal er-
kannter künstleiischer Notwendigkeit für die Ausge-
staltung der Oelbergscene durch sein ganzes Werk hin-
durcli immer wieder im großen und ganzen das gleiche
Bildschema wählt und auch in denDetails unbedenklich
immer wleder auf frühere Fassungen zurückgreift. So
iassen sich gerade in der Erfindung der Hauptperson
die drei Zeichnungen mit dem älteren graphischen Werk
verknüpfen: der Christus von 1520 ist nur eine Variante
des Christus der kleinen Passion (B. 26), der hinge-
streckte Christus von 1521 lässt die ehernals für die
kleine Passion verworfene Gestaltung wieder aufleben
(E. 54), und die Fassung von 1524 hat in der Anordnung
des Christus mit dem Engel ihren Vorläufer in der
Kupferstichpass'ion (B. 4). Aber gerade der Vergleic'h
mit d'iesen älteren Blättern zeigt, wie viel reifer und
weiser die Komposition als Ganzes allein schon durch
die Wahl des breiten Formates wurde, die ein zur-
Seite-rücken der Apostel erlaubte, wodurch Christus
Abb. 1. Dürer, 1520. Frankfurter Privatbesitz,
Abb. 2. Adam Elsheimer. Sammlung W. Hansch, Frankfurt.
plötz'lich isoliert, ganz auf sich gestellt, von allen nun
wirktich verlassen der fürchterlich eindringlichen Zwie-
sprache mit Gott hingegeben ist; und auch diese geniale
Lösung war schon einrnal versucht in der Vorstudie des
Oelbergs der Grünen Passion (nur in Kopie erhalten,
Mailand Ambrosiana vgl. Meder, Grüne Passion), ohne
freilich in dem schmal-hohen Format nur annähernd zu
dieser Stärke der Wirkung zu kommen.
Zu Dürer gesetlen sich die anderen großen deut-
schen Meister vom Beginn des 16. Jahrhunderts: von
Cranach u. a. eine zweifellos eigenhändige Studie zu
der Allegorie der Erlösung durch das Kreuz auf der
Wartburg, von Altdorfer selbst oder doch in einer un-
ntittelbar nach dem Original gefertigten Schülerkopie
eine Kreuzabnabme von höchst geistreicher Erfindung,
von Huber eine prachtvolle Donaulandschaft. Auch
Urs Graf, Schäuffelein, Pencz, Hans Sebald Beham sind
vertreten; besonders reich der selrr selbständige Dürer-
schüler Hans von Kulmbach mit Scheibenentwürfen und
Studien zu einer Anbetung der Könige.
Der Wert der Ausstellung als historischer Ueber-
blick wird dadurch bedeutend erhöht, daß zwischen den
Meistern der Renaissance und denen des Barock die
Meister um 1600 stehen, die Erben deutscher und ita-
liemischer Renaissance Rottenhammer, Spranger, Hans
von Aachen, Goltzius, die aber in manchen Höchst-
leistungen wie z. B. der Anbetung des Kindes von Rot-
tenhammer weit ins 17. Jahrhundert hinein vorwärts
weisen. Aber abgesehen von ihrer entwicklungs-
gesobichtlichen Bedeutung entzückt die formale und
farbige Kultur, die in vielen ihrer Blätter zu finden ist.
In einer besonders reichen Gruppe treten die hol-
ländischen und vlämischen Landscbafter des 16. und 17.
Jahrhunderts auf, von den Brueghels beginnend bis zu
Jan Lievens hin. Eine delikat mit Rosa und Blau ge-
tönte Sommerlandschaft des Esaias van de Velde (Dr.
Otto, Leipzig) muß besonders erwähnt werden. Dann
stehen Rubens und Rembrandt sich als Landschafter
309
&
Die Zeichnungen gehören zu dem offenbar geplan-
ten Passionszyklus im Holzschnitt in Breitformat, der,
wenn ausgeführt, Diirers letztes, ganz großes Werk
in der Graphik gewesen wäre. Abendmahl, Oelberg,
Kreuztragung und Grablegung sind in Ze'ichnungen er-
halten und zwar fast alle in zwei oder mehr Varianten.
Das Abendmahl allein ist 1523 auch in Holz geschnitten
worden. Die Mehrzahl der Blätter ist schon während
der niederländischen Reise entstanden. Wir wissen,
daß dies eine Zeit großer religiöser Erschütterung für
Dürer war. Das zeigt auch die Intensität, mit der er
gerade das Oelbergthema wieder gestaltet: von dem
abgewandt, weit die Arme breitenden Christus des
Blattes von 1520, der das Kreuz auf sich nehmen will,
zu dem vor dem Kelch Verzweifelnden, auf die Erde
Gekreuzigten der Fassung von 1521 führf gesteigerte
Erregung; sie klingt ab in der letzten Fassung von
1524, auf der Christus sich mit einer unsagbar demüti-
gen, empfangenden Geste dem Kelch und den Menschen
wieder zuwendet und die doch wohl von Dürer als die
endgültige angesehen wurde. Interessant, mit welch
suveräner Sicherheit Dürer itn Bewußtsein einmal er-
kannter künstleiischer Notwendigkeit für die Ausge-
staltung der Oelbergscene durch sein ganzes Werk hin-
durcli immer wieder im großen und ganzen das gleiche
Bildschema wählt und auch in denDetails unbedenklich
immer wleder auf frühere Fassungen zurückgreift. So
iassen sich gerade in der Erfindung der Hauptperson
die drei Zeichnungen mit dem älteren graphischen Werk
verknüpfen: der Christus von 1520 ist nur eine Variante
des Christus der kleinen Passion (B. 26), der hinge-
streckte Christus von 1521 lässt die ehernals für die
kleine Passion verworfene Gestaltung wieder aufleben
(E. 54), und die Fassung von 1524 hat in der Anordnung
des Christus mit dem Engel ihren Vorläufer in der
Kupferstichpass'ion (B. 4). Aber gerade der Vergleic'h
mit d'iesen älteren Blättern zeigt, wie viel reifer und
weiser die Komposition als Ganzes allein schon durch
die Wahl des breiten Formates wurde, die ein zur-
Seite-rücken der Apostel erlaubte, wodurch Christus
Abb. 1. Dürer, 1520. Frankfurter Privatbesitz,
Abb. 2. Adam Elsheimer. Sammlung W. Hansch, Frankfurt.
plötz'lich isoliert, ganz auf sich gestellt, von allen nun
wirktich verlassen der fürchterlich eindringlichen Zwie-
sprache mit Gott hingegeben ist; und auch diese geniale
Lösung war schon einrnal versucht in der Vorstudie des
Oelbergs der Grünen Passion (nur in Kopie erhalten,
Mailand Ambrosiana vgl. Meder, Grüne Passion), ohne
freilich in dem schmal-hohen Format nur annähernd zu
dieser Stärke der Wirkung zu kommen.
Zu Dürer gesetlen sich die anderen großen deut-
schen Meister vom Beginn des 16. Jahrhunderts: von
Cranach u. a. eine zweifellos eigenhändige Studie zu
der Allegorie der Erlösung durch das Kreuz auf der
Wartburg, von Altdorfer selbst oder doch in einer un-
ntittelbar nach dem Original gefertigten Schülerkopie
eine Kreuzabnabme von höchst geistreicher Erfindung,
von Huber eine prachtvolle Donaulandschaft. Auch
Urs Graf, Schäuffelein, Pencz, Hans Sebald Beham sind
vertreten; besonders reich der selrr selbständige Dürer-
schüler Hans von Kulmbach mit Scheibenentwürfen und
Studien zu einer Anbetung der Könige.
Der Wert der Ausstellung als historischer Ueber-
blick wird dadurch bedeutend erhöht, daß zwischen den
Meistern der Renaissance und denen des Barock die
Meister um 1600 stehen, die Erben deutscher und ita-
liemischer Renaissance Rottenhammer, Spranger, Hans
von Aachen, Goltzius, die aber in manchen Höchst-
leistungen wie z. B. der Anbetung des Kindes von Rot-
tenhammer weit ins 17. Jahrhundert hinein vorwärts
weisen. Aber abgesehen von ihrer entwicklungs-
gesobichtlichen Bedeutung entzückt die formale und
farbige Kultur, die in vielen ihrer Blätter zu finden ist.
In einer besonders reichen Gruppe treten die hol-
ländischen und vlämischen Landscbafter des 16. und 17.
Jahrhunderts auf, von den Brueghels beginnend bis zu
Jan Lievens hin. Eine delikat mit Rosa und Blau ge-
tönte Sommerlandschaft des Esaias van de Velde (Dr.
Otto, Leipzig) muß besonders erwähnt werden. Dann
stehen Rubens und Rembrandt sich als Landschafter
309