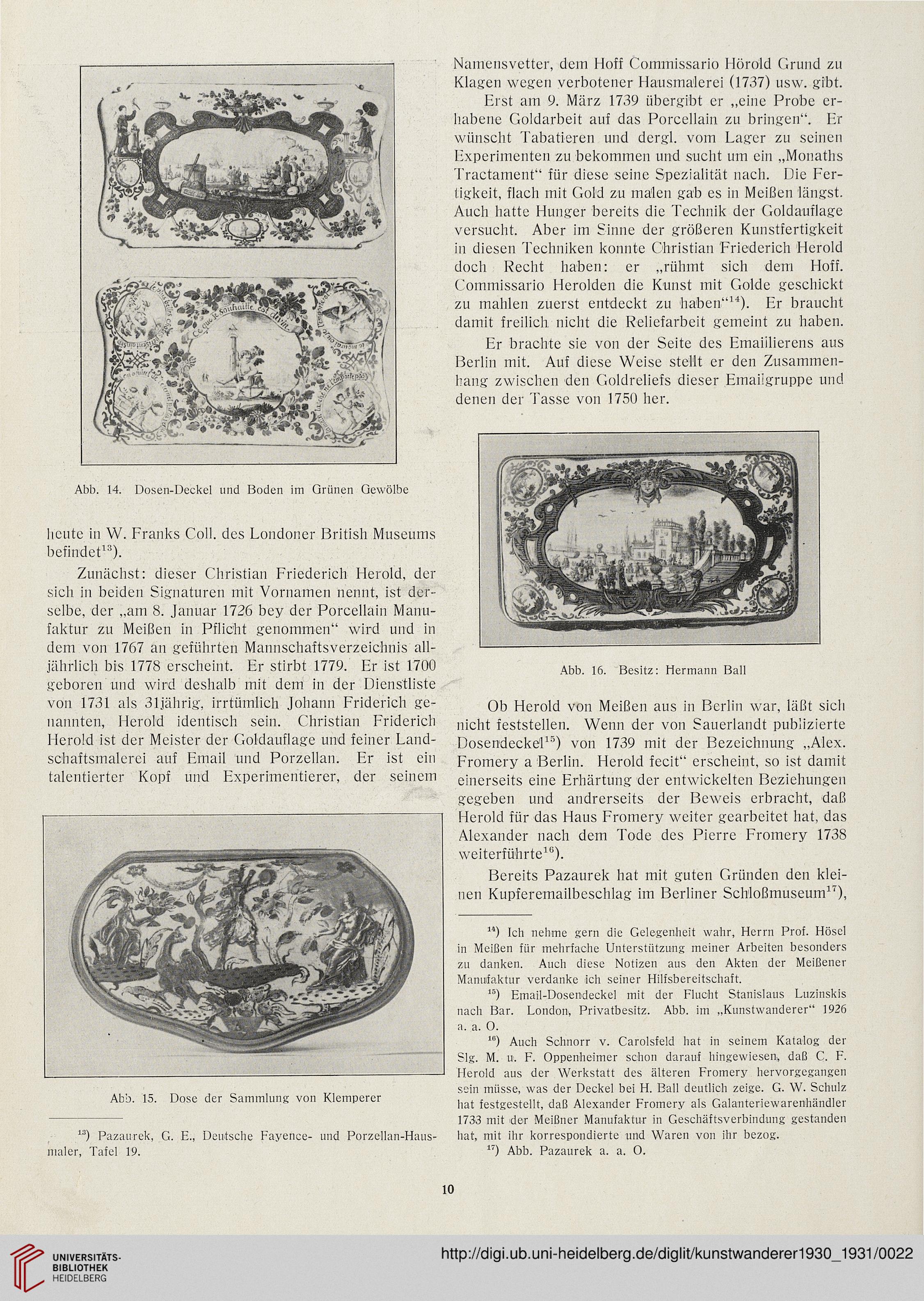Abb. 14. Dosen-Deckel und Boden im Grünen Gewölbe
licute in W. Franks Coll. dcs Londoner British Mnscums
befindet13).
Zunächst: dieser Christian Friederich Herold, der
sicli in bciden Signaturen mit Vornamen nennt, ist der-
selbe, der „am 8. Januar 1726 bey der Porcellain Manu-
faktur zu Meißen in Pflicht genommen“ wird und in
dem von 1767 an geführten Mannschaftsverzeichnis all-
jährlich bis 1778 erscheint. Er stirbt 1779. Er ist 1700
geboren und wird deshalb mit dem in der Dienstliste
von 1731 als 31 jährig', irrtümlich Joliann Friderich ge-
nannten, ilerold identisch sein. Christian Friderich
Herold ist der Meister der Goldauflage und feiner Land-
schaftsmalerei anf Email und Porzellan. Er ist ein
talentierter Kopf und Experimentierer, der seinem
Abb. 15. Dose der Sammlung von Klemperer
13) Pazaurek, G. E., Deutsche Fayence- und Porzellan-Haus-
maler, Tafel 19.
Namensvetter, dem Hoff Commissario Hörold Grund zu
Klagen wegen verbotener Hausmalerei (1737) usw. gibt.
Erst am 9. März 1739 übergibt er „eine Probe er-
habene Goldarbeit auf das Porcellain zu bringen“. Er
wünscht Tabatieren und dergl. vom Lager zu seinen
Experimenten zu bekommen und suclit um cin „Monaths
Tractament“ für diese seine Spezialität nach. Die Fer-
tigkeit, flach mit Gold zu malen gab es in Meißen längst.
Auch hatte Hunger bereits die Technik der Goldauflage
versucht. Aber im Sinne der größeren Kunstfertigkeit
in diesen Techniken konnte Ohristian Friederich Herold
doch Recht haben: er „rühmt sich dem Hoff.
Commissario Herolden die Kunst mit Golde geschickt
zu mahlen zuerst entdeckt zu haben“14). Er braucht
damit freilich nicht die Reliefarbcit gemeint zu haben.
Er brachte sie von der Seite des Emaiilierens aus
Berlin mit. Auf diese Weise stel'lt er den Zusammen-
hang zwischen den Goldreliefs dieser Emailgruppe und
denen der Tasse von 1750 her.
Abb. 16. Besitz: Hermann Ball
Ob Herold von Meißen aus in Bcrlin war, läßt sicli
nicht feststellen. Wenn der von Sauerlandt publizierte
Dosendeckel15) von 1739 mit der Bezeichnung „Alex.
Fromery a Berlin. Herold fecit“ erscheint, so ist damit
einerseits eine Erhärtung der entwickelten Beziehungen
gegeben und andrerseits der Beweis erbracht, daß
Herold für das Haus Fromery weiter gearbeitet hat, das
Alexander nach dem Tode des Pierre Fromery 1738
weiterführte16).
Bereits Pazaurek hat mit guteu Gründen den klei-
nen Kupferemailbeschlag im Berliner Schloßmuseum17),
14) Ich rehme gern dic Gelegenheit wahr, Herrn Prof. Hösel
in Meißen fiir mehrfache Unterstützung meiner Arbeiten besonders
zu danken. Auch diese Notizen aus den Akten der Meißener
Manuifaktur verdanke ich seiner Hilfsbereitschaft.
15) Email-Dosendeckel mit der Flucht Stanislaus Luzinskis
nach Bar. London, Privatbesitz. Abb. im „Kunstwanderer“ 1926
a. a. O.
16) Auch Schnorr v. Carolsfeld hat in seinem Katalog der
Slg. M. u. F. Oppenheimer schon darauf hingewiesen,, daß C. F.
Herold aus der Werkstatt des älteren Fromery hervorgegangen
sein miisse, was der Deckel bei H. Ball deutlich zeige. G. W. Schulz
hat festgestellt, daß Alexander Fromery als Galanteriewarenhändler
1733 mit ider Meißner Manufaktur in Geschäftsverbindung gestanden
hat, mit ihr korrespondierte und Waren von ihr bezog.
17) Abb. Pazaurek a. a. 0.
10
licute in W. Franks Coll. dcs Londoner British Mnscums
befindet13).
Zunächst: dieser Christian Friederich Herold, der
sicli in bciden Signaturen mit Vornamen nennt, ist der-
selbe, der „am 8. Januar 1726 bey der Porcellain Manu-
faktur zu Meißen in Pflicht genommen“ wird und in
dem von 1767 an geführten Mannschaftsverzeichnis all-
jährlich bis 1778 erscheint. Er stirbt 1779. Er ist 1700
geboren und wird deshalb mit dem in der Dienstliste
von 1731 als 31 jährig', irrtümlich Joliann Friderich ge-
nannten, ilerold identisch sein. Christian Friderich
Herold ist der Meister der Goldauflage und feiner Land-
schaftsmalerei anf Email und Porzellan. Er ist ein
talentierter Kopf und Experimentierer, der seinem
Abb. 15. Dose der Sammlung von Klemperer
13) Pazaurek, G. E., Deutsche Fayence- und Porzellan-Haus-
maler, Tafel 19.
Namensvetter, dem Hoff Commissario Hörold Grund zu
Klagen wegen verbotener Hausmalerei (1737) usw. gibt.
Erst am 9. März 1739 übergibt er „eine Probe er-
habene Goldarbeit auf das Porcellain zu bringen“. Er
wünscht Tabatieren und dergl. vom Lager zu seinen
Experimenten zu bekommen und suclit um cin „Monaths
Tractament“ für diese seine Spezialität nach. Die Fer-
tigkeit, flach mit Gold zu malen gab es in Meißen längst.
Auch hatte Hunger bereits die Technik der Goldauflage
versucht. Aber im Sinne der größeren Kunstfertigkeit
in diesen Techniken konnte Ohristian Friederich Herold
doch Recht haben: er „rühmt sich dem Hoff.
Commissario Herolden die Kunst mit Golde geschickt
zu mahlen zuerst entdeckt zu haben“14). Er braucht
damit freilich nicht die Reliefarbcit gemeint zu haben.
Er brachte sie von der Seite des Emaiilierens aus
Berlin mit. Auf diese Weise stel'lt er den Zusammen-
hang zwischen den Goldreliefs dieser Emailgruppe und
denen der Tasse von 1750 her.
Abb. 16. Besitz: Hermann Ball
Ob Herold von Meißen aus in Bcrlin war, läßt sicli
nicht feststellen. Wenn der von Sauerlandt publizierte
Dosendeckel15) von 1739 mit der Bezeichnung „Alex.
Fromery a Berlin. Herold fecit“ erscheint, so ist damit
einerseits eine Erhärtung der entwickelten Beziehungen
gegeben und andrerseits der Beweis erbracht, daß
Herold für das Haus Fromery weiter gearbeitet hat, das
Alexander nach dem Tode des Pierre Fromery 1738
weiterführte16).
Bereits Pazaurek hat mit guteu Gründen den klei-
nen Kupferemailbeschlag im Berliner Schloßmuseum17),
14) Ich rehme gern dic Gelegenheit wahr, Herrn Prof. Hösel
in Meißen fiir mehrfache Unterstützung meiner Arbeiten besonders
zu danken. Auch diese Notizen aus den Akten der Meißener
Manuifaktur verdanke ich seiner Hilfsbereitschaft.
15) Email-Dosendeckel mit der Flucht Stanislaus Luzinskis
nach Bar. London, Privatbesitz. Abb. im „Kunstwanderer“ 1926
a. a. O.
16) Auch Schnorr v. Carolsfeld hat in seinem Katalog der
Slg. M. u. F. Oppenheimer schon darauf hingewiesen,, daß C. F.
Herold aus der Werkstatt des älteren Fromery hervorgegangen
sein miisse, was der Deckel bei H. Ball deutlich zeige. G. W. Schulz
hat festgestellt, daß Alexander Fromery als Galanteriewarenhändler
1733 mit ider Meißner Manufaktur in Geschäftsverbindung gestanden
hat, mit ihr korrespondierte und Waren von ihr bezog.
17) Abb. Pazaurek a. a. 0.
10