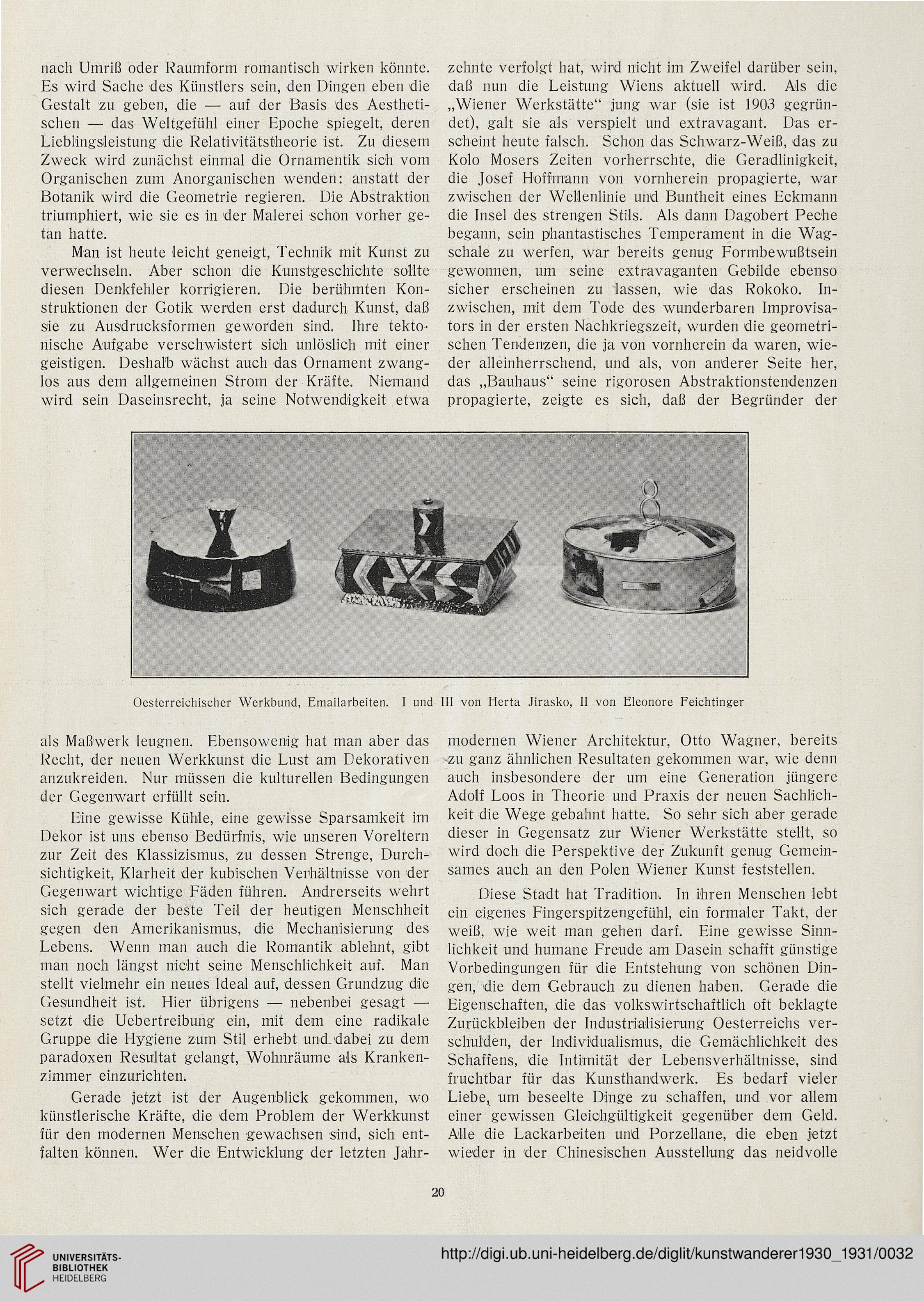nach Umriß oder Raumform romantisch wirken könnte.
Es wird Sache des Künstlers sein, den Dingen eben die
Gestalt zu geben, die — auf der Basis des Aestheti-
schen — das Weltgefühl einer Epoche spiegelt, deren
Liebl'ingsleistung die Relativitätstheorie ist. Zu diesem
Zweck wird zunächst einmal die Ornamentik sich vom
Organischen zum Anorganischen wenden: anstatt der
Botanik wird die Geometrie regieren. Die Abstraktion
triumphiert, wie sie es in der Malerei schon vorher ge-
tan hatte.
Man ist heute leicht geneigt, Technik mit Kunst zu
verwechseln. Aber schon die Kunstgeschichte sollte
diesen Denkfehler korrigieren. Die berühmten Kon-
struktionen der Gotik werden erst dadurch Kunst, daß
sie zu Ausdrucksformen geworden sind. Ihre tekto-
nische Aufgabe verschwistert sich unlösiich mit einer
geistigen. Deshalb wächst auch das Ornament zwang-
los aus dem allgemeinen Strom der Kräfte. Niemand
wird sein Daseinsrecht, ja seine Notwendigkeit etwa
zehnte verfolgt hat, wird nicht im Zweifel darüber sein,
daß nun die Leistung Wiens aktuell wird. Ais die
„Wiener Werkstätte“ jung war (sie ist 1903 gegrün-
det), galt sie als verspielt und extravagant. Das er-
scheint heute falsch. Schon das Schwarz-Weiß, das zu
Kolo Mosers Zeiten vorherrschte, die Geradlinigkeit,
die Josef Hoffmann von vornherein propagierte, war
zwischen der Wellenlinie und Buntheit eines Eckmann
die Insel des strengen Stils. Als dann Dagobert Peche
begann, sein phantastisches Temperament in die Wag-
schale zu werfen, war bereits genug Formbewußtsein
gewonnen, um seine extravaganten Gebilde ebenso
sicher erscheinen zu lassen, wie das Rokoko. In-
zwischen, mit dem Tode des wunderbaren Improvisa-
tors in der ersten Nachkriegszeit, wurden die geometri-
schen Tendenzen, die ja von vornherein da waren, wie-
der alleinherrschend, und als, von anderer Seite her,
das „Bauhaus“ seine rigorosen Abstraktionstendenzen
propagierte, zeigte es sich, daß der Begründer der
Oesterreichischer Werkbund, Emailarbeiten. I und III von Herta Jirasko, II von Eleonore Feichtinger
als Maßwerk leugnen. Ebensowenig hat man aber das
Recht, der neuen Werkkunst die Lust am Dekorativen
anzukreiden. Nur müssen die kulturellen Bedingungen
der Gegenwart erfüllt sein.
Eine gewisse Kühle, eine gewisse Sparsamkeit im
Dekor ist uns ebenso Bedürfnis, wie unseren Voreltern
zur Zeit des Klassizismus, zu dessen Strenge, Durch-
sichtigkeit, Klarheit der kubischen Verhältnisse von der
Gegenwart wichtige Fäden führen. Andrerseits wehrt
sich gerade der beste Teil der heutigen Menschheit
gegen den Amerikanismus, die Mechanisierung des
Lebens. Wenn man auch die Romantik ablehnt, gibt
man noch längst nicht seine Menschlichkeit auf. Man
stellt vielmehr ein neues Ideal auf, dessen Grundzug die
Gesundheit ist. Hier übrigens — nebenbei gesagt —
setzt die Uebertreibung ein, mit dem eine radikale
Gruppe die Hygiene zum Stil erhebt undvdabei zu dem
paradoxen Resultat gelangt, Wohnräume als Kranken-
zimmer einzurichten.
Gerade jetzt ist der Augenblick gekommen, wo
künstlerische Kräfte, die dem Problem der Werkkunst
für den modernen Menschen gewachsen sind, sich ent-
falten können. Wer die Entwicklung der letzten Jahr-
modernen Wiener Architektur, Otto Wagner, bereits
zu ganz ähnlichen Resultaten gekommen war, wie denn
auch insbesondere der um eine Generation jüngere
Adolf Loos in Theorie und Praxis der neuen Sachlich-
keit die Wege gebahnt hatte. So sehr sich aber gerade
dieser in Gegensatz zur Wiener Werkstätte stellt, so
wird doch die Perspektive der Zukunft genug Gemein-
sames auch an den Polen Wiener Kunst feststellen.
Diese Stadt hat Tradition. In ihren Menschen lebt
ein eigenes Fingerspitzengefühl, ein formaler Takt, der
weiß, wie weit man gehen darf. Eine gewisse Sinn-
lichkeit und humane Freude a-m Dasein schafft günstige
Vorbedingungen für die Entstehung von schönen Din-
gen, die dem Gebrauch zu dienen haben. Gerade die
Eigenschaften, die das volkswirtschaftlich oft beklagte
Zurückbleiben der Industrialisierung Oesterreichs ver-
schulden, der Individualismus, die Gemächlichkeit des
Schaffens, die Intimität der Lebensverhältnisse, sind
fruchtbar für das Kunsthandwerk. Es bedarf vieler
Liebe* um beseelte Dinge zu schaffen, und vor allem
einer gewissen Gleichgültigkeit gegenüber dem Geld.
Aile die Lackarbeiten und Porzellane, die eben jetzt
wieder in der Chinesischen Ausstellung das neidvolle
20
Es wird Sache des Künstlers sein, den Dingen eben die
Gestalt zu geben, die — auf der Basis des Aestheti-
schen — das Weltgefühl einer Epoche spiegelt, deren
Liebl'ingsleistung die Relativitätstheorie ist. Zu diesem
Zweck wird zunächst einmal die Ornamentik sich vom
Organischen zum Anorganischen wenden: anstatt der
Botanik wird die Geometrie regieren. Die Abstraktion
triumphiert, wie sie es in der Malerei schon vorher ge-
tan hatte.
Man ist heute leicht geneigt, Technik mit Kunst zu
verwechseln. Aber schon die Kunstgeschichte sollte
diesen Denkfehler korrigieren. Die berühmten Kon-
struktionen der Gotik werden erst dadurch Kunst, daß
sie zu Ausdrucksformen geworden sind. Ihre tekto-
nische Aufgabe verschwistert sich unlösiich mit einer
geistigen. Deshalb wächst auch das Ornament zwang-
los aus dem allgemeinen Strom der Kräfte. Niemand
wird sein Daseinsrecht, ja seine Notwendigkeit etwa
zehnte verfolgt hat, wird nicht im Zweifel darüber sein,
daß nun die Leistung Wiens aktuell wird. Ais die
„Wiener Werkstätte“ jung war (sie ist 1903 gegrün-
det), galt sie als verspielt und extravagant. Das er-
scheint heute falsch. Schon das Schwarz-Weiß, das zu
Kolo Mosers Zeiten vorherrschte, die Geradlinigkeit,
die Josef Hoffmann von vornherein propagierte, war
zwischen der Wellenlinie und Buntheit eines Eckmann
die Insel des strengen Stils. Als dann Dagobert Peche
begann, sein phantastisches Temperament in die Wag-
schale zu werfen, war bereits genug Formbewußtsein
gewonnen, um seine extravaganten Gebilde ebenso
sicher erscheinen zu lassen, wie das Rokoko. In-
zwischen, mit dem Tode des wunderbaren Improvisa-
tors in der ersten Nachkriegszeit, wurden die geometri-
schen Tendenzen, die ja von vornherein da waren, wie-
der alleinherrschend, und als, von anderer Seite her,
das „Bauhaus“ seine rigorosen Abstraktionstendenzen
propagierte, zeigte es sich, daß der Begründer der
Oesterreichischer Werkbund, Emailarbeiten. I und III von Herta Jirasko, II von Eleonore Feichtinger
als Maßwerk leugnen. Ebensowenig hat man aber das
Recht, der neuen Werkkunst die Lust am Dekorativen
anzukreiden. Nur müssen die kulturellen Bedingungen
der Gegenwart erfüllt sein.
Eine gewisse Kühle, eine gewisse Sparsamkeit im
Dekor ist uns ebenso Bedürfnis, wie unseren Voreltern
zur Zeit des Klassizismus, zu dessen Strenge, Durch-
sichtigkeit, Klarheit der kubischen Verhältnisse von der
Gegenwart wichtige Fäden führen. Andrerseits wehrt
sich gerade der beste Teil der heutigen Menschheit
gegen den Amerikanismus, die Mechanisierung des
Lebens. Wenn man auch die Romantik ablehnt, gibt
man noch längst nicht seine Menschlichkeit auf. Man
stellt vielmehr ein neues Ideal auf, dessen Grundzug die
Gesundheit ist. Hier übrigens — nebenbei gesagt —
setzt die Uebertreibung ein, mit dem eine radikale
Gruppe die Hygiene zum Stil erhebt undvdabei zu dem
paradoxen Resultat gelangt, Wohnräume als Kranken-
zimmer einzurichten.
Gerade jetzt ist der Augenblick gekommen, wo
künstlerische Kräfte, die dem Problem der Werkkunst
für den modernen Menschen gewachsen sind, sich ent-
falten können. Wer die Entwicklung der letzten Jahr-
modernen Wiener Architektur, Otto Wagner, bereits
zu ganz ähnlichen Resultaten gekommen war, wie denn
auch insbesondere der um eine Generation jüngere
Adolf Loos in Theorie und Praxis der neuen Sachlich-
keit die Wege gebahnt hatte. So sehr sich aber gerade
dieser in Gegensatz zur Wiener Werkstätte stellt, so
wird doch die Perspektive der Zukunft genug Gemein-
sames auch an den Polen Wiener Kunst feststellen.
Diese Stadt hat Tradition. In ihren Menschen lebt
ein eigenes Fingerspitzengefühl, ein formaler Takt, der
weiß, wie weit man gehen darf. Eine gewisse Sinn-
lichkeit und humane Freude a-m Dasein schafft günstige
Vorbedingungen für die Entstehung von schönen Din-
gen, die dem Gebrauch zu dienen haben. Gerade die
Eigenschaften, die das volkswirtschaftlich oft beklagte
Zurückbleiben der Industrialisierung Oesterreichs ver-
schulden, der Individualismus, die Gemächlichkeit des
Schaffens, die Intimität der Lebensverhältnisse, sind
fruchtbar für das Kunsthandwerk. Es bedarf vieler
Liebe* um beseelte Dinge zu schaffen, und vor allem
einer gewissen Gleichgültigkeit gegenüber dem Geld.
Aile die Lackarbeiten und Porzellane, die eben jetzt
wieder in der Chinesischen Ausstellung das neidvolle
20