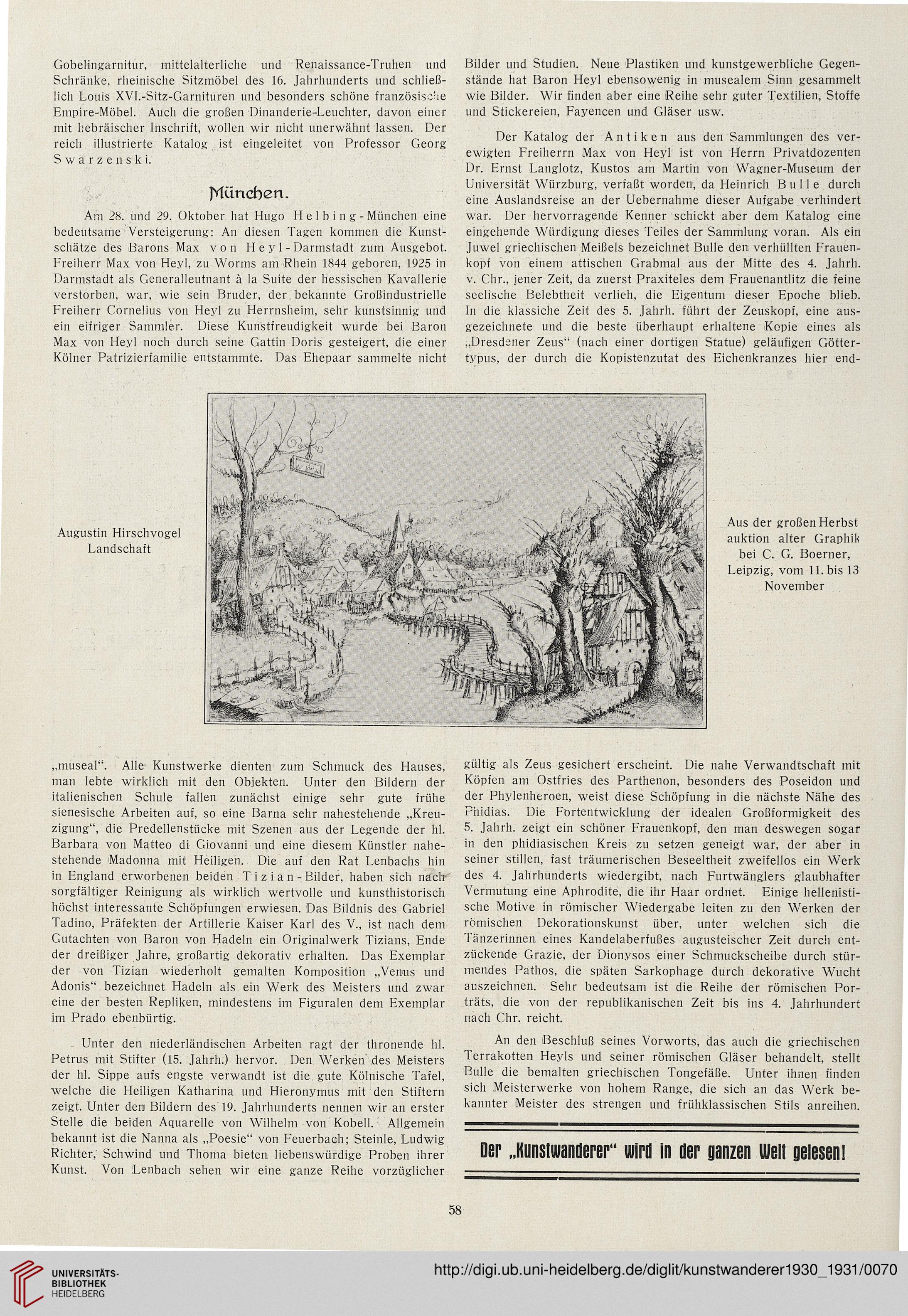Gobelingarnitur, mittelalterliclie und Renaissance-Truhen und
Schränke, rheinische Sitzinöbel des 16. Jahrhunderts und schließ-
lich Louis XVI.-Sitz-Garnituren und besonders schöne französische
Empire-Möbel. Aucli die großen Dinanderie-Leuchter, davon eiuer
mit hebräischer Inschrift, wollen wir nicht unerwähnt lassen. Der
reich illustrierte Katalog ist eingeleitet von Professor Georg
S w a r z e n s k i.
jvtüncben.
Am 28. und 29. Oktober hat Hugo H e 1 b i n g - Mütichen eine
bedeutsame Versteigerung: An diesen Tagen konunen die Kunst-
schätze des Barons Max v o n H e y 1 - Darmstadt zum Ausgebot.
Freiherr Max von Heyl, zu Worms am Rliein 1844 geboren, 1925 in
Darmstadt als Generalleutnant ä la Suite der hessischen Kavallerie
verstorben, war, wie sein Bruder, der bekannte Großindustrielle
Freiherr Cornelius von Heyl zu Herrnsheim, sehr kunstsinnig und
ein eifriger Sammler. Diese Kunstfreudigkeit wurde bei Baron
Max von Heyl noch durcli seine Gattin Doris gesteigert, die einer
Kölner Patrizierfamilie entstammte. Das Ehepaar sammelte niclit
Bilder und Studien. Neue Plastiken und kunstgewerbliche Gegen-
stände hat Baron Heyl ebensowenig in musealem Sinn gesammelt
wie Bilder. Wir finden aber eine Reihe sehr guter Textilien, Stoffe
und Stickereien, Fayencen und Gläser usw.
Der Katalog der A n t i k e n aus den Sammlungen des ver-
ewigten Freiherrn Max von Heyl ist von Herrn Privatdozenten
Dr. Ernst Langlotz, Kustos am Martin von Wagner-Museum der
Universität Würzburg, verfaßt worden, da Heinrich B u 11 e durch
eine Auslandsreise an der Uebernahme dieser Aufgabe verhindert
war. Der hervorragende Kenner schickt aber dem Katalog eine
eingehende Würdigung dieses Teiles der Sammlung voran. Als ein
Juwel griechischen Meißels bezeichnet Bulle den verhüllten Frauen-
kopf von einem attischen Grabmal aus der Mitte des 4. Jahrh.
v. Chr., jener Zeit, da zuerst Praxiteles dem Frauenantlitz die feine
seelische Belebtheit verlieh, die Eigentum dieser Epoche blieb.
In die kiassiche Zeit des 5. Jahrh. führt der Zeuskopf, eine aus-
gezeichnete und die beste überhaupt erhaltene Kopie eines als
„Dresdener Zeus“ (nach einer dortigen Statue) geläufigen Götter-
typus, der durch die Kopistenzutat des Eichenkranzes hier end-
Aus der großenHerbst
auktion alter Graphik
bei C. G. Boerner,
Leipzig, vom ll.bis 13
November
Augustin Hirschvoge
Landschaft
„museal“. Alle Kunstwerke dienten zum Schmuck des Hauses,
man lebte wirklich mit den Objekten. Unter den Bildern der
italienischen Schule fallen zunächst einige sehr gute frühe
sienesische Arbeiten auf, so eine Barna sehr nahestehende „Kreu-
zigung“, die Predellenstücke mit Szenen aus der Legende der hl.
Barbara von Matteo di Giovanni und eine diesem Künstler nalie-
stehende Madonna mit Heiligen. Die auf den Rat Lenbachs hin
in England erworbenen beiden T i z i a n - Bilder, haben sich nach
sorgfältiger Reinigung als wirklich wertvolle und kunsthistorisch
höchst interessante Schöpfungen erwiesen. Das Bildnis des Gabriel
Taditio, Präfekten der Artillerie Kaiser Karl des V„ ist nach dem
Gutachten von Baron von Hadeln ein Originalwerk Tizians, Ende
der dreißiger Jahre, großartig dekorativ erhalten. Das Exemplar
der von Tizian wiederholt gemalten Komposition „Venus und
Adonis“ bezeichnet Hadeln als ein Werk des Meisters und zwar
eine der besten Repliken, mindestens im Figuralen dem Exemplar
im Prado ebenbürtig.
Unter den niederländischen Arbeiten ragt der thronende hl.
Petrus mit Stifter (15. Jahrh.) hervor. Den Werken des Meisters
der hl. Sippe aufs engste verwandt ist die gute Kölnische Tafel,
welche die Heiligen Katharina und Hieronymus mit den Stiftern
zeigt. Unter den Bildern des 19. Jahrhunderts nennen wir an erster
Stelle die beiden Aquarelle von Wilhelm von Kobell. Allgemein
bekannt ist die Nanna als „Poesie“ von Feuerbach; Steinle, Ludwig
Richter, Schwind und Thoma bieten liebenswürdige Proben ihrer
Kunst. Von Lenbach sehen wir eine ganze Reihe vorzüglicher
gültig als Zeus gesichert erscheint. Die nahe Verwandtschaft mit
Köpfen am Ostfries des Parthenon, besonders des Poseidon und
der Phylenheroen, weist diese Schöpfung in die nächste Nähe des
Pnidias. Die Fortentwicklung der idealen Großformigkeit des
5. Jahrh. zeigt ein schöner Frauenkopf, den man deswegen sogar
in den phidiasischen Kreis zu setzen geneigt war, der aber in
seiner stillen, fast träumerischen Beseeltheit zweifellos ein Werk
des 4. Jahrhunderts wiedergibt, nach Furtwänglers glaubhafter
Vermutung eine Aphrodite, die ihr Haar ordnet. Einige hellenisti-
sche Motive in römischer Wiedergabe leiten zu den Werken der
römischen Dekorationskunst über, unter welchen sich die
Tänzerinnen eines Kandelaberfußes augusteischer Zeit durch ent-
zückende Grazie, der Dionysos einer Schmuckscheibe durch stiir-
mendes Pathos, die späten Sarkophage durch dekorative Wucht
auszeichnen. Sehr bedeutsam ist die Reihe der römischen Por-
träts, die von der republikanischen Zeit bis ins 4. Jahrhundert
uach Chr. reicht.
An den Beschluß seines Vorworts, das auch die griechischen
Terrakotten Heyls und seiner römischen Gläser behandelt, stellt
Bulle die bemalten griechischen Tongefäße. Unter ihnen finden
sich Meisterwerke von hohem Range, die sich an das Werk be-
kannter Meister des strengen und frühklassischen Stils anreihen.
Der „Kunsiwanflerer“ wird in der ganzen weit gelesem
58
Schränke, rheinische Sitzinöbel des 16. Jahrhunderts und schließ-
lich Louis XVI.-Sitz-Garnituren und besonders schöne französische
Empire-Möbel. Aucli die großen Dinanderie-Leuchter, davon eiuer
mit hebräischer Inschrift, wollen wir nicht unerwähnt lassen. Der
reich illustrierte Katalog ist eingeleitet von Professor Georg
S w a r z e n s k i.
jvtüncben.
Am 28. und 29. Oktober hat Hugo H e 1 b i n g - Mütichen eine
bedeutsame Versteigerung: An diesen Tagen konunen die Kunst-
schätze des Barons Max v o n H e y 1 - Darmstadt zum Ausgebot.
Freiherr Max von Heyl, zu Worms am Rliein 1844 geboren, 1925 in
Darmstadt als Generalleutnant ä la Suite der hessischen Kavallerie
verstorben, war, wie sein Bruder, der bekannte Großindustrielle
Freiherr Cornelius von Heyl zu Herrnsheim, sehr kunstsinnig und
ein eifriger Sammler. Diese Kunstfreudigkeit wurde bei Baron
Max von Heyl noch durcli seine Gattin Doris gesteigert, die einer
Kölner Patrizierfamilie entstammte. Das Ehepaar sammelte niclit
Bilder und Studien. Neue Plastiken und kunstgewerbliche Gegen-
stände hat Baron Heyl ebensowenig in musealem Sinn gesammelt
wie Bilder. Wir finden aber eine Reihe sehr guter Textilien, Stoffe
und Stickereien, Fayencen und Gläser usw.
Der Katalog der A n t i k e n aus den Sammlungen des ver-
ewigten Freiherrn Max von Heyl ist von Herrn Privatdozenten
Dr. Ernst Langlotz, Kustos am Martin von Wagner-Museum der
Universität Würzburg, verfaßt worden, da Heinrich B u 11 e durch
eine Auslandsreise an der Uebernahme dieser Aufgabe verhindert
war. Der hervorragende Kenner schickt aber dem Katalog eine
eingehende Würdigung dieses Teiles der Sammlung voran. Als ein
Juwel griechischen Meißels bezeichnet Bulle den verhüllten Frauen-
kopf von einem attischen Grabmal aus der Mitte des 4. Jahrh.
v. Chr., jener Zeit, da zuerst Praxiteles dem Frauenantlitz die feine
seelische Belebtheit verlieh, die Eigentum dieser Epoche blieb.
In die kiassiche Zeit des 5. Jahrh. führt der Zeuskopf, eine aus-
gezeichnete und die beste überhaupt erhaltene Kopie eines als
„Dresdener Zeus“ (nach einer dortigen Statue) geläufigen Götter-
typus, der durch die Kopistenzutat des Eichenkranzes hier end-
Aus der großenHerbst
auktion alter Graphik
bei C. G. Boerner,
Leipzig, vom ll.bis 13
November
Augustin Hirschvoge
Landschaft
„museal“. Alle Kunstwerke dienten zum Schmuck des Hauses,
man lebte wirklich mit den Objekten. Unter den Bildern der
italienischen Schule fallen zunächst einige sehr gute frühe
sienesische Arbeiten auf, so eine Barna sehr nahestehende „Kreu-
zigung“, die Predellenstücke mit Szenen aus der Legende der hl.
Barbara von Matteo di Giovanni und eine diesem Künstler nalie-
stehende Madonna mit Heiligen. Die auf den Rat Lenbachs hin
in England erworbenen beiden T i z i a n - Bilder, haben sich nach
sorgfältiger Reinigung als wirklich wertvolle und kunsthistorisch
höchst interessante Schöpfungen erwiesen. Das Bildnis des Gabriel
Taditio, Präfekten der Artillerie Kaiser Karl des V„ ist nach dem
Gutachten von Baron von Hadeln ein Originalwerk Tizians, Ende
der dreißiger Jahre, großartig dekorativ erhalten. Das Exemplar
der von Tizian wiederholt gemalten Komposition „Venus und
Adonis“ bezeichnet Hadeln als ein Werk des Meisters und zwar
eine der besten Repliken, mindestens im Figuralen dem Exemplar
im Prado ebenbürtig.
Unter den niederländischen Arbeiten ragt der thronende hl.
Petrus mit Stifter (15. Jahrh.) hervor. Den Werken des Meisters
der hl. Sippe aufs engste verwandt ist die gute Kölnische Tafel,
welche die Heiligen Katharina und Hieronymus mit den Stiftern
zeigt. Unter den Bildern des 19. Jahrhunderts nennen wir an erster
Stelle die beiden Aquarelle von Wilhelm von Kobell. Allgemein
bekannt ist die Nanna als „Poesie“ von Feuerbach; Steinle, Ludwig
Richter, Schwind und Thoma bieten liebenswürdige Proben ihrer
Kunst. Von Lenbach sehen wir eine ganze Reihe vorzüglicher
gültig als Zeus gesichert erscheint. Die nahe Verwandtschaft mit
Köpfen am Ostfries des Parthenon, besonders des Poseidon und
der Phylenheroen, weist diese Schöpfung in die nächste Nähe des
Pnidias. Die Fortentwicklung der idealen Großformigkeit des
5. Jahrh. zeigt ein schöner Frauenkopf, den man deswegen sogar
in den phidiasischen Kreis zu setzen geneigt war, der aber in
seiner stillen, fast träumerischen Beseeltheit zweifellos ein Werk
des 4. Jahrhunderts wiedergibt, nach Furtwänglers glaubhafter
Vermutung eine Aphrodite, die ihr Haar ordnet. Einige hellenisti-
sche Motive in römischer Wiedergabe leiten zu den Werken der
römischen Dekorationskunst über, unter welchen sich die
Tänzerinnen eines Kandelaberfußes augusteischer Zeit durch ent-
zückende Grazie, der Dionysos einer Schmuckscheibe durch stiir-
mendes Pathos, die späten Sarkophage durch dekorative Wucht
auszeichnen. Sehr bedeutsam ist die Reihe der römischen Por-
träts, die von der republikanischen Zeit bis ins 4. Jahrhundert
uach Chr. reicht.
An den Beschluß seines Vorworts, das auch die griechischen
Terrakotten Heyls und seiner römischen Gläser behandelt, stellt
Bulle die bemalten griechischen Tongefäße. Unter ihnen finden
sich Meisterwerke von hohem Range, die sich an das Werk be-
kannter Meister des strengen und frühklassischen Stils anreihen.
Der „Kunsiwanflerer“ wird in der ganzen weit gelesem
58