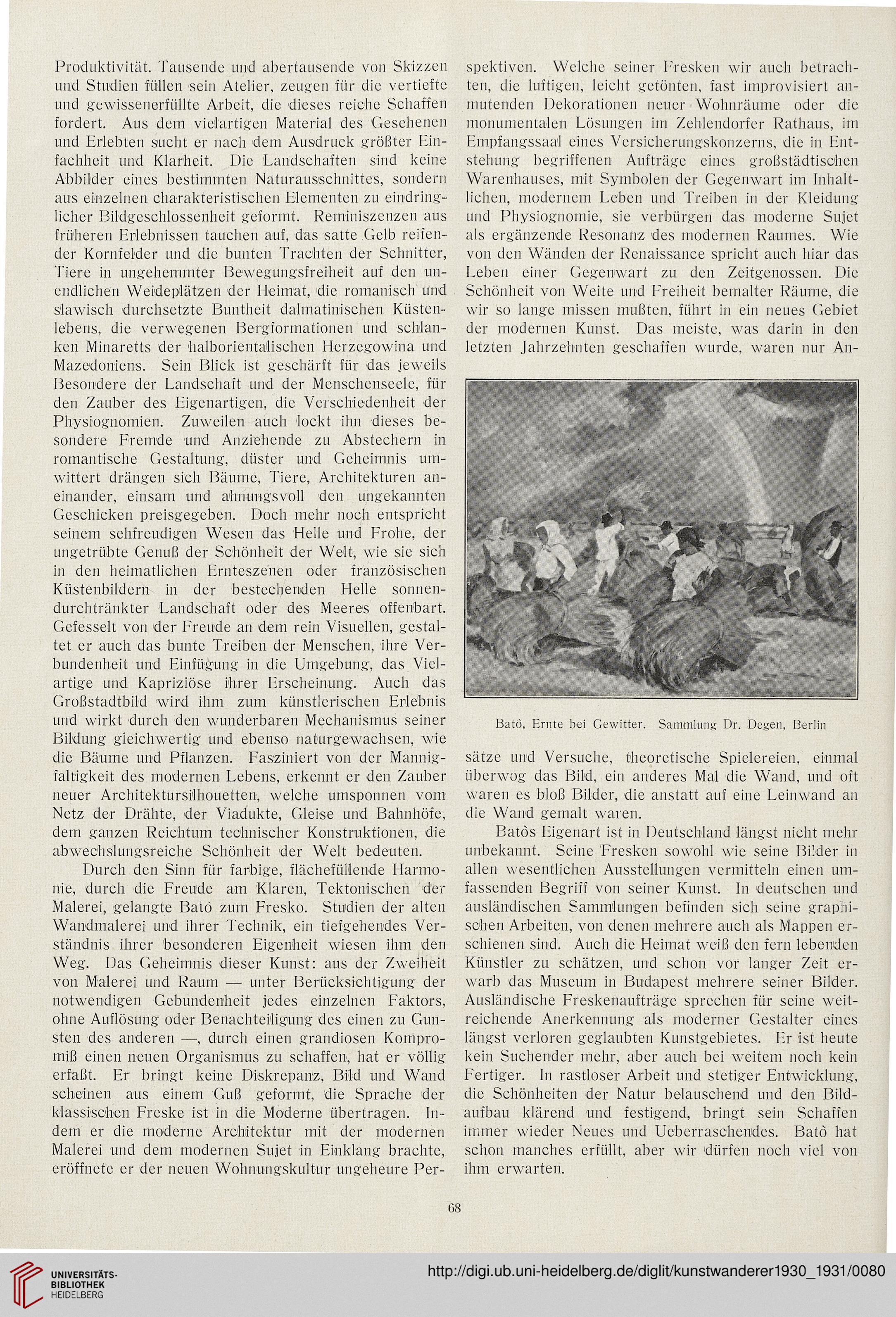Produktivität. Tausende und abertausende von Skizzen
nnd Studien fnllen sein Atelier, zeugen für die vertiefte
und gewissenerfüllte Arbeit, die dieses reiche Schaffen
fordert. Aus dem vieiartigen Material des Gesehenen
und Erlebten sueht er naeh dem Ausdruck größter Ein-
fachheit und Klarheit. Die Landschaften sind keine
Abbilder eines bestimmten Naturausschnittes, sondern
aus einzelnen charakteristischen Elementen zu eindring-
licher Biidgeschlossenheit geformt. Reminiszenzen aus
früheren Erlebnissen tauchen auf, das satte Gelb reifen-
der Kornfelder und die bunten Trachten der Schnitter,
Tiere in ungehemmter Bewegungsfreiheit auf den un-
endlichen VVeideplätzen der Heimat, die romanisch und
siawisch durchsetzte Buntheit dalmatinischen Kiisten-
lebens, die verwegenen Bergformationen und schian-
ken Minaretts der halborientaiischen Herzegowina und
Mazedoniens. Sein Blick ist geschärft für das jeweils
Besondere der Landschaft und der Menschenseele, für
den Zauber des Eigenartigen, die Verschiedenheit der
Physiognomien. Zuweilen auch iockt ihn dieses be-
sondere Eremde und Anziehende zu Abstechern in
romantische Gestaltung, diister und Geheimnis um-
wittert drängen sich Bäume, Tiere, Architekturen an-
einander, einsam und ahnungsvoll den ungekannten
Geschicken preisgegeben. Doch mehr noch entspricht
seinem sehfreudigen Wesen das Helle und Frohe, der
ungetrübte Genuß der Schönheit der Welt, wie sie sich
in den heimatlichen Ernteszenen oder französischen
Küstenbildern in der bestechenden Helle sonnen-
durchtränkter Landschaft oder des Meeres offenbart.
Gefesselt von der Freude an dem rein Visuellen, gestal-
tet er auch das bunte Treiben der Menschen, ihre Ver-
bundenheit und Einfügung in die Umgebung, das Viel-
artige und Kapriziöse ihrer Erscheinung. Auch das
Großstadtbild wird ihm zum künstlerischen Erlebnis
und wirkt durch den wunderbaren Mechanismus seiner
Bildung gieichwertig und ebenso naturgewachsen, wie
die Bäume und Pflanzen. Fasziniert von der Mannig-
faltigkeit des modernen Lebens, erkennt er den Zauber
neuer Architektursiihouetten, welche umsponnen vom
Netz der Drähte, der Viadukte, Gleise und Bahnhöfe,
dem ganzen Reichtum technischer Konstruktionen, die
abwechslungsreiche Schönheit der Welt bedeuten.
Durch den Sinn für farbige, flächefüllende Harmo-
nie, durch die Freude am Klaren, Tektonischen der
Malerei, gelangte Batö zum Fresko. Studien der alten
Wandmalerei und ihrer Technik, ein tiefgehendes Ver-
ständnis ihrer besonderen Eigenheit wiesen ihm den
Weg. Das Geheimnis dieser Kunst: aus der Zweiheit
von Malerei und Raum — unter Berücksichtigung der
notwendigen Gebundenheit jedes einzelnen Faktors,
ohne Auflösung oder Benachteiiigung des einen zu Gun-
sten des anderen —, durch einen grandiosen Kompro-
miß einen neuen Organismus zu schaffen, hat er völlig
erfaßt. Er bringt keine Diskrepanz, Bild und Wand
scheinen aus einem Guß geformt, die Sprache der
kiassischen Freske ist in die Moderne übertragen. In-
dem er die moderne Architektur mit der modernen
Malerei und dem modernen Sujet in Einklang brachte,
eröffnete er der neuen Wohnungskultur ungeheure Per-
spektiven. Welclie seiner Fresken wir aucli betrach-
ten, die luftigen, leicht getönten, fast improvisiert an-
mutenden Dekorationen neuer Wohnräume oder die
monumentalen Lösungen im Zehlendorfer Rathaus, im
Empfangssaal eines Versicherungskonzerns, die in Ent-
stehung begriffenen Aufträge eines großstädtischen
Warenhauses, mit Symbolen der Gegenwart im Inlialt-
lichen, modernem Leben und Treiben in der Kleidung
und Physiognomie, sie verbürgen das moderne Sujet
als ergänzende Resonanz des modernen Raumes. Wie
von den Wänden der Renaissance spricht auch hiar das
Leben einer Gegenwart zu den Zeitgenossen. Die
Schönheit von Weite und Freiheit bemalter Räume, die
wir so lange missen mußten, führt in ein neues Gebiet
der modernen Kunst. Das meiste, was darin in den
letzten Jahrzehnten geschaffen wurde, waren nur An-
Batö, Ernte bei Gewitter. Sammlung Dr. Degen, Berlin
sätze und Versuche, theoretische Spielereien, einmal
überwog das Bild, ein anderes Mal die Wand, und oft
waren es bioß Bilder, die anstatt auf eine Leinwand an
die Wand gemalt waren.
Batös Eigenart ist in Deutschland längst nicht mehr
uubekannt. Seine Fresken sowolil wie seine Bilder in
allen wesentlichen Ausstellungen vermitteln einen um-
fassenden Begriff von seiner Kunst. ln deutschen und
ausländischen Sammlungen befinden sich seine graphi-
schen Arbeiten, von denen mehrere aucli als Mappen er-
schienen sind. Aucli die Heimat weiß den fern lebenden
Ktinstier zu schätzen, und schon vor langer Zeit er-
warb das Museurn in Budapest mehrere seiner Bilder.
Ausländische Freskenaufträge sprechen für seine weit-
reichende Anerkennung als moderner Gestalter eines
längst verloren geglaubten Kunstgebietes. Er ist heute
kein Suchender mehr, aber aucli bci weitem noch kein
Fertiger. In rastloser Arbeit und stetiger Entwicklung,
die Schönheiten der Natur belauschend und den Bild-
aufbau klärend und festigend, bringt sein Schaffen
immer wieder Neues und Ueberraschendes. Batö hat
schon manches erfüllt, aber wir dürfen noch viel von
ihm erwarten.
68
nnd Studien fnllen sein Atelier, zeugen für die vertiefte
und gewissenerfüllte Arbeit, die dieses reiche Schaffen
fordert. Aus dem vieiartigen Material des Gesehenen
und Erlebten sueht er naeh dem Ausdruck größter Ein-
fachheit und Klarheit. Die Landschaften sind keine
Abbilder eines bestimmten Naturausschnittes, sondern
aus einzelnen charakteristischen Elementen zu eindring-
licher Biidgeschlossenheit geformt. Reminiszenzen aus
früheren Erlebnissen tauchen auf, das satte Gelb reifen-
der Kornfelder und die bunten Trachten der Schnitter,
Tiere in ungehemmter Bewegungsfreiheit auf den un-
endlichen VVeideplätzen der Heimat, die romanisch und
siawisch durchsetzte Buntheit dalmatinischen Kiisten-
lebens, die verwegenen Bergformationen und schian-
ken Minaretts der halborientaiischen Herzegowina und
Mazedoniens. Sein Blick ist geschärft für das jeweils
Besondere der Landschaft und der Menschenseele, für
den Zauber des Eigenartigen, die Verschiedenheit der
Physiognomien. Zuweilen auch iockt ihn dieses be-
sondere Eremde und Anziehende zu Abstechern in
romantische Gestaltung, diister und Geheimnis um-
wittert drängen sich Bäume, Tiere, Architekturen an-
einander, einsam und ahnungsvoll den ungekannten
Geschicken preisgegeben. Doch mehr noch entspricht
seinem sehfreudigen Wesen das Helle und Frohe, der
ungetrübte Genuß der Schönheit der Welt, wie sie sich
in den heimatlichen Ernteszenen oder französischen
Küstenbildern in der bestechenden Helle sonnen-
durchtränkter Landschaft oder des Meeres offenbart.
Gefesselt von der Freude an dem rein Visuellen, gestal-
tet er auch das bunte Treiben der Menschen, ihre Ver-
bundenheit und Einfügung in die Umgebung, das Viel-
artige und Kapriziöse ihrer Erscheinung. Auch das
Großstadtbild wird ihm zum künstlerischen Erlebnis
und wirkt durch den wunderbaren Mechanismus seiner
Bildung gieichwertig und ebenso naturgewachsen, wie
die Bäume und Pflanzen. Fasziniert von der Mannig-
faltigkeit des modernen Lebens, erkennt er den Zauber
neuer Architektursiihouetten, welche umsponnen vom
Netz der Drähte, der Viadukte, Gleise und Bahnhöfe,
dem ganzen Reichtum technischer Konstruktionen, die
abwechslungsreiche Schönheit der Welt bedeuten.
Durch den Sinn für farbige, flächefüllende Harmo-
nie, durch die Freude am Klaren, Tektonischen der
Malerei, gelangte Batö zum Fresko. Studien der alten
Wandmalerei und ihrer Technik, ein tiefgehendes Ver-
ständnis ihrer besonderen Eigenheit wiesen ihm den
Weg. Das Geheimnis dieser Kunst: aus der Zweiheit
von Malerei und Raum — unter Berücksichtigung der
notwendigen Gebundenheit jedes einzelnen Faktors,
ohne Auflösung oder Benachteiiigung des einen zu Gun-
sten des anderen —, durch einen grandiosen Kompro-
miß einen neuen Organismus zu schaffen, hat er völlig
erfaßt. Er bringt keine Diskrepanz, Bild und Wand
scheinen aus einem Guß geformt, die Sprache der
kiassischen Freske ist in die Moderne übertragen. In-
dem er die moderne Architektur mit der modernen
Malerei und dem modernen Sujet in Einklang brachte,
eröffnete er der neuen Wohnungskultur ungeheure Per-
spektiven. Welclie seiner Fresken wir aucli betrach-
ten, die luftigen, leicht getönten, fast improvisiert an-
mutenden Dekorationen neuer Wohnräume oder die
monumentalen Lösungen im Zehlendorfer Rathaus, im
Empfangssaal eines Versicherungskonzerns, die in Ent-
stehung begriffenen Aufträge eines großstädtischen
Warenhauses, mit Symbolen der Gegenwart im Inlialt-
lichen, modernem Leben und Treiben in der Kleidung
und Physiognomie, sie verbürgen das moderne Sujet
als ergänzende Resonanz des modernen Raumes. Wie
von den Wänden der Renaissance spricht auch hiar das
Leben einer Gegenwart zu den Zeitgenossen. Die
Schönheit von Weite und Freiheit bemalter Räume, die
wir so lange missen mußten, führt in ein neues Gebiet
der modernen Kunst. Das meiste, was darin in den
letzten Jahrzehnten geschaffen wurde, waren nur An-
Batö, Ernte bei Gewitter. Sammlung Dr. Degen, Berlin
sätze und Versuche, theoretische Spielereien, einmal
überwog das Bild, ein anderes Mal die Wand, und oft
waren es bioß Bilder, die anstatt auf eine Leinwand an
die Wand gemalt waren.
Batös Eigenart ist in Deutschland längst nicht mehr
uubekannt. Seine Fresken sowolil wie seine Bilder in
allen wesentlichen Ausstellungen vermitteln einen um-
fassenden Begriff von seiner Kunst. ln deutschen und
ausländischen Sammlungen befinden sich seine graphi-
schen Arbeiten, von denen mehrere aucli als Mappen er-
schienen sind. Aucli die Heimat weiß den fern lebenden
Ktinstier zu schätzen, und schon vor langer Zeit er-
warb das Museurn in Budapest mehrere seiner Bilder.
Ausländische Freskenaufträge sprechen für seine weit-
reichende Anerkennung als moderner Gestalter eines
längst verloren geglaubten Kunstgebietes. Er ist heute
kein Suchender mehr, aber aucli bci weitem noch kein
Fertiger. In rastloser Arbeit und stetiger Entwicklung,
die Schönheiten der Natur belauschend und den Bild-
aufbau klärend und festigend, bringt sein Schaffen
immer wieder Neues und Ueberraschendes. Batö hat
schon manches erfüllt, aber wir dürfen noch viel von
ihm erwarten.
68