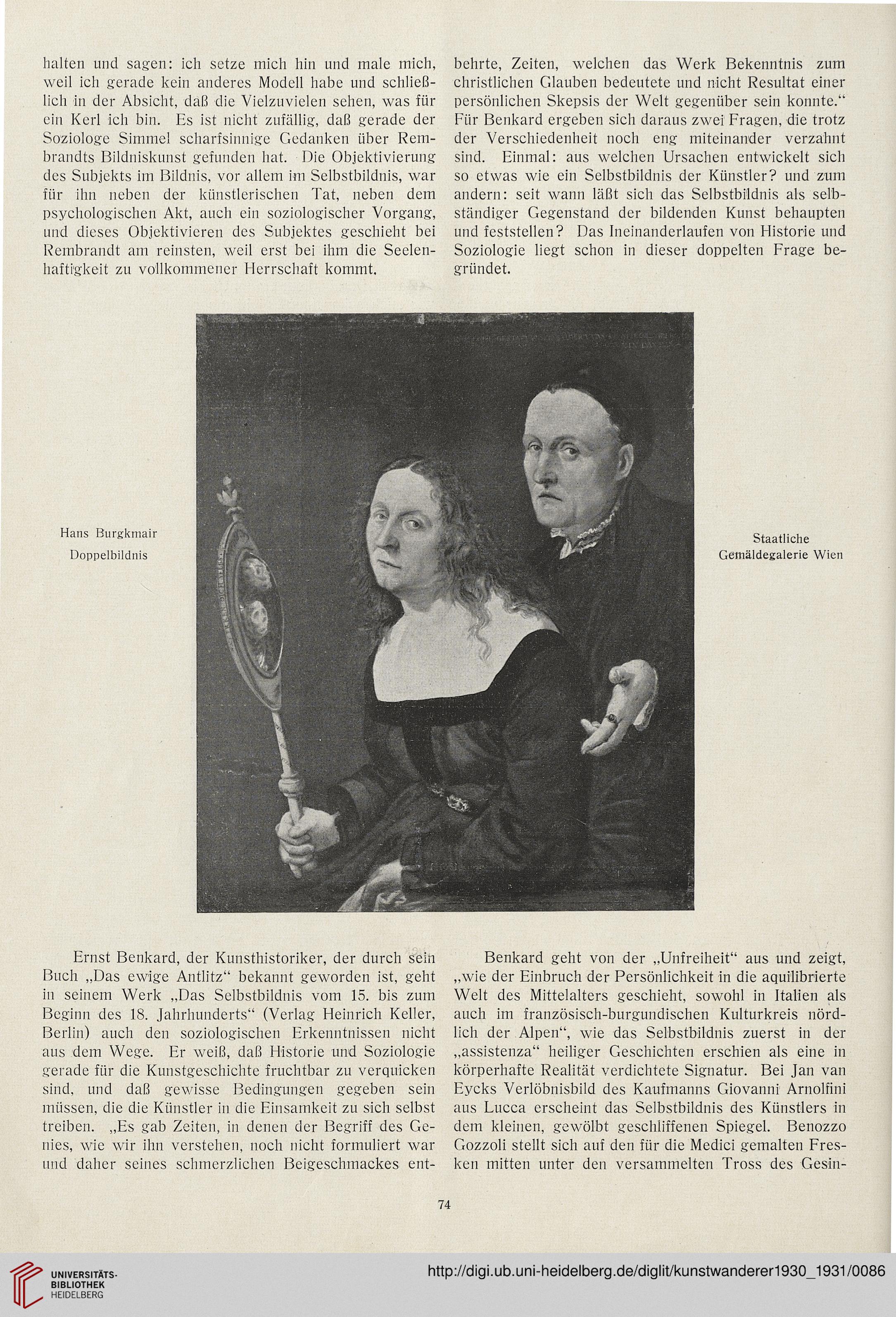halten und sagen: ich setze mich hin und male mich,
weil ich gerade kein anderes Modell habe und schließ-
lich in der Absicht, daß die Vielzuviclen sehen, was für
ein Kerl ich bin. Es ist nicht zufällig, daß gerade der
Soziologe Simmel scharfsinnige Gedanken über Rem-
brandts Bildniskunst gefunden hat. Die Objektivierung
des Subjekts im Bildnis, vor allem im Selbstbildnis, war
für ihn neben der künstlerischen Tat, neben dem
psychologischen Akt, auch ein soziologischer Vorgang,
und dieses Objektivieren des Subjektes geschieht bei
Rembrandt am reinsten, weil erst bei ihm die Seelen-
haftigkeit zu vollkommener Herrschaft kommt.
behrte, Zeiten, welchen das Werk Bekenntnis zum
christlichen Glauben bedeutete und nicht Resultat einer
persönlichen Skepsis der Welt gegenüber sein konnte.“
Fiir Benkard ergeben sicli daraus zwei Fragen, die trotz
der Verschiedenheit noch eng miteinander verzahnt
sind. Einmal: aus welchen Firsachen entwickelt sich
so etwas wie ein Selbstbildnis der Künstler? und zum
andern: seit wann läßt sich das Selbstbildnis als selb-
ständiger Gegenstand der bildenden Kunst behaupten
und feststellen? Das Ineinanderlaufen von Historie und
Soziologie liegt schon in dieser doppelten Frage be-
gründet.
Hans Burgkmair
Doppelbildnis
Staatliche
Gemäldegalerie Wien
Ernst Benkard, der Kunsthistoriker, der durch sein
Buch „Das ewige Antlitz“ bekannt geworden ist, geht
in seinem Werk „Das Selbstbildnis vom 15. bis zum
Beginn des 18. Jahrhunderts“ (Verlag Heinrich Keller,
Berlin) auch den soziologischen Erkenntnissen nicht
aus dem Wege. Er weiß, daß Historie und Soziologie
gerade für die Kunstgeschichte fruchtbar zu verquicken
sind, und daß gewisse Bedingungen gegeben sein
miissen, die die Künstler in die Einsamkeit zu sich selbst
treiben. „Es gab Zeiten, in denen der Begriff des Ge-
nies, wie wir ihn verstehen, noch nicht formuliert war
und daher seines schmerzlichen Beigeschmackes ent-
Benkard geht von der „Unfreiheit“ aus und zeigt,
„wie der Einbruch der Persönlichkeit in die aquilibrierte
Welt des Mittelalters geschieht, sowohl in Italien als
auch im französisch-burgundischen Kulturkreis nörd-
lich der Alpen“, wie das Selbstbildnis zuerst in der
„assistenza“ heiliger Gescnichten erschien als eine in
körperhafte Realität verdichtete Signatur. Bei Jan van
Eycks Verlöbnisbild des Kaufmanns Giovanni Arnolfini
aus Lucca erscheint das Selbstbildnis des Künstlers in
dem kleinen, gewölbt geschliffenen Spiegel. Benozzo
Gozzoli stellt sich auf den für die Medici gemalten Fres-
ken mitten unter den versammelten Tross des Gesin-
74
weil ich gerade kein anderes Modell habe und schließ-
lich in der Absicht, daß die Vielzuviclen sehen, was für
ein Kerl ich bin. Es ist nicht zufällig, daß gerade der
Soziologe Simmel scharfsinnige Gedanken über Rem-
brandts Bildniskunst gefunden hat. Die Objektivierung
des Subjekts im Bildnis, vor allem im Selbstbildnis, war
für ihn neben der künstlerischen Tat, neben dem
psychologischen Akt, auch ein soziologischer Vorgang,
und dieses Objektivieren des Subjektes geschieht bei
Rembrandt am reinsten, weil erst bei ihm die Seelen-
haftigkeit zu vollkommener Herrschaft kommt.
behrte, Zeiten, welchen das Werk Bekenntnis zum
christlichen Glauben bedeutete und nicht Resultat einer
persönlichen Skepsis der Welt gegenüber sein konnte.“
Fiir Benkard ergeben sicli daraus zwei Fragen, die trotz
der Verschiedenheit noch eng miteinander verzahnt
sind. Einmal: aus welchen Firsachen entwickelt sich
so etwas wie ein Selbstbildnis der Künstler? und zum
andern: seit wann läßt sich das Selbstbildnis als selb-
ständiger Gegenstand der bildenden Kunst behaupten
und feststellen? Das Ineinanderlaufen von Historie und
Soziologie liegt schon in dieser doppelten Frage be-
gründet.
Hans Burgkmair
Doppelbildnis
Staatliche
Gemäldegalerie Wien
Ernst Benkard, der Kunsthistoriker, der durch sein
Buch „Das ewige Antlitz“ bekannt geworden ist, geht
in seinem Werk „Das Selbstbildnis vom 15. bis zum
Beginn des 18. Jahrhunderts“ (Verlag Heinrich Keller,
Berlin) auch den soziologischen Erkenntnissen nicht
aus dem Wege. Er weiß, daß Historie und Soziologie
gerade für die Kunstgeschichte fruchtbar zu verquicken
sind, und daß gewisse Bedingungen gegeben sein
miissen, die die Künstler in die Einsamkeit zu sich selbst
treiben. „Es gab Zeiten, in denen der Begriff des Ge-
nies, wie wir ihn verstehen, noch nicht formuliert war
und daher seines schmerzlichen Beigeschmackes ent-
Benkard geht von der „Unfreiheit“ aus und zeigt,
„wie der Einbruch der Persönlichkeit in die aquilibrierte
Welt des Mittelalters geschieht, sowohl in Italien als
auch im französisch-burgundischen Kulturkreis nörd-
lich der Alpen“, wie das Selbstbildnis zuerst in der
„assistenza“ heiliger Gescnichten erschien als eine in
körperhafte Realität verdichtete Signatur. Bei Jan van
Eycks Verlöbnisbild des Kaufmanns Giovanni Arnolfini
aus Lucca erscheint das Selbstbildnis des Künstlers in
dem kleinen, gewölbt geschliffenen Spiegel. Benozzo
Gozzoli stellt sich auf den für die Medici gemalten Fres-
ken mitten unter den versammelten Tross des Gesin-
74