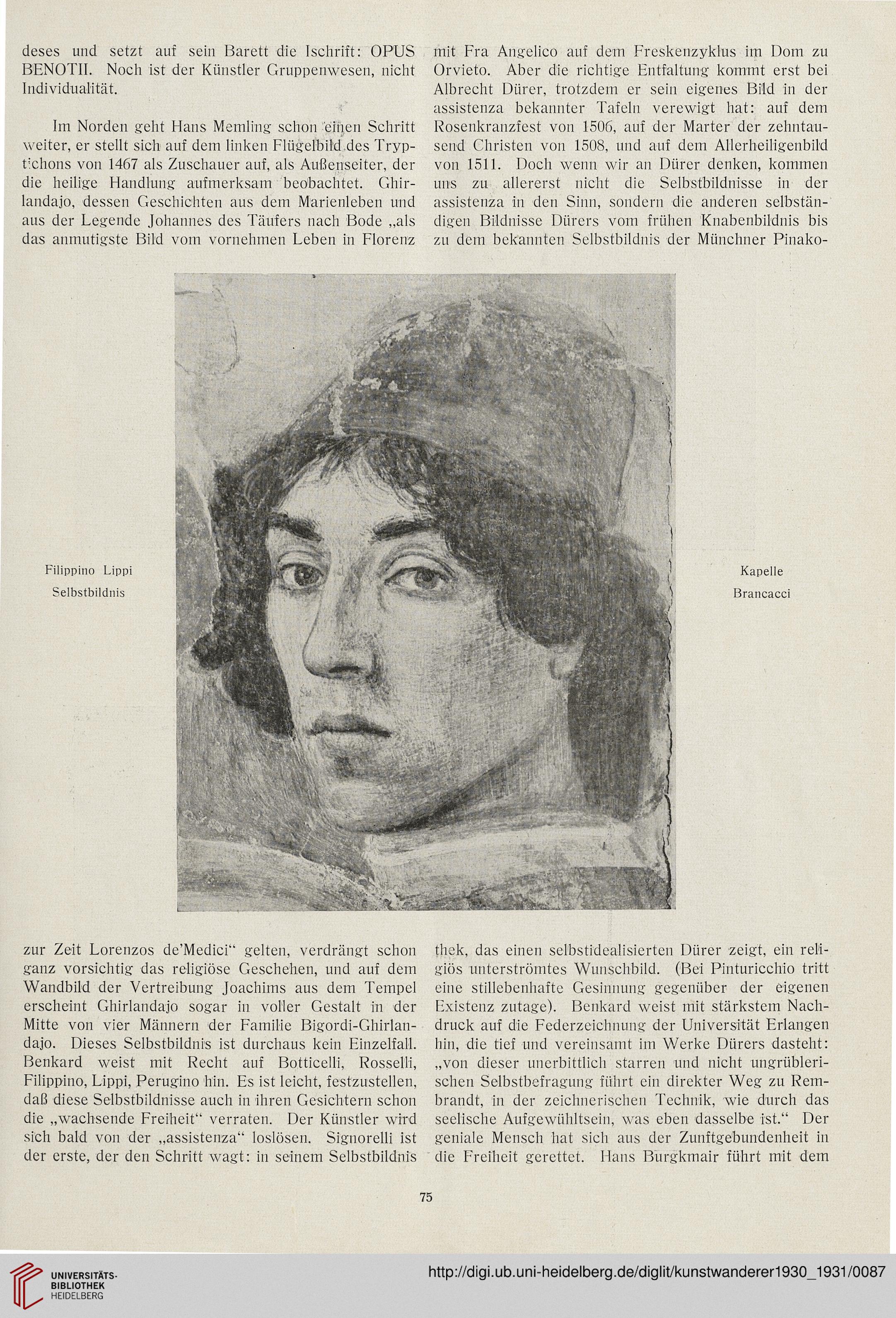deses und setzt auf seiu Barett die Ischrift: OPUS
BENOTII. Nocli ist der Künstler Gruppenwesen, nicht
Individualität.
Im Norden geht Hans Memling; schon 'eineii Schritt
weiter, er stellt sich auf dem linken Flügelbild des Tryp-
txhons von 1467 als Zuschauer auf, als Außenseiter, der
die heilige Handlung aufmerksam beobachtet. Ghir-
landajo, dessen Geschichten aus dem Marienleben und
aus der Legende Johannes des Täufers nach Bode „als
das anmutigste Bilcl vom vornehmen Leben in Florenz
mit Fra Angelico auf dem Freskenzyklus im Dom zu
Orvieto. Aber die richtige Entfaltung kommt erst bei
Albrecht Dürer, trotzdcm er sein eigenes Bitd in der
assistenza bekannter Tafeln verewigt hat: auf dem
Rosenkranzfest von 1506, auf der Marter der zehntau-
send Christen von 1508, und auf dem Allerheiligenbild
von 1511. Doch wenn wir an Dürer denken, kommen
uns zu allererst nicht die Selbstbildnisse in der
assistenza in den Sinn, sondern die anderen selbstän-
digen Bildnisse Dtircrs vom frühen Knabenbildnis bis
zu dern bekannten Selbstbildnis der Münchner Pinako-
Filippino Lippi
Selbstbildnis
Kapelle
Brancacci
zur Zeit Lorenzos de’Medici“ gelten, verdrängt schon
ganz vorsichtig das religiöse Geschehen, und auf dem
Wandbild der Vertreibung Joachims aus dem Tempel
erscheint Ghirlandajo sogar in voller Gestalt in der
Mitte von vier Männern der Familie Bigordi-Ghirlan-
dajo. Dieses Selbstbiidnis ist durchaus kein Einzelfall.
Benkard weist mit Recht auf Botticelli, Rosselli,
Filippino, Lippi, Perugino hin. Es ist leicht, festzustellen,
daß diese Selbstbildnisse auch in iliren Gesichtern schon
die „wachsende Freiheit“ verraten. Der Künstler wird
sich bald von der „assistenza“ loslösen. Signorelli ist
der erste, der den Schritt wagt: in seinem Selbstbildnis
thek, das einen selbstidealisierten Dürer zeigt, ein reli-
giös uriterströmtes Wunschbild. (Bei Pinturicchio tritt
eine stillebenhafte Gesinnung gegenübcr der eigenen
Fxistenz zutage). Benkard weist mit stärkstem Nach-
druck auf die Federzeichnung der Universität Erlangen
hin, die tief und vereinsamt im Werke Diirers dasteht:
„von dieser unerbittlich starren und nicht ungrübleri-
schen Selbstbefragung fiihrt ein direkter Weg zu Rem-
brandt, in der zeichnerischen Tcchnik, wie durch das
seclische Aufgewühltsein, was eben dasselbe ist.“ Der
geniale Mensch hat sich aus der Zunftgebundenheit in
die Freiheit gerettet. Hans Burgkmair führt mit dem
75
BENOTII. Nocli ist der Künstler Gruppenwesen, nicht
Individualität.
Im Norden geht Hans Memling; schon 'eineii Schritt
weiter, er stellt sich auf dem linken Flügelbild des Tryp-
txhons von 1467 als Zuschauer auf, als Außenseiter, der
die heilige Handlung aufmerksam beobachtet. Ghir-
landajo, dessen Geschichten aus dem Marienleben und
aus der Legende Johannes des Täufers nach Bode „als
das anmutigste Bilcl vom vornehmen Leben in Florenz
mit Fra Angelico auf dem Freskenzyklus im Dom zu
Orvieto. Aber die richtige Entfaltung kommt erst bei
Albrecht Dürer, trotzdcm er sein eigenes Bitd in der
assistenza bekannter Tafeln verewigt hat: auf dem
Rosenkranzfest von 1506, auf der Marter der zehntau-
send Christen von 1508, und auf dem Allerheiligenbild
von 1511. Doch wenn wir an Dürer denken, kommen
uns zu allererst nicht die Selbstbildnisse in der
assistenza in den Sinn, sondern die anderen selbstän-
digen Bildnisse Dtircrs vom frühen Knabenbildnis bis
zu dern bekannten Selbstbildnis der Münchner Pinako-
Filippino Lippi
Selbstbildnis
Kapelle
Brancacci
zur Zeit Lorenzos de’Medici“ gelten, verdrängt schon
ganz vorsichtig das religiöse Geschehen, und auf dem
Wandbild der Vertreibung Joachims aus dem Tempel
erscheint Ghirlandajo sogar in voller Gestalt in der
Mitte von vier Männern der Familie Bigordi-Ghirlan-
dajo. Dieses Selbstbiidnis ist durchaus kein Einzelfall.
Benkard weist mit Recht auf Botticelli, Rosselli,
Filippino, Lippi, Perugino hin. Es ist leicht, festzustellen,
daß diese Selbstbildnisse auch in iliren Gesichtern schon
die „wachsende Freiheit“ verraten. Der Künstler wird
sich bald von der „assistenza“ loslösen. Signorelli ist
der erste, der den Schritt wagt: in seinem Selbstbildnis
thek, das einen selbstidealisierten Dürer zeigt, ein reli-
giös uriterströmtes Wunschbild. (Bei Pinturicchio tritt
eine stillebenhafte Gesinnung gegenübcr der eigenen
Fxistenz zutage). Benkard weist mit stärkstem Nach-
druck auf die Federzeichnung der Universität Erlangen
hin, die tief und vereinsamt im Werke Diirers dasteht:
„von dieser unerbittlich starren und nicht ungrübleri-
schen Selbstbefragung fiihrt ein direkter Weg zu Rem-
brandt, in der zeichnerischen Tcchnik, wie durch das
seclische Aufgewühltsein, was eben dasselbe ist.“ Der
geniale Mensch hat sich aus der Zunftgebundenheit in
die Freiheit gerettet. Hans Burgkmair führt mit dem
75