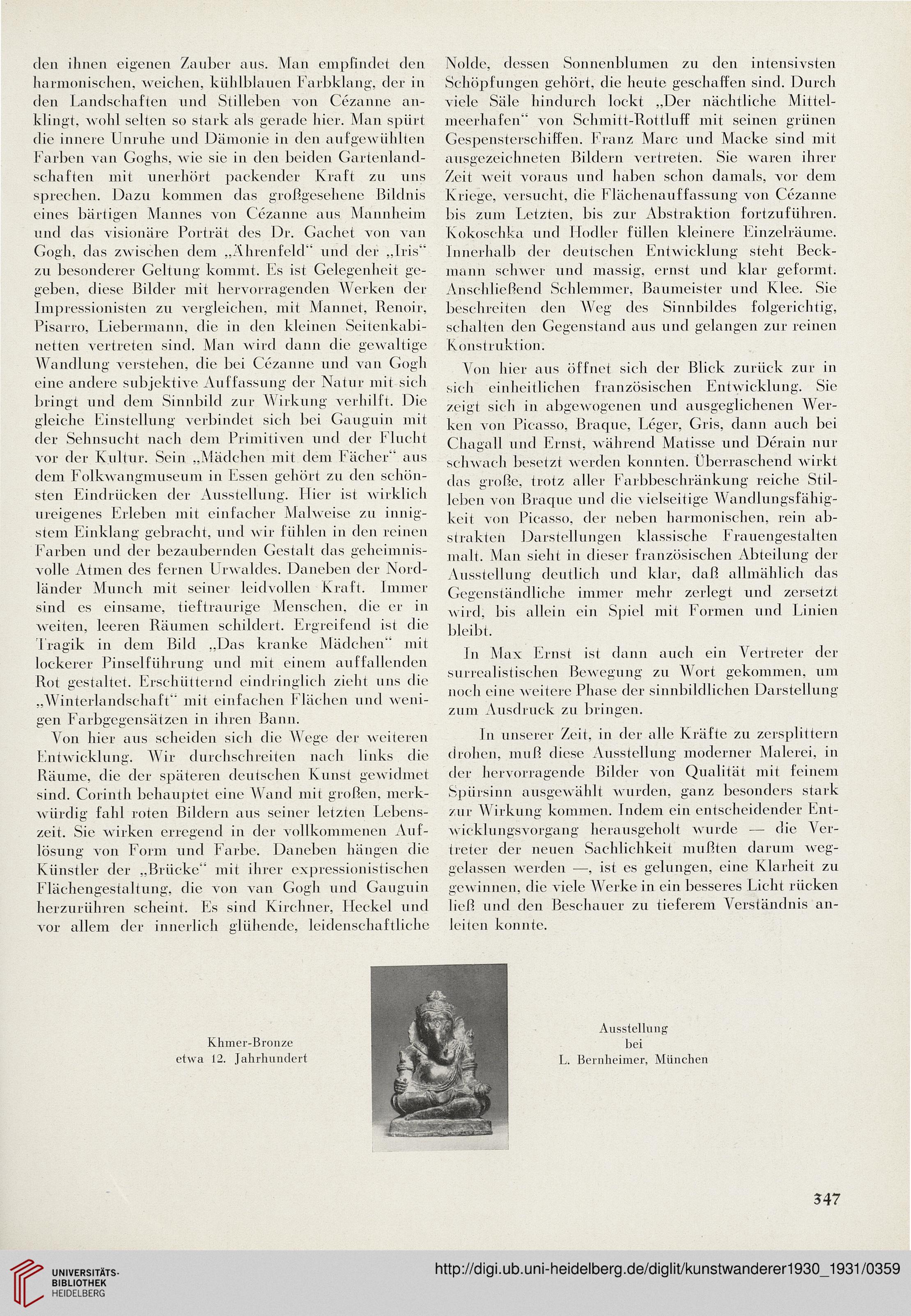den ihnen eigenen Zauber aus. Man empfindet dcn
harmonischen, weichen, kiihlblauen Farbklang, der in
den Landschaften und Stilleben von Cezanne an-
klingt, wohl selten so stark als gerade Iiier. Man spiirt
die innere Unruhe und Dämonie in den aufgewühlten
Farben van Goghs, wie sie in den beiden Gartenland-
schaften mit unerhört packender Kraft zu uns
sprechen. Dazu kommen das großgesehene Bildnis
eines bärtigen Mannes von Cezanne aus Mannheim
und das visionäre Porträt des Dr. Gachet von van
Gogh, das zwischen dem „Ährenfeld" und der „Iris“
zu besonderer Geltung kommt. Es ist Gelegenheit ge-
geben, diese Bikler mit hervorragenden Werken der
Impressionisten zu vergleichen, mit Mannet, Renoir,
Pisarro, Liebermann, die in den kleinen Seitenkabi-
netten vertreten sind. Man wird dann die gewaltige
Wandlung verstehen, die bei Cezanne und van Gogli
eine andere subjektive Auffassung der Natur mit sich
bringt und dem Sinnbild ziil' Wirkung verhilft. Die
gleiche Einstellung verbindet sich bei Gauguin mit
der Sehnsucht nach dem Primitiven und der Flucht
vor dei- Kultur. Sein „Mädchen mit dem Fäclier" aus
dcm Folkwangmuseum in Essen gehört zu den scliön-
sten Eindriicken der Ausstellung. Hier ist wirklich
ureigenes Erleben mit einfacher Malweise zu innig-
stem Einklang gebracht, und wir fühlen in den reinen
Farben und der bezaubernden Gestalt das geheimnis-
volle Atmen des fernen Urwaldes. Daneben der Nord-
länder Muneh mit seiner leidvollen Kraft. Immer
sind es einsame, tieftraurige Menschen, die er in
weiten, leeren Räumen schildert. Ergreifend ist die
Iragik in dem Bild „Das kranke Mädchen" mit
lockerer Pinselführung und mit einem auffallenden
Rot gestaltet. Erschütterud eindringlich zielit uns die
„Winterlandschaft" mit einfachen Flächen und weni-
gen Farbgegensätzen in ihren Bann.
Yon liier aus scheiden sich die Wege der weiteren
Entwicklung. Wir durchschreiten nacli links die
Räume, die der späteren deutschen Kunst gewidinet
sind. Corinth behauptet eine Wand mit großen, merk-
würdig fahl roten Bildern aus seincr letzten Lebens-
zeit. Sie wirken erregend in der vollkommenen Auf-
lösung von Form und Farbe. Daneben hängen die
Kiinstler der „Brücke" mit ihrer expressionistischen
Flächengestaltung, die von van Gogh und Gauguin
herzurühren scheint. Es sind Kirchner, Heckel und
vor allem der innerlich gliihende, leidenschaftliche
Nolde, dessen Sonnenblumen zu den intensivsten
Schöpfungen gehört, die heute geschaffen sind. Durch
viele Säle hindurch lockt „Der nächtliche Mittel-
mcerhafeu" von Schmitt-Rottluff mit seinen grünen
Gespensterschiffen. Franz Marc und Macke sind mit
ausgezeichneten Bildern vertreten. Sie waren ihrer
Zeit weit voraus und haben schon damals, vor dem
Kriege, versucht, die Flächenauffassung von Cezanne
bis zum Letzten, bis zur Abstraktion fortzuführen.
Kökosehka und Hodler fiillen kleinere Einzelräume.
Innerhalb der deutschen Entwicklung steht Beck-
mann schwer und massig, ernst und klar geformt.
Anschließend Schlemmer, Baumeister und Klee. Sie
beschreiten den Weg des Sinnbildes folgerichtig,
schalten den Gegenstand aus und gelangen zur reinen
Konstruktion.
Yon hier aus öffnet sich der Blick zuriick zur in
sich einheitlichen französischen Entwicklung. Sie
zeigt sicli in abgewogenen und ausgeglichenen Wer-
ken von Picasso, Braque, Leger, Gris, dann aucli bei
Cliagall und Ernst, während Matisse und Derain nur
schwach besetzt werden konnten. Überraschend wirkt
däs große, trotz aller Farbbeschränkung reiche Stil-
leben von Braque und dic vielseitige Wandlungsfähig-
keit von Picasso, der neben harmonischen, rein ab-
strakten Darstellungen klassische Frauengestalten
malt. Man sieht in dieser französischen Abteilung der
Ausstellung deutlich und klar, daß allmählich das
Gegenständliche immer rnehr zerlegt und zersetzt
wird, bis allein ein Spiel mit Formen und Linien
bleibt.
In Max Ernst ist dann auch ein Vertreter der
surrealistischen Bewegung zu Wort gekommen, um
nocli eine weitere Phase der sinnbildlichen Darstellung
zum Ausdruck zu bringen.
In unserer Zeit, in der alle Kräfte zu zersplittern
drohen, muß diese Ausstellung moderner Malerei, in
cler hervorragende Bilder von Qualität mit feinem
Spürsinn ausgewählt wurden, ganz besonders stark
zur Wirkung kommen. Indem ein entscheidender Ent-
wicklungsvorgang herausgeholt wurde — die Yer-
treter der neuen Sachlichkeit mußten darum weg-
gelassen werden —, ist es gelungen, eine Klarheit zu
gewinnen, die viele Werke in ein besseres Licht riicken
ließ. und den Beschauer zu tieferem Yerständnis an-
leiten konnte.
Khmer-Bronze
etwa 12. Jahrhundert
Ausstellung
bei
L. Bernheimer, München
547
harmonischen, weichen, kiihlblauen Farbklang, der in
den Landschaften und Stilleben von Cezanne an-
klingt, wohl selten so stark als gerade Iiier. Man spiirt
die innere Unruhe und Dämonie in den aufgewühlten
Farben van Goghs, wie sie in den beiden Gartenland-
schaften mit unerhört packender Kraft zu uns
sprechen. Dazu kommen das großgesehene Bildnis
eines bärtigen Mannes von Cezanne aus Mannheim
und das visionäre Porträt des Dr. Gachet von van
Gogh, das zwischen dem „Ährenfeld" und der „Iris“
zu besonderer Geltung kommt. Es ist Gelegenheit ge-
geben, diese Bikler mit hervorragenden Werken der
Impressionisten zu vergleichen, mit Mannet, Renoir,
Pisarro, Liebermann, die in den kleinen Seitenkabi-
netten vertreten sind. Man wird dann die gewaltige
Wandlung verstehen, die bei Cezanne und van Gogli
eine andere subjektive Auffassung der Natur mit sich
bringt und dem Sinnbild ziil' Wirkung verhilft. Die
gleiche Einstellung verbindet sich bei Gauguin mit
der Sehnsucht nach dem Primitiven und der Flucht
vor dei- Kultur. Sein „Mädchen mit dem Fäclier" aus
dcm Folkwangmuseum in Essen gehört zu den scliön-
sten Eindriicken der Ausstellung. Hier ist wirklich
ureigenes Erleben mit einfacher Malweise zu innig-
stem Einklang gebracht, und wir fühlen in den reinen
Farben und der bezaubernden Gestalt das geheimnis-
volle Atmen des fernen Urwaldes. Daneben der Nord-
länder Muneh mit seiner leidvollen Kraft. Immer
sind es einsame, tieftraurige Menschen, die er in
weiten, leeren Räumen schildert. Ergreifend ist die
Iragik in dem Bild „Das kranke Mädchen" mit
lockerer Pinselführung und mit einem auffallenden
Rot gestaltet. Erschütterud eindringlich zielit uns die
„Winterlandschaft" mit einfachen Flächen und weni-
gen Farbgegensätzen in ihren Bann.
Yon liier aus scheiden sich die Wege der weiteren
Entwicklung. Wir durchschreiten nacli links die
Räume, die der späteren deutschen Kunst gewidinet
sind. Corinth behauptet eine Wand mit großen, merk-
würdig fahl roten Bildern aus seincr letzten Lebens-
zeit. Sie wirken erregend in der vollkommenen Auf-
lösung von Form und Farbe. Daneben hängen die
Kiinstler der „Brücke" mit ihrer expressionistischen
Flächengestaltung, die von van Gogh und Gauguin
herzurühren scheint. Es sind Kirchner, Heckel und
vor allem der innerlich gliihende, leidenschaftliche
Nolde, dessen Sonnenblumen zu den intensivsten
Schöpfungen gehört, die heute geschaffen sind. Durch
viele Säle hindurch lockt „Der nächtliche Mittel-
mcerhafeu" von Schmitt-Rottluff mit seinen grünen
Gespensterschiffen. Franz Marc und Macke sind mit
ausgezeichneten Bildern vertreten. Sie waren ihrer
Zeit weit voraus und haben schon damals, vor dem
Kriege, versucht, die Flächenauffassung von Cezanne
bis zum Letzten, bis zur Abstraktion fortzuführen.
Kökosehka und Hodler fiillen kleinere Einzelräume.
Innerhalb der deutschen Entwicklung steht Beck-
mann schwer und massig, ernst und klar geformt.
Anschließend Schlemmer, Baumeister und Klee. Sie
beschreiten den Weg des Sinnbildes folgerichtig,
schalten den Gegenstand aus und gelangen zur reinen
Konstruktion.
Yon hier aus öffnet sich der Blick zuriick zur in
sich einheitlichen französischen Entwicklung. Sie
zeigt sicli in abgewogenen und ausgeglichenen Wer-
ken von Picasso, Braque, Leger, Gris, dann aucli bei
Cliagall und Ernst, während Matisse und Derain nur
schwach besetzt werden konnten. Überraschend wirkt
däs große, trotz aller Farbbeschränkung reiche Stil-
leben von Braque und dic vielseitige Wandlungsfähig-
keit von Picasso, der neben harmonischen, rein ab-
strakten Darstellungen klassische Frauengestalten
malt. Man sieht in dieser französischen Abteilung der
Ausstellung deutlich und klar, daß allmählich das
Gegenständliche immer rnehr zerlegt und zersetzt
wird, bis allein ein Spiel mit Formen und Linien
bleibt.
In Max Ernst ist dann auch ein Vertreter der
surrealistischen Bewegung zu Wort gekommen, um
nocli eine weitere Phase der sinnbildlichen Darstellung
zum Ausdruck zu bringen.
In unserer Zeit, in der alle Kräfte zu zersplittern
drohen, muß diese Ausstellung moderner Malerei, in
cler hervorragende Bilder von Qualität mit feinem
Spürsinn ausgewählt wurden, ganz besonders stark
zur Wirkung kommen. Indem ein entscheidender Ent-
wicklungsvorgang herausgeholt wurde — die Yer-
treter der neuen Sachlichkeit mußten darum weg-
gelassen werden —, ist es gelungen, eine Klarheit zu
gewinnen, die viele Werke in ein besseres Licht riicken
ließ. und den Beschauer zu tieferem Yerständnis an-
leiten konnte.
Khmer-Bronze
etwa 12. Jahrhundert
Ausstellung
bei
L. Bernheimer, München
547