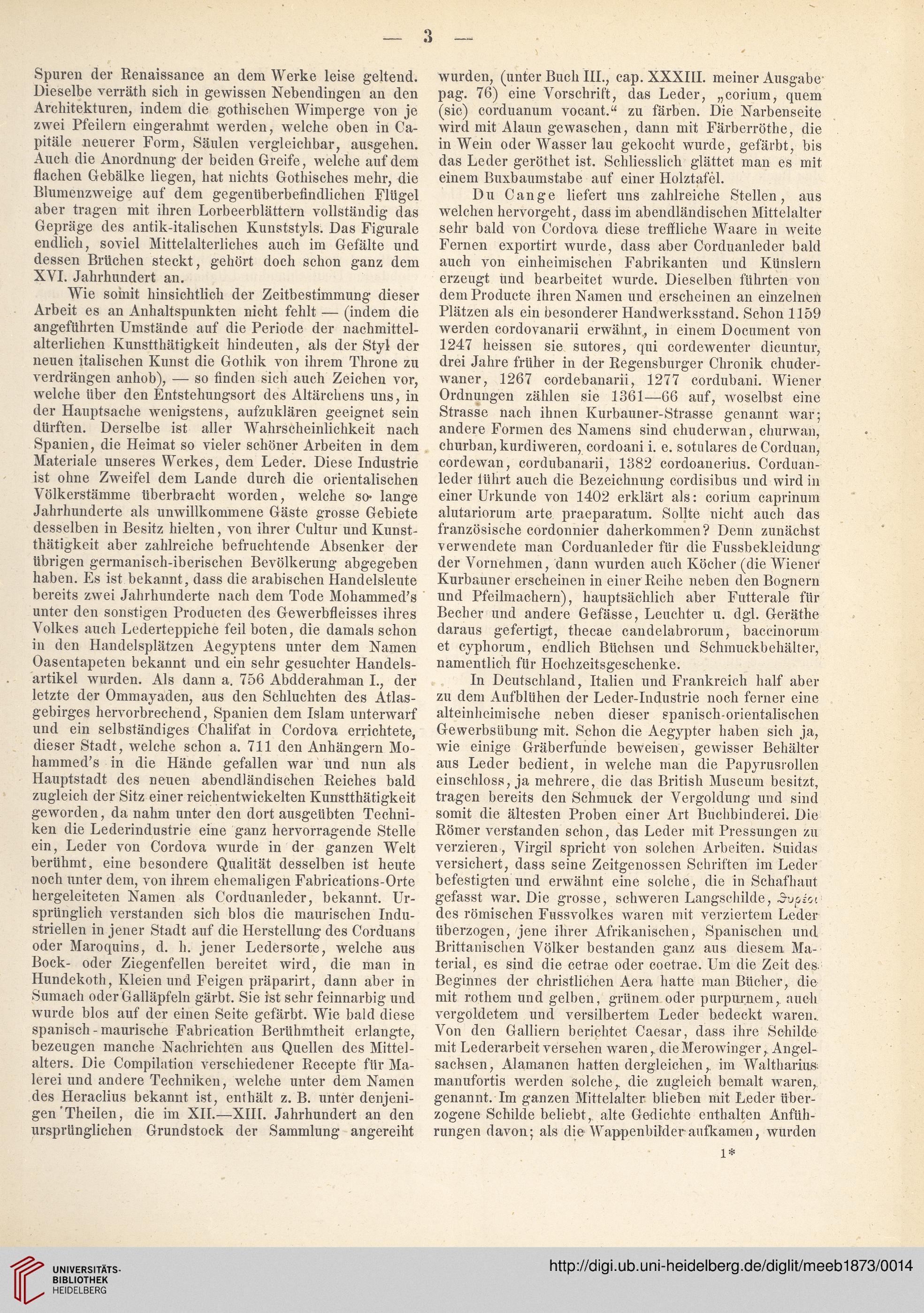3
Spuren der Renaissance an dem Werke leise geltend.
Dieselbe verräth sich in gewissen Nebendingen an den
Architekturen, indem die gothischen Wimperge von je
zwei Pfeilern eingerahmt werden, welche oben in Ca-
pitäle neuerer Form, Säulen vergleichbar, ausgehen.
Auch die Anordnung der beiden Greife, welche auf dem
flachen Gebälke liegen, hat nichts Gothisches mehr, die
Blumenzweige auf dem gegenüberbefindlichen Flügel
aber tragen mit ihren Lorbeerblättern vollständig das
Gepräge des antik-italischen Kunststyls. Das Figurale
endlich, soviel Mittelalterliches auch im Gefälte und
dessen Brüchen steckt, gehört doch schon ganz dem
XYI. Jahrhundert an.
Wie somit hinsichtlich der Zeitbestimmung dieser
Arbeit es an Anhaltspunkten nicht fehlt — (indem die
angeführten Umstände auf die Periode der nachmittel-
alterlichen Kunstthätigkeit hindeuten, als der Styl der
neuen italischen Kunst die Gothik von ihrem Throne zu
verdrängen anhob), — so finden sich auch Zeichen vor,
welche Uber den Entstehungsort des Altärchens uns, in
der Hauptsache wenigstens, aufzuklären geeignet sein
dürften. Derselbe ist aller Wahrscheinlichkeit nach
Spanien, die Heimat so vieler schöner Arbeiten in dem
Materiale unseres Werkes, dem Leder. Diese Industrie
ist ohne Zweifel dem Lande durch die orientalischen
Völkerstämme überbracht worden, welche so* lange
Jahrhunderte als unwillkommene Gäste grosse Gebiete
desselben in Besitz hielten, von ihrer Cultur und Kunst-
thätigkeit aber zahlreiche befruchtende Absenker der
übrigen germanisch-iberischen Bevölkerung abgegeben
haben. Es ist bekannt, dass die arabischen Handelsleute
bereits zwei Jahrhunderte nach dem Tode Mohammed’s
unter den sonstigen Producten des Gewerbfleisses ihres
Volkes auch Lederteppiche feil boten, die damals schon
in den Handelsplätzen Aegyptens unter dem Namen
Oasentapeten bekannt und ein sehr gesuchter Handels-
artikel wurden. Als dann a. 756 Abdderahman I., der
letzte der Ommayaden, aus den Schluchten des Atlas-
gebirges hervorbrechend, Spanien dem Islam unterwarf
und ein selbständiges Chalifat in Cordova errichtete,
dieser Stadt, welche schon a. 711 den Anhängern Mo-
hammed’s in die Hände gefallen war und nun als
Hauptstadt des neuen abendländischen Reiches bald
zugleich der Sitz einer reichentwickelten Kunstthätigkeit
geworden, da nahm unter den dort ausgeübten Techni-
ken die Lederindustrie eine ganz hervorragende Stelle
ein, Leder von Cordova wurde in der ganzen Welt
berühmt, eine besondere Qualität desselben ist heute
noch unter dem, von ihrem ehemaligen Fabrications-Orte
hergeleiteten Namen als Corduanleder, bekannt. Ur-
sprünglich verstanden sich blos die maurischen Indu-
striellen in jener Stadt auf die Herstellung des Corduans
oder Maroquins, d. h. jener Ledersorte, welche aus
Bock- oder Ziegenfellen bereitet wird, die man in
Hundekoth, Kleien und Feigen präparirt, dann aber in
Sumaeh oder Galläpfeln gärbt. Sie ist sehr feinnarbig und
wurde blos auf der einen Seite gefärbt. Wie bald diese
spanisch - maurische Fabrication Berühmtheit erlangte,
bezeugen manche Nachrichten aus Quellen des Mittel-
alters. Die Compilation verschiedener Recepte für Ma-
lerei und andere Techniken, welche unter dem Namen
des Heraclius bekannt ist, enthält z. B. unter denjeni-
gen Theilen, die im XII.—XIII. Jahrhundert an den
ursprünglichen Grundstock der Sammlung an gereiht
wurden, (unter Buch III., cap. XXXIII. meiner Ausgabe
pag. 76) eine Vorschrift, das Leder, „corium, quem
(sic) corduanum vocant.“ zu färben. Die Narbenseite
wird mit Alaun gewaschen, dann mit Färberröthe, die
in Wein oder Wasser lau gekocht wurde, gefärbt, bis
das Leder geröthet ist. Schliesslich glättet man es mit
einem Buxbaumstabe auf einer Holztafel.
Du Cange liefert uns zahlreiche Stellen, aus
welchen hervorgeht, dass im abendländischen Mittelalter
sehr bald von Cordova diese treffliche Waare in weite
Fernen exportirt wurde, dass aber Corduanleder bald
auch von einheimischen Fabrikanten und Kttnslern
erzeugt und bearbeitet wurde. Dieselben führten von
dem Producte ihren Namen und erscheinen an einzelnen
Plätzen als ein besonderer Handwerksstand. Schon 1159
werden cordovanarii erwähnt., in einem Document von
1247 heissen sie sutores, qui cordewenter dicuntur,
drei Jahre früher in der Regensburger Chronik chuder-
waner, 1267 cordebanarii, 1277 cordubani. Wiener
Ordnungen zählen sie 1361—66 auf, woselbst eine
Strasse nach ihnen Kurbauner-Strasse genannt war;
andere Formen des Namens sind chuderwan, churwan,
churban, kurdiweren, cordoani i. e. sotulares de Corduan,
cordewan, eordubanarii, 1382 eordoanerius. Corduan-
leder lührt auch die Bezeichnung cordisibus und wird in
einer Urkunde von 1402 erklärt als: corium caprinum
alutariorum arte praeparatum. Sollte nicht auch das
französische cordonnier daherkommen? Denn zunächst
verwendete man Corduanleder für die Fussbekleidung
der Vornehmen, dann wurden auch Köcher (die Wiener
Kurbauner erscheinen in einer Reihe neben den Bognern
und Pfeilmachern), hauptsächlich aber Futterale für
Becher und andere Gefässe, Leuchter u. dgl. Geräthe
daraus gefertigt, thecae candelabrorum, baccinorum
et cyphorum, endlich Büchsen und Schmuckbehälter,
namentlich für Hochzeitsgeschenke.
In Deutschland, Italien und Frankreich half aber
zu dem Aufblühen der Leder-Industrie noch ferner eine
alteinlieimische neben dieser spanisch-orientalischen
Gewerbsübung mit. Schon die Aegypter haben sich ja,
wie einige Gräberfunde beweisen, gewisser Behälter
aus Leder bedient, in welche man die Papyrusrollen
einschloss, ja mehrere, die das British Museum besitzt,
tragen bereits den Schmuck der Vergoldung und sind
somit die ältesten Proben einer Art Buchbinderei. Die
Römer verstanden schon, das Leder mit Pressungen zu
verzieren , Virgil spricht von solchen Arbeiten. Suidas
versichert, dass seine Zeitgenossen Schriften im Leder
befestigten und erwähnt eine solche, die in Schafhaut
gefasst war. Die grosse, schweren Langschilde,
des römischen Fussvolkes waren mit verziertem Leder
überzogen, jene ihrer Afrikanischen, Spanischen und
Brittanischen Völker bestanden ganz aus diesem Ma-
terial, es sind die cetrae oder coetrae. Um die Zeit des.
Beginnes der christlichen Aera hatte man Bücher, die
mit rothem und gelben, grünem oder purpurnem, auch
vergoldetem und versilbertem Leder bedeckt waren..
Von den Galliern berichtet Caesar, dass ihre Schilde
mit Lederarbeit versehen warendie Merowinger, Angel-
sachsen, Alamanen hatten dergleichen,, im Waltharius.
manufortis werden solche, die zugleich bemalt waren,
genannt. Im ganzen Mittelalter blieben mit Leder über-
zogene Schilde beliebt, alte Gedichte enthalten Anfüh-
rungen davon; als die Wappenbilder aufkamen, wurden
l*
Spuren der Renaissance an dem Werke leise geltend.
Dieselbe verräth sich in gewissen Nebendingen an den
Architekturen, indem die gothischen Wimperge von je
zwei Pfeilern eingerahmt werden, welche oben in Ca-
pitäle neuerer Form, Säulen vergleichbar, ausgehen.
Auch die Anordnung der beiden Greife, welche auf dem
flachen Gebälke liegen, hat nichts Gothisches mehr, die
Blumenzweige auf dem gegenüberbefindlichen Flügel
aber tragen mit ihren Lorbeerblättern vollständig das
Gepräge des antik-italischen Kunststyls. Das Figurale
endlich, soviel Mittelalterliches auch im Gefälte und
dessen Brüchen steckt, gehört doch schon ganz dem
XYI. Jahrhundert an.
Wie somit hinsichtlich der Zeitbestimmung dieser
Arbeit es an Anhaltspunkten nicht fehlt — (indem die
angeführten Umstände auf die Periode der nachmittel-
alterlichen Kunstthätigkeit hindeuten, als der Styl der
neuen italischen Kunst die Gothik von ihrem Throne zu
verdrängen anhob), — so finden sich auch Zeichen vor,
welche Uber den Entstehungsort des Altärchens uns, in
der Hauptsache wenigstens, aufzuklären geeignet sein
dürften. Derselbe ist aller Wahrscheinlichkeit nach
Spanien, die Heimat so vieler schöner Arbeiten in dem
Materiale unseres Werkes, dem Leder. Diese Industrie
ist ohne Zweifel dem Lande durch die orientalischen
Völkerstämme überbracht worden, welche so* lange
Jahrhunderte als unwillkommene Gäste grosse Gebiete
desselben in Besitz hielten, von ihrer Cultur und Kunst-
thätigkeit aber zahlreiche befruchtende Absenker der
übrigen germanisch-iberischen Bevölkerung abgegeben
haben. Es ist bekannt, dass die arabischen Handelsleute
bereits zwei Jahrhunderte nach dem Tode Mohammed’s
unter den sonstigen Producten des Gewerbfleisses ihres
Volkes auch Lederteppiche feil boten, die damals schon
in den Handelsplätzen Aegyptens unter dem Namen
Oasentapeten bekannt und ein sehr gesuchter Handels-
artikel wurden. Als dann a. 756 Abdderahman I., der
letzte der Ommayaden, aus den Schluchten des Atlas-
gebirges hervorbrechend, Spanien dem Islam unterwarf
und ein selbständiges Chalifat in Cordova errichtete,
dieser Stadt, welche schon a. 711 den Anhängern Mo-
hammed’s in die Hände gefallen war und nun als
Hauptstadt des neuen abendländischen Reiches bald
zugleich der Sitz einer reichentwickelten Kunstthätigkeit
geworden, da nahm unter den dort ausgeübten Techni-
ken die Lederindustrie eine ganz hervorragende Stelle
ein, Leder von Cordova wurde in der ganzen Welt
berühmt, eine besondere Qualität desselben ist heute
noch unter dem, von ihrem ehemaligen Fabrications-Orte
hergeleiteten Namen als Corduanleder, bekannt. Ur-
sprünglich verstanden sich blos die maurischen Indu-
striellen in jener Stadt auf die Herstellung des Corduans
oder Maroquins, d. h. jener Ledersorte, welche aus
Bock- oder Ziegenfellen bereitet wird, die man in
Hundekoth, Kleien und Feigen präparirt, dann aber in
Sumaeh oder Galläpfeln gärbt. Sie ist sehr feinnarbig und
wurde blos auf der einen Seite gefärbt. Wie bald diese
spanisch - maurische Fabrication Berühmtheit erlangte,
bezeugen manche Nachrichten aus Quellen des Mittel-
alters. Die Compilation verschiedener Recepte für Ma-
lerei und andere Techniken, welche unter dem Namen
des Heraclius bekannt ist, enthält z. B. unter denjeni-
gen Theilen, die im XII.—XIII. Jahrhundert an den
ursprünglichen Grundstock der Sammlung an gereiht
wurden, (unter Buch III., cap. XXXIII. meiner Ausgabe
pag. 76) eine Vorschrift, das Leder, „corium, quem
(sic) corduanum vocant.“ zu färben. Die Narbenseite
wird mit Alaun gewaschen, dann mit Färberröthe, die
in Wein oder Wasser lau gekocht wurde, gefärbt, bis
das Leder geröthet ist. Schliesslich glättet man es mit
einem Buxbaumstabe auf einer Holztafel.
Du Cange liefert uns zahlreiche Stellen, aus
welchen hervorgeht, dass im abendländischen Mittelalter
sehr bald von Cordova diese treffliche Waare in weite
Fernen exportirt wurde, dass aber Corduanleder bald
auch von einheimischen Fabrikanten und Kttnslern
erzeugt und bearbeitet wurde. Dieselben führten von
dem Producte ihren Namen und erscheinen an einzelnen
Plätzen als ein besonderer Handwerksstand. Schon 1159
werden cordovanarii erwähnt., in einem Document von
1247 heissen sie sutores, qui cordewenter dicuntur,
drei Jahre früher in der Regensburger Chronik chuder-
waner, 1267 cordebanarii, 1277 cordubani. Wiener
Ordnungen zählen sie 1361—66 auf, woselbst eine
Strasse nach ihnen Kurbauner-Strasse genannt war;
andere Formen des Namens sind chuderwan, churwan,
churban, kurdiweren, cordoani i. e. sotulares de Corduan,
cordewan, eordubanarii, 1382 eordoanerius. Corduan-
leder lührt auch die Bezeichnung cordisibus und wird in
einer Urkunde von 1402 erklärt als: corium caprinum
alutariorum arte praeparatum. Sollte nicht auch das
französische cordonnier daherkommen? Denn zunächst
verwendete man Corduanleder für die Fussbekleidung
der Vornehmen, dann wurden auch Köcher (die Wiener
Kurbauner erscheinen in einer Reihe neben den Bognern
und Pfeilmachern), hauptsächlich aber Futterale für
Becher und andere Gefässe, Leuchter u. dgl. Geräthe
daraus gefertigt, thecae candelabrorum, baccinorum
et cyphorum, endlich Büchsen und Schmuckbehälter,
namentlich für Hochzeitsgeschenke.
In Deutschland, Italien und Frankreich half aber
zu dem Aufblühen der Leder-Industrie noch ferner eine
alteinlieimische neben dieser spanisch-orientalischen
Gewerbsübung mit. Schon die Aegypter haben sich ja,
wie einige Gräberfunde beweisen, gewisser Behälter
aus Leder bedient, in welche man die Papyrusrollen
einschloss, ja mehrere, die das British Museum besitzt,
tragen bereits den Schmuck der Vergoldung und sind
somit die ältesten Proben einer Art Buchbinderei. Die
Römer verstanden schon, das Leder mit Pressungen zu
verzieren , Virgil spricht von solchen Arbeiten. Suidas
versichert, dass seine Zeitgenossen Schriften im Leder
befestigten und erwähnt eine solche, die in Schafhaut
gefasst war. Die grosse, schweren Langschilde,
des römischen Fussvolkes waren mit verziertem Leder
überzogen, jene ihrer Afrikanischen, Spanischen und
Brittanischen Völker bestanden ganz aus diesem Ma-
terial, es sind die cetrae oder coetrae. Um die Zeit des.
Beginnes der christlichen Aera hatte man Bücher, die
mit rothem und gelben, grünem oder purpurnem, auch
vergoldetem und versilbertem Leder bedeckt waren..
Von den Galliern berichtet Caesar, dass ihre Schilde
mit Lederarbeit versehen warendie Merowinger, Angel-
sachsen, Alamanen hatten dergleichen,, im Waltharius.
manufortis werden solche, die zugleich bemalt waren,
genannt. Im ganzen Mittelalter blieben mit Leder über-
zogene Schilde beliebt, alte Gedichte enthalten Anfüh-
rungen davon; als die Wappenbilder aufkamen, wurden
l*