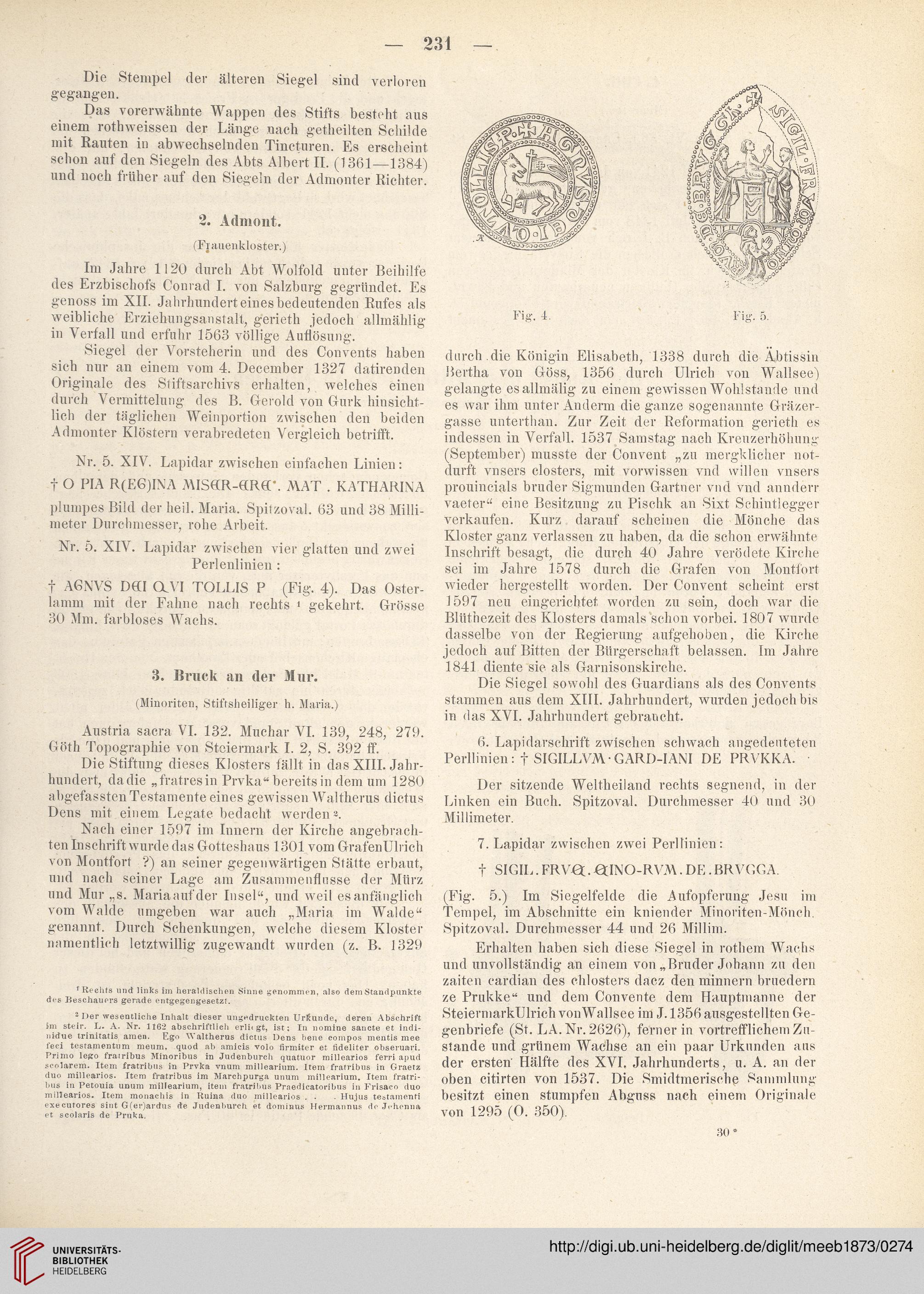231
Die Stempel der älteren Siegel sind verloren
gegangen.
Das vorerwähnte Wappen des Stifts besteht aus
einem rothweissen der Länge nach getheilten Schilde
mit Rauten in abwechselnden Tincturen. Es erscheint
schon auf den Siegeln des Abts Albert II. (1361—1384)
und noch trüber auf den Siegeln der Admonter Richter.
2. Admont.
(Frauenkloster.)
Im Jahre 1120 durch Abt Wolfold unter Beihilfe
des Erzbischofs Conrad I. von Salzburg gegründet. Es
genoss im XII. Jahrhundert eines bedeutenden Rufes als
weibliche Erziehungsanstalt, gerieth jedoch allmählig
in Verfall und erfuhr 1563 völlige Auflösung.
Siegel der Vorsteherin und des Convents haben
sich nur an einem vom 4. December 1327 datirenden
Originale des Stiftsarchivs erhalten, welches einen
durch Vermittelung des B. Gerold von Gurk hinsicht-
lich der täglichen Weinportion zwischen den beiden
Admonter Klöstern verabredeten Vergleich betrifft.
Nr. 5. XIV. Lapidar zwischen einfachen Linien:
t O PIA R(EG)INA MISHR-SRH*. MAT . KATHARINA
plumpes Bild der heil. Maria. Spitzoval. 63 und 38 Milli-
meter Durchmesser, rohe Arbeit.
Nr. 5. XIV. Lapidar zwischen vier glatten und zwei
Perlenlinien :
f AGNVS DGI (XVI TOLLIS P (Fig. 4). Das Oster-
lamm mit der Fahne nach rechts 1 gekehrt. Grösse
30 Mm. farbloses Wachs.
3. Bruck an der Mur.
(Minoriten, Stiftsheiliger h. Maria.)
Austria sacra VI. 132. Muehar VI. 139, 248, 279.
Göth Topographie von Steiermark I. 2, S. 392 ff.
Die Stiftung dieses Klosters fällt in das XIII. Jahr-
hundert, da die „fratres in Prvka“ bereits in dem um 1280
abgefassten Testamente eines gewissen Waltherus dictus
Dens mit einem Legate bedacht werden a.
Nach einer 1597 im Innern der Kirche angebrach-
ten Inschrift wurde das Gotteshaus 1301 vom GrafenUlrich
von Montfort '?) an seiner gegenwärtigen Stätte erbaut,
und nach seiner Lage am Zusammenflüsse der Mürz
und Mur „s. Mariaaufder Insel“, und weil es anfänglich
vom Walde umgeben war auch „Maria im Walde“
genannt. Durch Schenkungen, welche diesem Kloster
namentlich letztwillig zugewandt wurden (z. B. 1329
r Rechts lind links im heraldischen Sinne genommen, also dem Standpunkte
des Beschauers gerade entgegengesetzt.
2 I)er wesentliche Inhalt dieser ungedruckten Urkunde, deren Abschrift
im steir. L. A. Nr. 1162 abschriftlich erlügt, ist; In nomine sancte et indi-
nidue trinitatis amen. Ego Waltherus dictus Dens bene compos mentis mee
feci testamentnm meum, quod ab amicis volo firmiter et fideliter obseruari.
T’rimo lego frairibus Minoribus in Judenburch quatuor millearios ferri apud
scolarem. Item fratribus in Prvka vnum millearium. Item fratribus in Graetz
duo millearios. Item fratribus im Marchpurga unum millearium. Item fratri-
bus in Petouia unum millearium, item fratribus Praedicatoribus in Frisaco duo
millearios. Item monachis in Ruina duo millearios . . . Hujus teatamenti
executores sint G(er)ardus de Judenburch et dominus Hermannus de Jehenna
et scolaris de Pruka.
Fig. 4. Fig. 5.
durch die Königin Elisabeth, 1338 durch die Abtissin
Bertha von Göss, 1356 durch Ulrich von Wallsee)
gelangte esallmälig zu einem gewissen Wohlstände und
es war ihm unter Andern die ganze sogenannte Gräzer-
gasse unterthan. Zur Zeit der Reformation gerieth es
indessen in Verfall. 1537 Samstag nach Kreuzerhöhung
(September) musste der Convent „zu mergklieber not-
durft vnsers closters, mit vorwissen vnd willen vnsers
prouincials bruder Sigmunden Gärtner vnd vnd annderr
vaeter“ eine Besitzung zu Pischk an Sixt Schintlegger
verkaufen. Kurz darauf scheinen die Mönche das
Kloster ganz verlassen zu haben, da die schon erwähnte
Inschrift besagt, die durch 40 Jahre verödete Kirche
sei im Jahre 1578 durch die Grafen von Montfort
wieder hergestellt worden. Der Convent scheint erst
1597 neu eingerichtet worden zu sein, doch war die
Blüt’nezeit des Klosters damals schon vorbei. 1807 wurde
dasselbe von der Regierung aufgehoben, die Kirche
jedoch auf Bitten der Bürgerschaft belassen. Im Jahre
1841 diente sie als Garnisonskirche.
Die Siegel sowohl des Guardians als des Convents
stammen aus dem XIII. Jahrhundert, wurden jedoch bis
in das XVI. Jahrhundert gebraucht.
6. Lapidarschrift zwischen schwach angedeuteten
Perllinien: f SIGILLVM• GARD-IANI DE PRVKKA.
Der sitzende Weltheiland rechts segnend, in der
Linken ein Buch. Spitzoval. Durchmesser 40 und 30
Millimeter.
7. Lapidar zwischen zwei Perllinien:
t SIGIL.FRVLJ.aiNO-RVM.DE.BRVGGA.
(Fig. 5.) Im Siegelfelde die Aufopferung Jesu im
Tempel, im Abschnitte ein kniender Minoriten-Mönch.
Spitzoval. Durchmesser 44 und 26 Millim.
Erhalten haben sich diese Siegel in rothem Wachs
undunvollständig an einem von „Bruder Johann zu den
zaiten cardian des chlosters dacz den minnern bruedern
ze Prukke“ und dem Convente dem Hauptmanne der
SteiermarkUlrich vonWallsee im J. 1356 ausgestellten Ge-
genbriefe (St. LA. Nr. 2626), ferner in vortrefflichem Zu-
stande und grünem Wachse an ein paar Urkunden aus
der ersten' Hälfte des XVI. Jahrhunderts, u. A. an der
oben citirten von 1537. Die Smidtmerische Sammlung
besitzt einen stumpfen Abguss nach einem Originale
von 1295 (0. 350).
309
Die Stempel der älteren Siegel sind verloren
gegangen.
Das vorerwähnte Wappen des Stifts besteht aus
einem rothweissen der Länge nach getheilten Schilde
mit Rauten in abwechselnden Tincturen. Es erscheint
schon auf den Siegeln des Abts Albert II. (1361—1384)
und noch trüber auf den Siegeln der Admonter Richter.
2. Admont.
(Frauenkloster.)
Im Jahre 1120 durch Abt Wolfold unter Beihilfe
des Erzbischofs Conrad I. von Salzburg gegründet. Es
genoss im XII. Jahrhundert eines bedeutenden Rufes als
weibliche Erziehungsanstalt, gerieth jedoch allmählig
in Verfall und erfuhr 1563 völlige Auflösung.
Siegel der Vorsteherin und des Convents haben
sich nur an einem vom 4. December 1327 datirenden
Originale des Stiftsarchivs erhalten, welches einen
durch Vermittelung des B. Gerold von Gurk hinsicht-
lich der täglichen Weinportion zwischen den beiden
Admonter Klöstern verabredeten Vergleich betrifft.
Nr. 5. XIV. Lapidar zwischen einfachen Linien:
t O PIA R(EG)INA MISHR-SRH*. MAT . KATHARINA
plumpes Bild der heil. Maria. Spitzoval. 63 und 38 Milli-
meter Durchmesser, rohe Arbeit.
Nr. 5. XIV. Lapidar zwischen vier glatten und zwei
Perlenlinien :
f AGNVS DGI (XVI TOLLIS P (Fig. 4). Das Oster-
lamm mit der Fahne nach rechts 1 gekehrt. Grösse
30 Mm. farbloses Wachs.
3. Bruck an der Mur.
(Minoriten, Stiftsheiliger h. Maria.)
Austria sacra VI. 132. Muehar VI. 139, 248, 279.
Göth Topographie von Steiermark I. 2, S. 392 ff.
Die Stiftung dieses Klosters fällt in das XIII. Jahr-
hundert, da die „fratres in Prvka“ bereits in dem um 1280
abgefassten Testamente eines gewissen Waltherus dictus
Dens mit einem Legate bedacht werden a.
Nach einer 1597 im Innern der Kirche angebrach-
ten Inschrift wurde das Gotteshaus 1301 vom GrafenUlrich
von Montfort '?) an seiner gegenwärtigen Stätte erbaut,
und nach seiner Lage am Zusammenflüsse der Mürz
und Mur „s. Mariaaufder Insel“, und weil es anfänglich
vom Walde umgeben war auch „Maria im Walde“
genannt. Durch Schenkungen, welche diesem Kloster
namentlich letztwillig zugewandt wurden (z. B. 1329
r Rechts lind links im heraldischen Sinne genommen, also dem Standpunkte
des Beschauers gerade entgegengesetzt.
2 I)er wesentliche Inhalt dieser ungedruckten Urkunde, deren Abschrift
im steir. L. A. Nr. 1162 abschriftlich erlügt, ist; In nomine sancte et indi-
nidue trinitatis amen. Ego Waltherus dictus Dens bene compos mentis mee
feci testamentnm meum, quod ab amicis volo firmiter et fideliter obseruari.
T’rimo lego frairibus Minoribus in Judenburch quatuor millearios ferri apud
scolarem. Item fratribus in Prvka vnum millearium. Item fratribus in Graetz
duo millearios. Item fratribus im Marchpurga unum millearium. Item fratri-
bus in Petouia unum millearium, item fratribus Praedicatoribus in Frisaco duo
millearios. Item monachis in Ruina duo millearios . . . Hujus teatamenti
executores sint G(er)ardus de Judenburch et dominus Hermannus de Jehenna
et scolaris de Pruka.
Fig. 4. Fig. 5.
durch die Königin Elisabeth, 1338 durch die Abtissin
Bertha von Göss, 1356 durch Ulrich von Wallsee)
gelangte esallmälig zu einem gewissen Wohlstände und
es war ihm unter Andern die ganze sogenannte Gräzer-
gasse unterthan. Zur Zeit der Reformation gerieth es
indessen in Verfall. 1537 Samstag nach Kreuzerhöhung
(September) musste der Convent „zu mergklieber not-
durft vnsers closters, mit vorwissen vnd willen vnsers
prouincials bruder Sigmunden Gärtner vnd vnd annderr
vaeter“ eine Besitzung zu Pischk an Sixt Schintlegger
verkaufen. Kurz darauf scheinen die Mönche das
Kloster ganz verlassen zu haben, da die schon erwähnte
Inschrift besagt, die durch 40 Jahre verödete Kirche
sei im Jahre 1578 durch die Grafen von Montfort
wieder hergestellt worden. Der Convent scheint erst
1597 neu eingerichtet worden zu sein, doch war die
Blüt’nezeit des Klosters damals schon vorbei. 1807 wurde
dasselbe von der Regierung aufgehoben, die Kirche
jedoch auf Bitten der Bürgerschaft belassen. Im Jahre
1841 diente sie als Garnisonskirche.
Die Siegel sowohl des Guardians als des Convents
stammen aus dem XIII. Jahrhundert, wurden jedoch bis
in das XVI. Jahrhundert gebraucht.
6. Lapidarschrift zwischen schwach angedeuteten
Perllinien: f SIGILLVM• GARD-IANI DE PRVKKA.
Der sitzende Weltheiland rechts segnend, in der
Linken ein Buch. Spitzoval. Durchmesser 40 und 30
Millimeter.
7. Lapidar zwischen zwei Perllinien:
t SIGIL.FRVLJ.aiNO-RVM.DE.BRVGGA.
(Fig. 5.) Im Siegelfelde die Aufopferung Jesu im
Tempel, im Abschnitte ein kniender Minoriten-Mönch.
Spitzoval. Durchmesser 44 und 26 Millim.
Erhalten haben sich diese Siegel in rothem Wachs
undunvollständig an einem von „Bruder Johann zu den
zaiten cardian des chlosters dacz den minnern bruedern
ze Prukke“ und dem Convente dem Hauptmanne der
SteiermarkUlrich vonWallsee im J. 1356 ausgestellten Ge-
genbriefe (St. LA. Nr. 2626), ferner in vortrefflichem Zu-
stande und grünem Wachse an ein paar Urkunden aus
der ersten' Hälfte des XVI. Jahrhunderts, u. A. an der
oben citirten von 1537. Die Smidtmerische Sammlung
besitzt einen stumpfen Abguss nach einem Originale
von 1295 (0. 350).
309