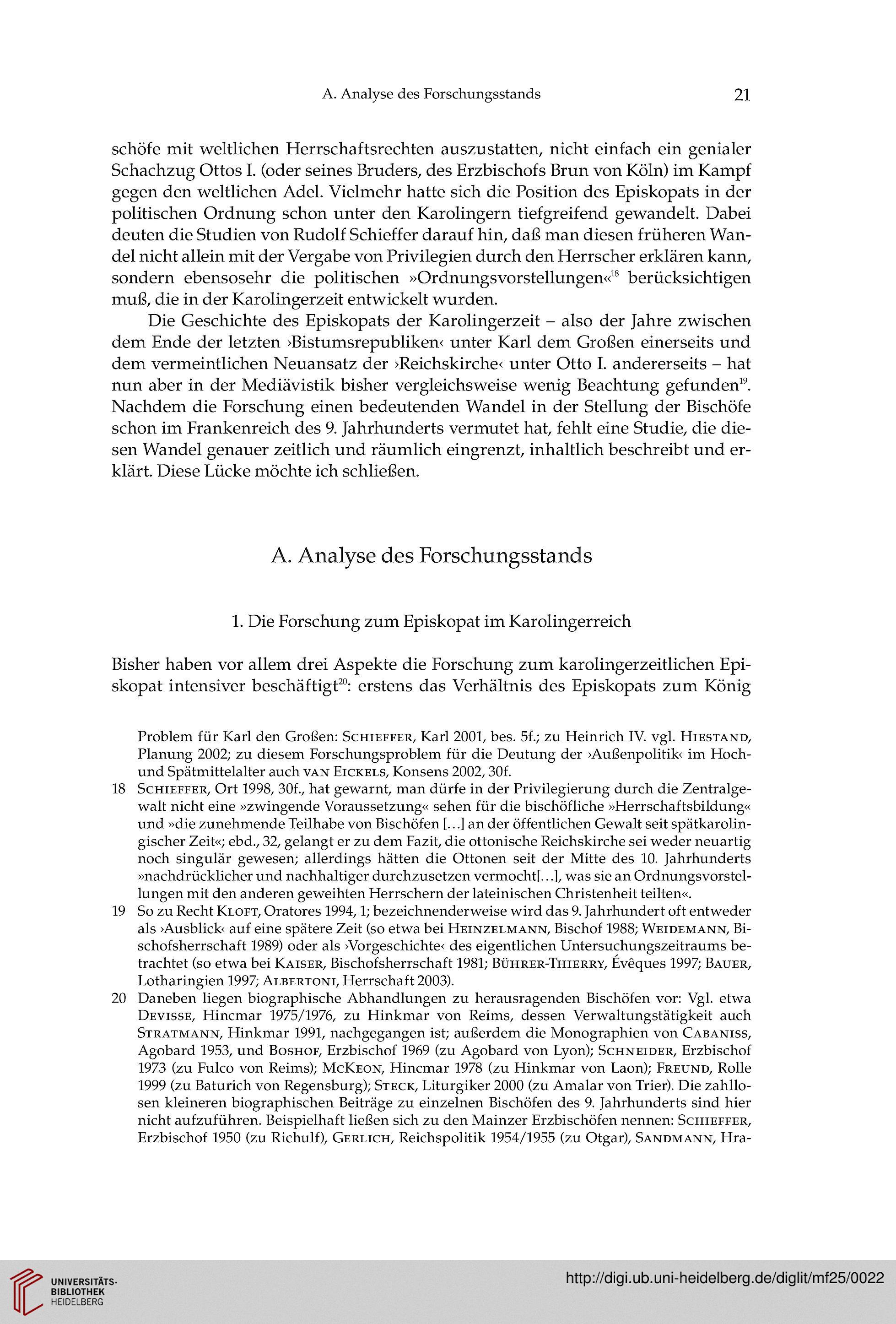A. Analyse des Forschungsstands
21
schöfe mit weltlichen Herrschaftsrechten auszustatten, nicht einfach ein genialer
Schachzug Ottos I. (oder seines Bruders, des Erzbischofs Brun von Köln) im Kampf
gegen den weltlichen Adel. Vielmehr hatte sich die Position des Episkopats in der
politischen Ordnung schon unter den Karolingern tiefgreifend gewandelt. Dabei
deuten die Studien von Rudolf Schieffer darauf hin, daß man diesen früheren Wan-
del nicht allein mit der Vergabe von Privilegien durch den Herrscher erklären kann,
sondern ebensosehr die politischen »Ordnungsvorstellungen«^ berücksichtigen
muß, die in der Karolingerzeit entwickelt wurden.
Die Geschichte des Episkopats der Karolingerzeit - also der Jahre zwischen
dem Ende der letzten >Bistumsrepubliken< unter Karl dem Großen einerseits und
dem vermeintlichen Neuansatz der >Reichskirche< unter Otto I. andererseits - hat
nun aber in der Mediävistik bisher vergleichsweise wenig Beachtung gefunden^.
Nachdem die Forschung einen bedeutenden Wandel in der Stellung der Bischöfe
schon im Frankenreich des 9. Jahrhunderts vermutet hat, fehlt eine Studie, die die-
sen Wandel genauer zeitlich und räumlich eingrenzt, inhaltlich beschreibt und er-
klärt. Diese Lücke möchte ich schließen.
A. Analyse des Forschungsstands
1. Die Forschung zum Episkopat im Karolingerreich
Bisher haben vor allem drei Aspekte die Forschung zum karolingerzeitlichen Epi-
skopat intensiver beschäftigt'": erstens das Verhältnis des Episkopats zum König
Problem für Karl den Großen: ScniEFFER, Karl 2001, bes. 51.; zu Heinrich IV. vgl. HiESTAND,
Planung 2002; zu diesem Forschungsproblem lür die Deutung der Außenpolitik im Hoch-
und Spätmittelalter auch VAN EicKELS, Konsens 2002,30f.
18 ScHiEFFER, Ort 1998, 30f., hat gewarnt, man dürfe in der Privilegierung durch die Zentralge-
walt nicht eine »zwingende Voraussetzung« sehen für die bischöfliche »Herrschaftsbildung«
und »die zunehmende Teilhabe von Bischöfen [...] an der öffentlichen Gewalt seit spätkarolin-
gischer Zeit«; ebd., 32, gelangt er zu dem Fazit, die ottonische Reichskirche sei weder neuartig
noch singulär gewesen; allerdings hätten die Ottonen seit der Mitte des 10. Jahrhunderts
»nachdrücklicher und nachhaltiger durchzusetzen vermochte..], was sie an Ordnungsvorstel-
lungen mit den anderen geweihten Herrschern der lateinischen Christenheit teilten«.
19 So zu Recht KLOFT, Oratores 1994,1; bezeichnenderweise wird das 9. Jahrhundert oft entweder
als Ausblick auf eine spätere Zeit (so etwa bei HEiNZELMANN, Bischof 1988; WEIDEMANN, Bi-
schofsherrschaft 1989) oder als >Vorgeschichte< des eigentlichen Untersuchungszeitraums be-
trachtet (so etwa bei KAISER, Bischofsherrschaft 1981; BÜHRER-THiERRY, Eveques 1997; BAUER,
Lotharingien 1997; ALBERTONi, Herrschaft 2003).
20 Daneben liegen biographische Abhandlungen zu herausragenden Bischöfen vor: Vgl. etwa
DEVissE, Hincmar 1975/1976, zu Hinkmar von Reims, dessen Verwaltungstätigkeit auch
SiRATMANN, Hinkmar 1991, nachgegangen ist; außerdem die Monographien von CABANiss,
Agobard 1953, und BosHOF, Erzbischof 1969 (zu Agobard von Lyon); SCHNEIDER, Erzbischof
1973 (zu Fulco von Reims); McKEON, Hincmar 1978 (zu Hinkmar von Laon); FREUND, Rolle
1999 (zu Baturich von Regensburg); STECK, Liturgiker 2000 (zu Amalar von Trier). Die zahllo-
sen kleineren biographischen Beiträge zu einzelnen Bischöfen des 9. Jahrhunderts sind hier
nicht aufzuführen. Beispielhaft ließen sich zu den Mainzer Erzbischöfen nennen: SCHIEFFER,
Erzbischof 1950 (zu Richulf), GERLicH, Reichspolitik 1954/1955 (zu Otgar), SANDMANN, Hra-
21
schöfe mit weltlichen Herrschaftsrechten auszustatten, nicht einfach ein genialer
Schachzug Ottos I. (oder seines Bruders, des Erzbischofs Brun von Köln) im Kampf
gegen den weltlichen Adel. Vielmehr hatte sich die Position des Episkopats in der
politischen Ordnung schon unter den Karolingern tiefgreifend gewandelt. Dabei
deuten die Studien von Rudolf Schieffer darauf hin, daß man diesen früheren Wan-
del nicht allein mit der Vergabe von Privilegien durch den Herrscher erklären kann,
sondern ebensosehr die politischen »Ordnungsvorstellungen«^ berücksichtigen
muß, die in der Karolingerzeit entwickelt wurden.
Die Geschichte des Episkopats der Karolingerzeit - also der Jahre zwischen
dem Ende der letzten >Bistumsrepubliken< unter Karl dem Großen einerseits und
dem vermeintlichen Neuansatz der >Reichskirche< unter Otto I. andererseits - hat
nun aber in der Mediävistik bisher vergleichsweise wenig Beachtung gefunden^.
Nachdem die Forschung einen bedeutenden Wandel in der Stellung der Bischöfe
schon im Frankenreich des 9. Jahrhunderts vermutet hat, fehlt eine Studie, die die-
sen Wandel genauer zeitlich und räumlich eingrenzt, inhaltlich beschreibt und er-
klärt. Diese Lücke möchte ich schließen.
A. Analyse des Forschungsstands
1. Die Forschung zum Episkopat im Karolingerreich
Bisher haben vor allem drei Aspekte die Forschung zum karolingerzeitlichen Epi-
skopat intensiver beschäftigt'": erstens das Verhältnis des Episkopats zum König
Problem für Karl den Großen: ScniEFFER, Karl 2001, bes. 51.; zu Heinrich IV. vgl. HiESTAND,
Planung 2002; zu diesem Forschungsproblem lür die Deutung der Außenpolitik im Hoch-
und Spätmittelalter auch VAN EicKELS, Konsens 2002,30f.
18 ScHiEFFER, Ort 1998, 30f., hat gewarnt, man dürfe in der Privilegierung durch die Zentralge-
walt nicht eine »zwingende Voraussetzung« sehen für die bischöfliche »Herrschaftsbildung«
und »die zunehmende Teilhabe von Bischöfen [...] an der öffentlichen Gewalt seit spätkarolin-
gischer Zeit«; ebd., 32, gelangt er zu dem Fazit, die ottonische Reichskirche sei weder neuartig
noch singulär gewesen; allerdings hätten die Ottonen seit der Mitte des 10. Jahrhunderts
»nachdrücklicher und nachhaltiger durchzusetzen vermochte..], was sie an Ordnungsvorstel-
lungen mit den anderen geweihten Herrschern der lateinischen Christenheit teilten«.
19 So zu Recht KLOFT, Oratores 1994,1; bezeichnenderweise wird das 9. Jahrhundert oft entweder
als Ausblick auf eine spätere Zeit (so etwa bei HEiNZELMANN, Bischof 1988; WEIDEMANN, Bi-
schofsherrschaft 1989) oder als >Vorgeschichte< des eigentlichen Untersuchungszeitraums be-
trachtet (so etwa bei KAISER, Bischofsherrschaft 1981; BÜHRER-THiERRY, Eveques 1997; BAUER,
Lotharingien 1997; ALBERTONi, Herrschaft 2003).
20 Daneben liegen biographische Abhandlungen zu herausragenden Bischöfen vor: Vgl. etwa
DEVissE, Hincmar 1975/1976, zu Hinkmar von Reims, dessen Verwaltungstätigkeit auch
SiRATMANN, Hinkmar 1991, nachgegangen ist; außerdem die Monographien von CABANiss,
Agobard 1953, und BosHOF, Erzbischof 1969 (zu Agobard von Lyon); SCHNEIDER, Erzbischof
1973 (zu Fulco von Reims); McKEON, Hincmar 1978 (zu Hinkmar von Laon); FREUND, Rolle
1999 (zu Baturich von Regensburg); STECK, Liturgiker 2000 (zu Amalar von Trier). Die zahllo-
sen kleineren biographischen Beiträge zu einzelnen Bischöfen des 9. Jahrhunderts sind hier
nicht aufzuführen. Beispielhaft ließen sich zu den Mainzer Erzbischöfen nennen: SCHIEFFER,
Erzbischof 1950 (zu Richulf), GERLicH, Reichspolitik 1954/1955 (zu Otgar), SANDMANN, Hra-