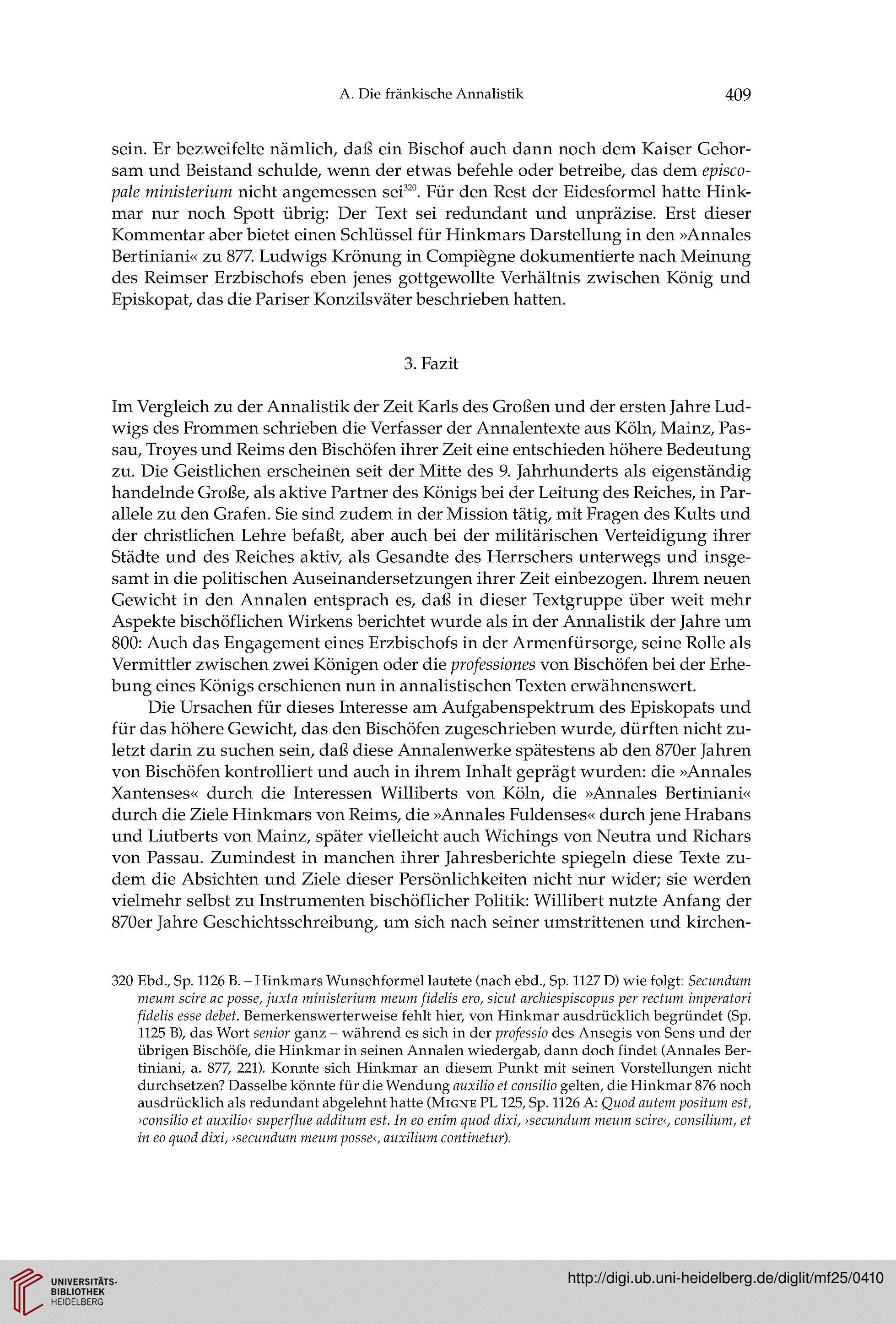A. Die fränkische Annalistik
409
sein. Er bezweifelte nämlich, daß ein Bischof auch dann noch dem Kaiser Gehor-
sam und Beistand schulde, wenn der etwas befehle oder betreibe, das dem cpz'sco-
palc wän'sfcriMW nicht angemessen seW. Für den Rest der Eidesformel hatte Hink-
mar nur noch Spott übrig: Der Text sei redundant und unpräzise. Erst dieser
Kommentar aber bietet einen Schlüssel für Hinkmars Darstellung in den »Annales
Bertiniani« zu 877. Ludwigs Krönung in Compiegne dokumentierte nach Meinung
des Reimser Erzbischofs eben jenes gottgewollte Verhältnis zwischen König und
Episkopat, das die Pariser Konzilsväter beschrieben hatten.
3. Fazit
Im Vergleich zu der Annalistik der Zeit Karls des Großen und der ersten Jahre Lud-
wigs des Frommen schrieben die Verfasser der Annalentexte aus Köln, Mainz, Pas-
sau, Troyes und Reims den Bischöfen ihrer Zeit eine entschieden höhere Bedeutung
zu. Die Geistlichen erscheinen seit der Mitte des 9. Jahrhunderts als eigenständig
handelnde Große, als aktive Partner des Königs bei der Leitung des Reiches, in Par-
allele zu den Grafen. Sie sind zudem in der Mission tätig, mit Fragen des Kults und
der christlichen Lehre befaßt, aber auch bei der militärischen Verteidigung ihrer
Städte und des Reiches aktiv, als Gesandte des Herrschers unterwegs und insge-
samt in die politischen Auseinandersetzungen ihrer Zeit einbezogen. Ihrem neuen
Gewicht in den Annalen entsprach es, daß in dieser Textgruppe über weit mehr
Aspekte bischöflichen Wirkens berichtet wurde als in der Annalistik der Jahre um
800: Auch das Engagement eines Erzbischofs in der Armenfürsorge, seine Rolle als
Vermittler zwischen zwei Königen oder die pro/cssioncs von Bischöfen bei der Erhe-
bung eines Königs erschienen nun in annalistischen Texten erwähnenswert.
Die Ursachen für dieses Interesse am Aufgabenspektrum des Episkopats und
für das höhere Gewicht, das den Bischöfen zugeschrieben wurde, dürften nicht zu-
letzt darin zu suchen sein, daß diese Annalenwerke spätestens ab den 870er Jahren
von Bischöfen kontrolliert und auch in ihrem Inhalt geprägt wurden: die »Annales
Xantenses« durch die Interessen Williberts von Köln, die »Annales Bertiniani«
durch die Ziele Hinkmars von Reims, die »Annales Fuldenses« durch jene Hrabans
und Liutberts von Mainz, später vielleicht auch Wichings von Neutra und Richars
von Passau. Zumindest in manchen ihrer Jahresberichte spiegeln diese Texte zu-
dem die Absichten und Ziele dieser Persönlichkeiten nicht nur wider; sie werden
vielmehr selbst zu Instrumenten bischöflicher Politik: Willibert nutzte Anfang der
870er Jahre Geschichtsschreibung, um sich nach seiner umstrittenen und kirchen-
320 Ebd., Sp. 1126 B. - Hinkmars Wunschformel lautete (nach ebd., Sp. 1127 D) wie folgt: SecunAnn
777eM777 sehe 77C pOSSe, JMXta 7777777Ster7M777 777CM77! /i&ÜS ero, S7CMt OrcMespisCOpMS per recfM77! 777!per77for7
Jtdeh's esse &&et. Bemerkenswerterweise fehlt hier, von Hinkmar ausdrücklich begründet (Sp.
1125 B), das Wort se777'or ganz - während es sich in der pro/essio des Ansegis von Sens und der
übrigen Bischöfe, die Hinkmar in seinen Annalen wiedergab, dann doch findet (Annales Ber-
tiniani, a. 87/^ 221). Konnte sich Hinkmar an diesem Punkt mit seinen Vorstellungen nicht
durchsetzen? Dasselbe könnte für die Wendung oMVh'o et co77s?'üo gelten, die Hinkmar 876 noch
ausdrücklich als redundant abgelehnt hatte (MiGNE PL 125, Sp. 1126 A: Quod oute777 posit 77777 est,
>C077S7'Ü0 et 77MX7'(7'o< SMper/tMe 77(M7tM777 est. ?77 eo e777777 f?Mod (Ü'V, >SeCM77(tM777 77!eM77! SC7're<, C077S7ÜM777, et
777 eo f?Mod TÜÜ, >SeCM77(tM777 777eM777 pOSSe<, 77MX7'ÜM777 C077t777etMr).
409
sein. Er bezweifelte nämlich, daß ein Bischof auch dann noch dem Kaiser Gehor-
sam und Beistand schulde, wenn der etwas befehle oder betreibe, das dem cpz'sco-
palc wän'sfcriMW nicht angemessen seW. Für den Rest der Eidesformel hatte Hink-
mar nur noch Spott übrig: Der Text sei redundant und unpräzise. Erst dieser
Kommentar aber bietet einen Schlüssel für Hinkmars Darstellung in den »Annales
Bertiniani« zu 877. Ludwigs Krönung in Compiegne dokumentierte nach Meinung
des Reimser Erzbischofs eben jenes gottgewollte Verhältnis zwischen König und
Episkopat, das die Pariser Konzilsväter beschrieben hatten.
3. Fazit
Im Vergleich zu der Annalistik der Zeit Karls des Großen und der ersten Jahre Lud-
wigs des Frommen schrieben die Verfasser der Annalentexte aus Köln, Mainz, Pas-
sau, Troyes und Reims den Bischöfen ihrer Zeit eine entschieden höhere Bedeutung
zu. Die Geistlichen erscheinen seit der Mitte des 9. Jahrhunderts als eigenständig
handelnde Große, als aktive Partner des Königs bei der Leitung des Reiches, in Par-
allele zu den Grafen. Sie sind zudem in der Mission tätig, mit Fragen des Kults und
der christlichen Lehre befaßt, aber auch bei der militärischen Verteidigung ihrer
Städte und des Reiches aktiv, als Gesandte des Herrschers unterwegs und insge-
samt in die politischen Auseinandersetzungen ihrer Zeit einbezogen. Ihrem neuen
Gewicht in den Annalen entsprach es, daß in dieser Textgruppe über weit mehr
Aspekte bischöflichen Wirkens berichtet wurde als in der Annalistik der Jahre um
800: Auch das Engagement eines Erzbischofs in der Armenfürsorge, seine Rolle als
Vermittler zwischen zwei Königen oder die pro/cssioncs von Bischöfen bei der Erhe-
bung eines Königs erschienen nun in annalistischen Texten erwähnenswert.
Die Ursachen für dieses Interesse am Aufgabenspektrum des Episkopats und
für das höhere Gewicht, das den Bischöfen zugeschrieben wurde, dürften nicht zu-
letzt darin zu suchen sein, daß diese Annalenwerke spätestens ab den 870er Jahren
von Bischöfen kontrolliert und auch in ihrem Inhalt geprägt wurden: die »Annales
Xantenses« durch die Interessen Williberts von Köln, die »Annales Bertiniani«
durch die Ziele Hinkmars von Reims, die »Annales Fuldenses« durch jene Hrabans
und Liutberts von Mainz, später vielleicht auch Wichings von Neutra und Richars
von Passau. Zumindest in manchen ihrer Jahresberichte spiegeln diese Texte zu-
dem die Absichten und Ziele dieser Persönlichkeiten nicht nur wider; sie werden
vielmehr selbst zu Instrumenten bischöflicher Politik: Willibert nutzte Anfang der
870er Jahre Geschichtsschreibung, um sich nach seiner umstrittenen und kirchen-
320 Ebd., Sp. 1126 B. - Hinkmars Wunschformel lautete (nach ebd., Sp. 1127 D) wie folgt: SecunAnn
777eM777 sehe 77C pOSSe, JMXta 7777777Ster7M777 777CM77! /i&ÜS ero, S7CMt OrcMespisCOpMS per recfM77! 777!per77for7
Jtdeh's esse &&et. Bemerkenswerterweise fehlt hier, von Hinkmar ausdrücklich begründet (Sp.
1125 B), das Wort se777'or ganz - während es sich in der pro/essio des Ansegis von Sens und der
übrigen Bischöfe, die Hinkmar in seinen Annalen wiedergab, dann doch findet (Annales Ber-
tiniani, a. 87/^ 221). Konnte sich Hinkmar an diesem Punkt mit seinen Vorstellungen nicht
durchsetzen? Dasselbe könnte für die Wendung oMVh'o et co77s?'üo gelten, die Hinkmar 876 noch
ausdrücklich als redundant abgelehnt hatte (MiGNE PL 125, Sp. 1126 A: Quod oute777 posit 77777 est,
>C077S7'Ü0 et 77MX7'(7'o< SMper/tMe 77(M7tM777 est. ?77 eo e777777 f?Mod (Ü'V, >SeCM77(tM777 77!eM77! SC7're<, C077S7ÜM777, et
777 eo f?Mod TÜÜ, >SeCM77(tM777 777eM777 pOSSe<, 77MX7'ÜM777 C077t777etMr).