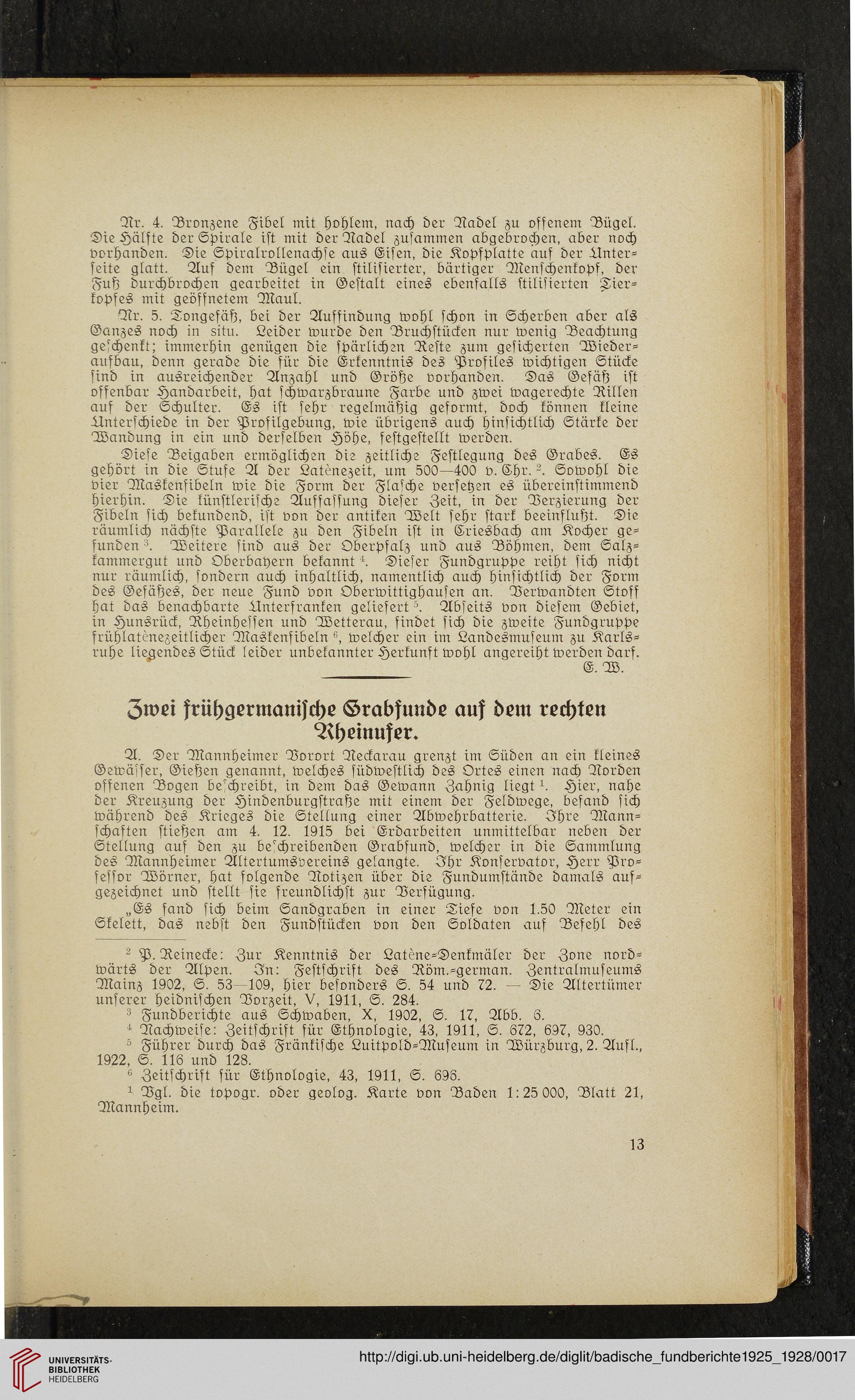Nr. 4. Bronzene Fibel mit hohlem, nach der Äadel zu offenem Bügel.
Die Hälfte öer Spirale ift mit der Nadel zusammen abgebrochen, aber noch
vorhanden. Die Spiralrollenachse aus Eisen, die Kopfplatte auf der Llnter-
seite glatt. Auf dem Bügel ein stilisierter, bärtiger Menschenkopf, öer
Fuh durchbrochen gearbeitet in Gestalt eines ebenfalls stilisierten Pier-
kopfes mit geöffnetem Maul.
Nr. 5. Tongefäh, bei der Auffinöung wohl schon in Scherben aber als
Ganzes noch in situ. Leider tvurde den Bruchstücken nur wenig Beachtung
gefchenkt; immerhin genügen die spärlichen Reste zum gesicherten Wieder-
aufbau, denn gerade die für die Eokenntnis des Profiles wichtigen Stücke
sind in ausreichender Anzahl und Gröste vorhanden. Das Gefäh ist
offenbar Handarbeit, hat schwarzbraune Farbe und zwei wagerechte Rillen
auf der Schulter. Es ist fehr regelmähig geformt, doch können kleine
stlnterschiede in der Profilgebung, wie übrigens auch hinsichtlich Stärke der
Wandung in ein und derselben Höhe, festgestellt weröen.
Diese Beigaben ermöglichen die zeitliche Festlegung des Grabes. Es
gehört in die Stufe 2l der Latenezeit, um 500—400 v. Chr. st Sowohl die
vier Maskenfibeln wie die Form der Flafche versehen es übereinstimmend
hierhin. Die künstlerische Auffassung dieser Zeit, in der Derzierung der
Fibeln sich bekundend, ift von der antiken Welt sehr stark beeinfluht. Die
räumlich nächste Parallele zu den Fibeln ist in Criesbach am Kocher ge-
funden b. Weitere sind aus der Oberpfalz und aus Böhmen, dem Salz-
kammergut und Oberbahern bekannt L Dieser Fundgruppe reiht sich nicht
nur räumlich, sondern auch inhaltlich, namentlich auch hinsichtlich öer Form
des Gefähes, der neue Fund von Oberwittighausen an. Verwandten Stoff
hat das benachbarte Llnterfranken geliefert^. Abseits von diesem Gebiet,
in Hunsrück, Rheinhessen und Wetterau, findet sich die zweite Fundgruppe
frühlatenezeitlicher Maskenfibeln st welcher ein im Landesmuseum zu Karls-
ruhe liegendes Stück leider unbekannter Herkunft wohl angereiht werden dars.
E. W.
Zwei friihgermanische Grabfunde auf dem rechlen
Aheinufer.
2l. Der Mannheimer Vorort Reckarau grenzt im Süden an ein kleines
Gewäfser, Giehen genannt, welches südwestlich des Ortes einen nach Rorden
offenen Bogen befchreibt, in dem das Gewann Zahnig liegt L Hier, nahe
der Kreuzung der Hindenburgstrahe mit einem öer Feldwege, befand sich
während des Krieges die Stellung einer Abwehrbatterie. Jhre Mann-
schaften stiehen am 4. 12. 1915 bei Erdarbeiten unmittelbar neben der
Stellung auf den zu be'chreibenden Grabfund, welcher in öie Sammlung
des Mannheimer 2lltertumsvereins gelangte. Jhr Konservator, Herr Pro-
fessor Wörner, hat folgende Rotizen über die Fundumstände damals auf-
gezeichnet und stellt sie freundlichst zur Verfügung.
„Es fand sich beim Sandgraben in einer Tiefe von 1.50 Meter ein
Skelett, das nebst den Fundstücken von den Soldaten auf Befehl des
^ P. Reinecke: Zur Kenntnis der Latene-Denkmäler der Zone norö-
wärts der 2llpen. Jn: Festschrift des Röm.-german. Zentralmuseums
Mainz 1902, S. 53- 109, hier besonders S. 54 und 72. — Die Altertümer
unserer heidnischen Vorzeit, V, 1911, S. 284.
^ Fundberichte aus Schwaben, X, 1902, S. 17, Abb. ö.
^ Vachweise: Zeitschrift für Ethnologie, 43, 1911, S. 672, 697, 930.
0 Führer durch das Fränkische Luitpold-Museum in Würzburg, 2. Aufl.,
1922, S. 116 und 128.
6 Zeitschrift für Ethnologie, 43, 1911, S. 693.
1 Vgl. die topogr. oder geolog. Karte von Baden 1:25 000, Blatt 21,
Mannheim.
Die Hälfte öer Spirale ift mit der Nadel zusammen abgebrochen, aber noch
vorhanden. Die Spiralrollenachse aus Eisen, die Kopfplatte auf der Llnter-
seite glatt. Auf dem Bügel ein stilisierter, bärtiger Menschenkopf, öer
Fuh durchbrochen gearbeitet in Gestalt eines ebenfalls stilisierten Pier-
kopfes mit geöffnetem Maul.
Nr. 5. Tongefäh, bei der Auffinöung wohl schon in Scherben aber als
Ganzes noch in situ. Leider tvurde den Bruchstücken nur wenig Beachtung
gefchenkt; immerhin genügen die spärlichen Reste zum gesicherten Wieder-
aufbau, denn gerade die für die Eokenntnis des Profiles wichtigen Stücke
sind in ausreichender Anzahl und Gröste vorhanden. Das Gefäh ist
offenbar Handarbeit, hat schwarzbraune Farbe und zwei wagerechte Rillen
auf der Schulter. Es ist fehr regelmähig geformt, doch können kleine
stlnterschiede in der Profilgebung, wie übrigens auch hinsichtlich Stärke der
Wandung in ein und derselben Höhe, festgestellt weröen.
Diese Beigaben ermöglichen die zeitliche Festlegung des Grabes. Es
gehört in die Stufe 2l der Latenezeit, um 500—400 v. Chr. st Sowohl die
vier Maskenfibeln wie die Form der Flafche versehen es übereinstimmend
hierhin. Die künstlerische Auffassung dieser Zeit, in der Derzierung der
Fibeln sich bekundend, ift von der antiken Welt sehr stark beeinfluht. Die
räumlich nächste Parallele zu den Fibeln ist in Criesbach am Kocher ge-
funden b. Weitere sind aus der Oberpfalz und aus Böhmen, dem Salz-
kammergut und Oberbahern bekannt L Dieser Fundgruppe reiht sich nicht
nur räumlich, sondern auch inhaltlich, namentlich auch hinsichtlich öer Form
des Gefähes, der neue Fund von Oberwittighausen an. Verwandten Stoff
hat das benachbarte Llnterfranken geliefert^. Abseits von diesem Gebiet,
in Hunsrück, Rheinhessen und Wetterau, findet sich die zweite Fundgruppe
frühlatenezeitlicher Maskenfibeln st welcher ein im Landesmuseum zu Karls-
ruhe liegendes Stück leider unbekannter Herkunft wohl angereiht werden dars.
E. W.
Zwei friihgermanische Grabfunde auf dem rechlen
Aheinufer.
2l. Der Mannheimer Vorort Reckarau grenzt im Süden an ein kleines
Gewäfser, Giehen genannt, welches südwestlich des Ortes einen nach Rorden
offenen Bogen befchreibt, in dem das Gewann Zahnig liegt L Hier, nahe
der Kreuzung der Hindenburgstrahe mit einem öer Feldwege, befand sich
während des Krieges die Stellung einer Abwehrbatterie. Jhre Mann-
schaften stiehen am 4. 12. 1915 bei Erdarbeiten unmittelbar neben der
Stellung auf den zu be'chreibenden Grabfund, welcher in öie Sammlung
des Mannheimer 2lltertumsvereins gelangte. Jhr Konservator, Herr Pro-
fessor Wörner, hat folgende Rotizen über die Fundumstände damals auf-
gezeichnet und stellt sie freundlichst zur Verfügung.
„Es fand sich beim Sandgraben in einer Tiefe von 1.50 Meter ein
Skelett, das nebst den Fundstücken von den Soldaten auf Befehl des
^ P. Reinecke: Zur Kenntnis der Latene-Denkmäler der Zone norö-
wärts der 2llpen. Jn: Festschrift des Röm.-german. Zentralmuseums
Mainz 1902, S. 53- 109, hier besonders S. 54 und 72. — Die Altertümer
unserer heidnischen Vorzeit, V, 1911, S. 284.
^ Fundberichte aus Schwaben, X, 1902, S. 17, Abb. ö.
^ Vachweise: Zeitschrift für Ethnologie, 43, 1911, S. 672, 697, 930.
0 Führer durch das Fränkische Luitpold-Museum in Würzburg, 2. Aufl.,
1922, S. 116 und 128.
6 Zeitschrift für Ethnologie, 43, 1911, S. 693.
1 Vgl. die topogr. oder geolog. Karte von Baden 1:25 000, Blatt 21,
Mannheim.