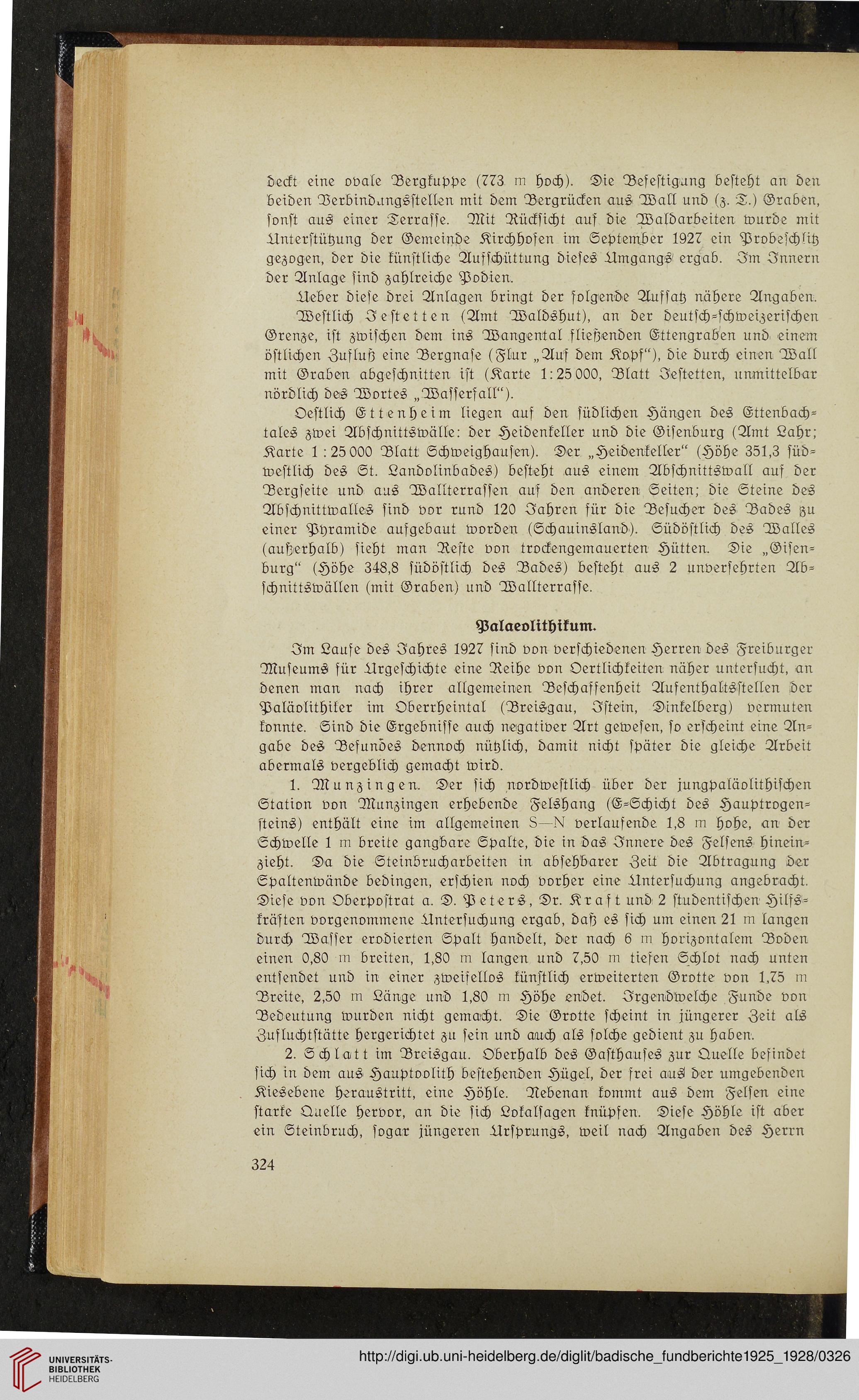öeckt eine vvale Bergkuppe (773 m hvch). Die Defestigung besteht an öen
'beiden Lerbindungsstellen mit dem Dergrücken aus- Wall und (z. T.) Graben,
sonst aus einer Terrasse. Mit Rücksicht auf die Waldarbeiten wurde mit
plnterstützung der Gemeinde Kirchhofen im September 1927 ein Prvbeschsitz
gezogen, der die künstliche Aufschüttung öieses Ülmgangs ergab. Jm Jnnern
der 2lnlage sind zahlreiche Podien.
äüeber diese örei Anlagen bringt öer folgende Aufsatz nähere Angaben.
Westlich Jestetten (Amt Walöshut), an der deutsch-schweizerischen
Grenze, ist zwischen dem ins Wangental flietzenden Ettengraben unö einem
östlichen Zuflutz eine Bergnase (Flur „Aüf öem Kopf"), öie öurch einen Wall
mit Graben abgeschnitten ist (Karte 1:25 000, Dlatt Jestetten, unmittelbar
nörölich dss Wortes „Wasserfall").
Oestlich Ettenheim liegen auf öen süölichen Hängen des Ettenbach-
tales zwei Abschnittswälle: der Heiöenkeller und die Gisenburg (Amt Lahr;
Karte 1 :25 000 Blatt Schweighausen). Der „Heidenkeller" (Höhe 351,3 füö-
westlich des St. Landolinbades) besteht aus einem Abschnittswall auf öer
Pergseite und aus Wallterrassen auf den anöeren Seiten,' die Steine des
Abschnittwalles sind vor rund 120 Oahren für öie Besucher des Bades zu
einer Pyramide aufgebaut worden (Schauinsland). Südöstlich öes Walles
(austerhalb) sieht man Reste von trockengemauerten Hütten. Die „Gisen-
burg" (Höhe 348,8 südöstlich des Baöes) besteht aus 2 unversehrten Ab-
schnittswällen (mit Graben) und Wallterrasse.
Palaeolithikum.
Jm Laufe des Jahres 1927 sinö von verschieöenen Herren des Freiburger
Museums für Llrgeschichte eine Reihe von Oertlichkeiten näher untersucht, an
denen man nach ihrer allgemeinen Deschaffenheit Aufenthaltsstellen der
Paläolithiker im Oberrheintal (Breisgau, Jstein, Dinkelberg) vermuten
konnte. Sind die Ergebnisse auch negativer Art gewesen, so erscheint eine An-
gabe des Befunoes öennoch nützlich, damit nicht später öie gleiche Arbeit
abermals vergeblich gemacht wird.
1. Munzingen. Der sich noröwestlich über öer jungpaläolithischen
Station von Munzingen erhebende Felshang (E-Schicht öes Hauptrogen-
steins) enthält eine im allgemeinen 3—l^l verlaufende 1,8 m hohe, an öer
Schwelle 1 m breite gangbare Spalte, öie in öas Jnnere öes Felsens hinein-
zieht. Da die Steinbrucharbeiten in abfehbarer Zeit öie Abtragung der
Spaltenwände bedingen, erschien noch vorher eine älntersuchung angebracht.
Diese von Oberpostrat a. D. Peters, Dr. Kraft und 2 studentischen Hilfs-
kräften vorgenommene älntersuchung ergab, datz es sich um einen 21 m langen
durch Wafser erodierten Spalt handelt, öer nach 6 m horizontalem Boden
einen 0,80 m breiten, 1,80 m langen und 7,50 m tiefen Schlot nach unten
entsendet und in einer zweifellos künstlich erweiterten Grotte von 1,75 m
Breite, 2,50 m Länge unö 1,80 m Höhe endet. Orgendwelche Funöe von
Dedeutung wurden nicht gemacht. Die Grotte scheint in jüngerer Zeit als
Zufluchtstätte hergerichtet zu sein und auch als solche geöient zu haben.
2. Schlatt im Dreisgau. Oberhalb öes Gasthauses zur Que-lle befindet
sich in dem aus Hauptoolith bestehenöen Hügel, öer frei aus d-er umgebenden
Kiesebene heraustritt, eine Höhle. Aebenan kommt aus öem Felsen eine
starke Quelle hervor, an die sich Lokalsagen knüpfen. Diese Höhle ist aber
ein Steinbruch, sogar jüngeren Llrsprungs, weil nach Angaben öes Herrn
324
'beiden Lerbindungsstellen mit dem Dergrücken aus- Wall und (z. T.) Graben,
sonst aus einer Terrasse. Mit Rücksicht auf die Waldarbeiten wurde mit
plnterstützung der Gemeinde Kirchhofen im September 1927 ein Prvbeschsitz
gezogen, der die künstliche Aufschüttung öieses Ülmgangs ergab. Jm Jnnern
der 2lnlage sind zahlreiche Podien.
äüeber diese örei Anlagen bringt öer folgende Aufsatz nähere Angaben.
Westlich Jestetten (Amt Walöshut), an der deutsch-schweizerischen
Grenze, ist zwischen dem ins Wangental flietzenden Ettengraben unö einem
östlichen Zuflutz eine Bergnase (Flur „Aüf öem Kopf"), öie öurch einen Wall
mit Graben abgeschnitten ist (Karte 1:25 000, Dlatt Jestetten, unmittelbar
nörölich dss Wortes „Wasserfall").
Oestlich Ettenheim liegen auf öen süölichen Hängen des Ettenbach-
tales zwei Abschnittswälle: der Heiöenkeller und die Gisenburg (Amt Lahr;
Karte 1 :25 000 Blatt Schweighausen). Der „Heidenkeller" (Höhe 351,3 füö-
westlich des St. Landolinbades) besteht aus einem Abschnittswall auf öer
Pergseite und aus Wallterrassen auf den anöeren Seiten,' die Steine des
Abschnittwalles sind vor rund 120 Oahren für öie Besucher des Bades zu
einer Pyramide aufgebaut worden (Schauinsland). Südöstlich öes Walles
(austerhalb) sieht man Reste von trockengemauerten Hütten. Die „Gisen-
burg" (Höhe 348,8 südöstlich des Baöes) besteht aus 2 unversehrten Ab-
schnittswällen (mit Graben) und Wallterrasse.
Palaeolithikum.
Jm Laufe des Jahres 1927 sinö von verschieöenen Herren des Freiburger
Museums für Llrgeschichte eine Reihe von Oertlichkeiten näher untersucht, an
denen man nach ihrer allgemeinen Deschaffenheit Aufenthaltsstellen der
Paläolithiker im Oberrheintal (Breisgau, Jstein, Dinkelberg) vermuten
konnte. Sind die Ergebnisse auch negativer Art gewesen, so erscheint eine An-
gabe des Befunoes öennoch nützlich, damit nicht später öie gleiche Arbeit
abermals vergeblich gemacht wird.
1. Munzingen. Der sich noröwestlich über öer jungpaläolithischen
Station von Munzingen erhebende Felshang (E-Schicht öes Hauptrogen-
steins) enthält eine im allgemeinen 3—l^l verlaufende 1,8 m hohe, an öer
Schwelle 1 m breite gangbare Spalte, öie in öas Jnnere öes Felsens hinein-
zieht. Da die Steinbrucharbeiten in abfehbarer Zeit öie Abtragung der
Spaltenwände bedingen, erschien noch vorher eine älntersuchung angebracht.
Diese von Oberpostrat a. D. Peters, Dr. Kraft und 2 studentischen Hilfs-
kräften vorgenommene älntersuchung ergab, datz es sich um einen 21 m langen
durch Wafser erodierten Spalt handelt, öer nach 6 m horizontalem Boden
einen 0,80 m breiten, 1,80 m langen und 7,50 m tiefen Schlot nach unten
entsendet und in einer zweifellos künstlich erweiterten Grotte von 1,75 m
Breite, 2,50 m Länge unö 1,80 m Höhe endet. Orgendwelche Funöe von
Dedeutung wurden nicht gemacht. Die Grotte scheint in jüngerer Zeit als
Zufluchtstätte hergerichtet zu sein und auch als solche geöient zu haben.
2. Schlatt im Dreisgau. Oberhalb öes Gasthauses zur Que-lle befindet
sich in dem aus Hauptoolith bestehenöen Hügel, öer frei aus d-er umgebenden
Kiesebene heraustritt, eine Höhle. Aebenan kommt aus öem Felsen eine
starke Quelle hervor, an die sich Lokalsagen knüpfen. Diese Höhle ist aber
ein Steinbruch, sogar jüngeren Llrsprungs, weil nach Angaben öes Herrn
324