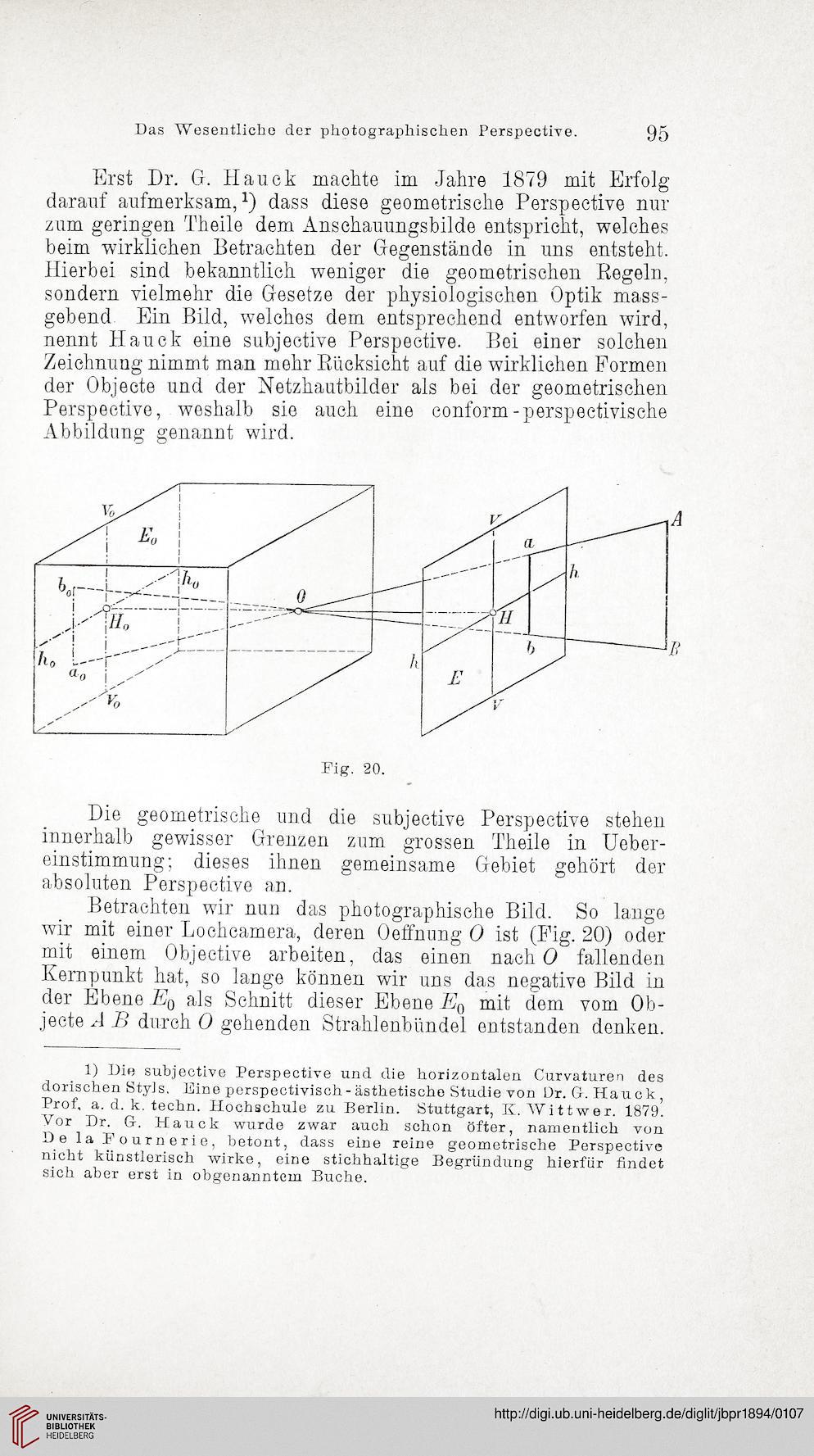Jahrbuch für Photographie und Reproduktionstechnik — 8.1894
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.47903#0107
DOI Heft:
Original-Beiträge
DOI Artikel:Schiffner, Franz: Das Wesentliche der photographischen Perspective
DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.47903#0107
Das Wesentliche der photographischen Perspective.
95
Erst Dr. G. Hauck machte im Jahre 1879 mit Erfolg
darauf aufmerksam,1) dass diese geometrische Perspective nur
zum geringen Theile dem Anschauungsbilde entspricht, welches
beim wirklichen Betrachten der Gegenstände in uns entsteht.
Hierbei sind bekanntlich weniger die geometrischen Regeln,
sondern vielmehr die Gesetze der physiologischen Optik mass-
gebend Ein Bild, welches dem entsprechend entworfen wird,
nennt Hauck eine subjective Perspective. Bei einer solchen
Zeichnung nimmt man mehr Rücksicht auf die wirklichen Formen
der Objecte und der Netzhautbilder als bei der geometrischen
Perspective, weshalb sie auch eine conform-perspectivische
Abbildung genannt wird.
Die geometrische und die subjective Perspective stehen
innerhalb gewisser Grenzen zum grossen Theile in Ueber-
einstimmung; dieses ihnen gemeinsame Gebiet gehört der
absoluten Perspective an.
Betrachten wir nun das photographische Bild. So lange
wir mit einer Lochcamera, deren Oeffnung 0 ist (Fig. 20) oder
mit einem Objective arbeiten, das einen nach 0 fallenden
Kernpunkt hat, so lange können wir uns das negative Bild in
der Ebene Eo als Schnitt dieser Ebene Eo mit dem vom Ob-
jecte A B durch 0 gehenden Strahlenbündel entstanden denken.
1) Die subjective Perspective und die horizontalen Curvaturen des
dorischen Styls. Eine perspectivisch-ästhetische Studie von Dr. G. Hauck,
Prof, a. d. k. techn. Hochschule zu Berlin. Stuttgart, K. Wittwer. 1879.
Vor Dr. G. Hauck wurde zwar auch schon öfter, namentlich von
De la Fournerie, betont, dass eine reine geometrische Perspective
nicht künstlerisch wirke, eine stichhaltige Begründung hierfür findet
sich aber erst in obgenanntem Buche.
95
Erst Dr. G. Hauck machte im Jahre 1879 mit Erfolg
darauf aufmerksam,1) dass diese geometrische Perspective nur
zum geringen Theile dem Anschauungsbilde entspricht, welches
beim wirklichen Betrachten der Gegenstände in uns entsteht.
Hierbei sind bekanntlich weniger die geometrischen Regeln,
sondern vielmehr die Gesetze der physiologischen Optik mass-
gebend Ein Bild, welches dem entsprechend entworfen wird,
nennt Hauck eine subjective Perspective. Bei einer solchen
Zeichnung nimmt man mehr Rücksicht auf die wirklichen Formen
der Objecte und der Netzhautbilder als bei der geometrischen
Perspective, weshalb sie auch eine conform-perspectivische
Abbildung genannt wird.
Die geometrische und die subjective Perspective stehen
innerhalb gewisser Grenzen zum grossen Theile in Ueber-
einstimmung; dieses ihnen gemeinsame Gebiet gehört der
absoluten Perspective an.
Betrachten wir nun das photographische Bild. So lange
wir mit einer Lochcamera, deren Oeffnung 0 ist (Fig. 20) oder
mit einem Objective arbeiten, das einen nach 0 fallenden
Kernpunkt hat, so lange können wir uns das negative Bild in
der Ebene Eo als Schnitt dieser Ebene Eo mit dem vom Ob-
jecte A B durch 0 gehenden Strahlenbündel entstanden denken.
1) Die subjective Perspective und die horizontalen Curvaturen des
dorischen Styls. Eine perspectivisch-ästhetische Studie von Dr. G. Hauck,
Prof, a. d. k. techn. Hochschule zu Berlin. Stuttgart, K. Wittwer. 1879.
Vor Dr. G. Hauck wurde zwar auch schon öfter, namentlich von
De la Fournerie, betont, dass eine reine geometrische Perspective
nicht künstlerisch wirke, eine stichhaltige Begründung hierfür findet
sich aber erst in obgenanntem Buche.