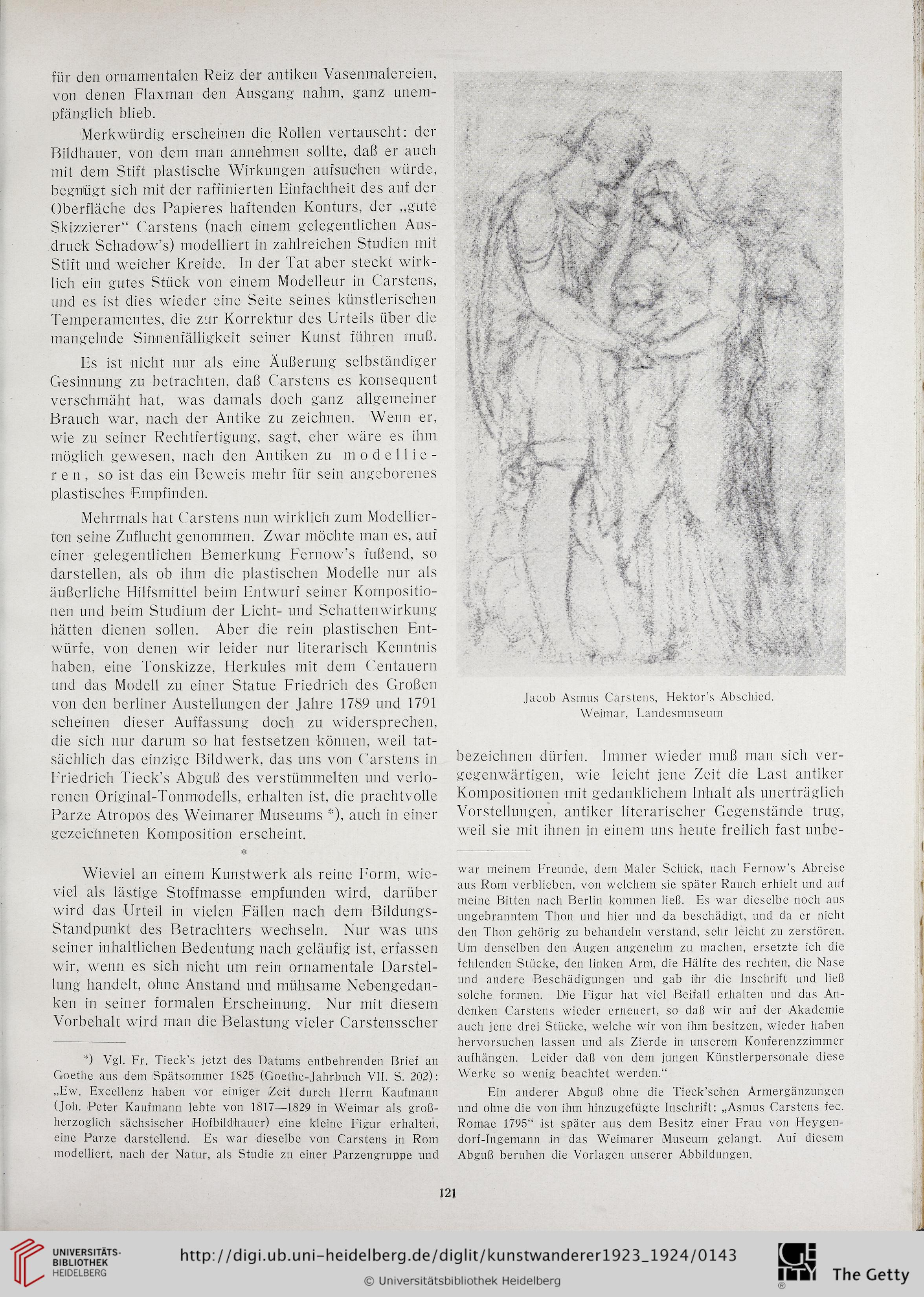für den ornamentalen Keiz der antiken Vasenmalereien,
von denen Flaxman den Ausgang nahm, ganz unem-
pfänglich blieb.
Merkwürdig erscheinen die Rollen vertauscht: der
Bildhauer, von dem man annehmen sollte, daß er auch
mit dem Stift plastische Wirkungen aufsuc'hen würde,
begnügt sich mit der raffinierten Einfachheit des auf der
Oberfläche des Papieres haftenden Konturs, der „gute
Skizzierer“ Carstens (nach einem gelegentlichen Aus-
druck Schadow’s) modelliert in zahlreichen Studien mit
Stift und weicher Kreide. In der Tat aber steckt wirk-
lich ein gutes Stück von einem Modelleur in Carstens,
nnd es ist dies wieder eine Seite seines künstlerischen
Temperamentes, die zur Korrektur des Urteils über die
mangelnde Sinnenfälligkeit seiner Kunst führen muß.
Es ist nicht nur als eine Äußerung selbständiger
Gesinnung zu betrachten, daß Carstens es konsequent
verschmäht hat, was damals doch ganz allgemeiner
Brauch war, nach der Antike zu zeichnen. Wenn er,
wie zu seiner Rechtfertigung, sagt, eher wäre es ihm
möglich gewesen, nach den Antiken zu m o d e 11 i e -
r e n , so ist das ein Beweis mehr für seiti angeborenes
plastisches Empfinden.
Mehrmals hat Carstens nun wirklich zum Modellier-
ton seine Zuflucht genommen. Zwar möchte man es, auf
einer gelegentlichen Bemerkung Fernow’s fußend, so
darstellen, als ob ihm die plastischen Modelle nur als
äußerliche Hilfsmittel beim Entwurf seiuer Kompositio-
nen und beim Studium der Licht- und Schattenwirkung
hätten dienen sollen. Aber die rein plastischen Ent-
würfe, von denen wir leider nur literarisch Kenntnis
haben, eine Tonskizze, Herkules mit dem Centauern
und das Modell zu einer Statue Friedrich des Großen
von den berliner Austellungen der Jahre 1789 und 1791
scheinen dieser Auffassung doch zu widersprechen,
die sich nur darum so hat festsetzen können, weil tat-
sächlich das einzige Bildwerk, das uns von Carstens in
Friedrich Tieck’s Abguß des verstümmelten und verlo-
renen Original-Tonmodells, erhalten ist, die prachtvolle
Parze Atropos des Weimarer Museums *), auch in einer
gezeichneten Komposition erscheint.
Wieviel an einem Kunstwerk als reine Form, wie-
viel als lästige Stoffmasse empfunden wird, darüber
wird das Urteil in vielen Fällen nach dem Bildungs-
Standpunkt des Betrachters wechseln. Nur was uns
seiner inhaltlichen Bedeutung nach geläufig ist, erfassen
wir, wenn es sich nicht um rein ornamentale Darstel-
lung handelt, ohne Anstand und mühsame Nebengedan-
ken in seiner formalen Erscheinung. Nur mit diesem
Vorbehalt wird man die Belastung vieler Carstensscher
*) Vgl. Fr. Tieck’s jetzt des Datums entbehrenden Brief an
Goethe aus dem Spätsommer 1825 (Goethe-Jahrbuch VII. S. 202):
„Ew. Excellenz haben vor einiger Zeit durch Herrn Kaufmann
(Joh. Peter Kaufmann lebte von 1817—1829 in Weimar als groß-
herzoglich sächsischer Hofbildhauer) eine kleine Figur erhalten,
eine Parze darstellend. Es war dieselbe von Carstens in Rom
modelliert, nach der Natur, als Studie zu einer Parzengruppe und
Jacob Asmus Carstens, Hektor’s Abschied.
Weirnar, Landesmuseum
bezeichnen dürfen. Immer wieder muß man sich ver-
gegenwärtigen, wie leicht jene Zeit die Last antiker
Kompositionen mit gedanklichem Inhalt als unerträglich
Vorstellungen, antiker literarischer Gegenstände trug,
weil sie mit ihnen in einem uns heute freilich fast unbe-
war meinem Freunde, dem Maler Schick, nach Fernow’s Abreise
aus Rom verblieben, von welchem sie später Rauch erhielt und auf
meine Bitten nach Berlin kommen ließ. Es war dieselbe noch aus
ungebranntem Thon und hier und da beschädigt, und da er nicht
den Thon gehörig zu behandeln verstand, sehr leicht zu zerstören.
Um denselben den Augen angenehm zu machen, ersetzte ich die
fehlenden Stücke, den linken Arm, die Hälfte des rechten, die Nase
und andere Beschädigungen und gab ihr die Inschrift und ließ
solche formen. Die Figur hat viel Beifall erhalten und das An-
denken Carstens wieder erneuert, so daß wir auf der Akademie
auch jene drei Stücke, welche wir von ihm besitzen, wieder haben
hervorsuchen lassen und als Zierde in unserem Konferenzzimmer
aufhängen. Leider daß von dem jungen Kiinstlerpersonale diese
Werke so wenig beachtet werden.“
Ein anderer Abguß ohne die Tieck’sohen Armergänzungen
und ohne die von ihm hinzugefügte Inschrift: „Asmus Carstens fec.
Romae 1795“ ist später aus dem Besitz einer Frau von Heygen-
dorf-Ingemann in das Weimarer Museum gelangt. Auf diesem
Abguß beruhen die Vorlagen unserer Abbildungen.
121
von denen Flaxman den Ausgang nahm, ganz unem-
pfänglich blieb.
Merkwürdig erscheinen die Rollen vertauscht: der
Bildhauer, von dem man annehmen sollte, daß er auch
mit dem Stift plastische Wirkungen aufsuc'hen würde,
begnügt sich mit der raffinierten Einfachheit des auf der
Oberfläche des Papieres haftenden Konturs, der „gute
Skizzierer“ Carstens (nach einem gelegentlichen Aus-
druck Schadow’s) modelliert in zahlreichen Studien mit
Stift und weicher Kreide. In der Tat aber steckt wirk-
lich ein gutes Stück von einem Modelleur in Carstens,
nnd es ist dies wieder eine Seite seines künstlerischen
Temperamentes, die zur Korrektur des Urteils über die
mangelnde Sinnenfälligkeit seiner Kunst führen muß.
Es ist nicht nur als eine Äußerung selbständiger
Gesinnung zu betrachten, daß Carstens es konsequent
verschmäht hat, was damals doch ganz allgemeiner
Brauch war, nach der Antike zu zeichnen. Wenn er,
wie zu seiner Rechtfertigung, sagt, eher wäre es ihm
möglich gewesen, nach den Antiken zu m o d e 11 i e -
r e n , so ist das ein Beweis mehr für seiti angeborenes
plastisches Empfinden.
Mehrmals hat Carstens nun wirklich zum Modellier-
ton seine Zuflucht genommen. Zwar möchte man es, auf
einer gelegentlichen Bemerkung Fernow’s fußend, so
darstellen, als ob ihm die plastischen Modelle nur als
äußerliche Hilfsmittel beim Entwurf seiuer Kompositio-
nen und beim Studium der Licht- und Schattenwirkung
hätten dienen sollen. Aber die rein plastischen Ent-
würfe, von denen wir leider nur literarisch Kenntnis
haben, eine Tonskizze, Herkules mit dem Centauern
und das Modell zu einer Statue Friedrich des Großen
von den berliner Austellungen der Jahre 1789 und 1791
scheinen dieser Auffassung doch zu widersprechen,
die sich nur darum so hat festsetzen können, weil tat-
sächlich das einzige Bildwerk, das uns von Carstens in
Friedrich Tieck’s Abguß des verstümmelten und verlo-
renen Original-Tonmodells, erhalten ist, die prachtvolle
Parze Atropos des Weimarer Museums *), auch in einer
gezeichneten Komposition erscheint.
Wieviel an einem Kunstwerk als reine Form, wie-
viel als lästige Stoffmasse empfunden wird, darüber
wird das Urteil in vielen Fällen nach dem Bildungs-
Standpunkt des Betrachters wechseln. Nur was uns
seiner inhaltlichen Bedeutung nach geläufig ist, erfassen
wir, wenn es sich nicht um rein ornamentale Darstel-
lung handelt, ohne Anstand und mühsame Nebengedan-
ken in seiner formalen Erscheinung. Nur mit diesem
Vorbehalt wird man die Belastung vieler Carstensscher
*) Vgl. Fr. Tieck’s jetzt des Datums entbehrenden Brief an
Goethe aus dem Spätsommer 1825 (Goethe-Jahrbuch VII. S. 202):
„Ew. Excellenz haben vor einiger Zeit durch Herrn Kaufmann
(Joh. Peter Kaufmann lebte von 1817—1829 in Weimar als groß-
herzoglich sächsischer Hofbildhauer) eine kleine Figur erhalten,
eine Parze darstellend. Es war dieselbe von Carstens in Rom
modelliert, nach der Natur, als Studie zu einer Parzengruppe und
Jacob Asmus Carstens, Hektor’s Abschied.
Weirnar, Landesmuseum
bezeichnen dürfen. Immer wieder muß man sich ver-
gegenwärtigen, wie leicht jene Zeit die Last antiker
Kompositionen mit gedanklichem Inhalt als unerträglich
Vorstellungen, antiker literarischer Gegenstände trug,
weil sie mit ihnen in einem uns heute freilich fast unbe-
war meinem Freunde, dem Maler Schick, nach Fernow’s Abreise
aus Rom verblieben, von welchem sie später Rauch erhielt und auf
meine Bitten nach Berlin kommen ließ. Es war dieselbe noch aus
ungebranntem Thon und hier und da beschädigt, und da er nicht
den Thon gehörig zu behandeln verstand, sehr leicht zu zerstören.
Um denselben den Augen angenehm zu machen, ersetzte ich die
fehlenden Stücke, den linken Arm, die Hälfte des rechten, die Nase
und andere Beschädigungen und gab ihr die Inschrift und ließ
solche formen. Die Figur hat viel Beifall erhalten und das An-
denken Carstens wieder erneuert, so daß wir auf der Akademie
auch jene drei Stücke, welche wir von ihm besitzen, wieder haben
hervorsuchen lassen und als Zierde in unserem Konferenzzimmer
aufhängen. Leider daß von dem jungen Kiinstlerpersonale diese
Werke so wenig beachtet werden.“
Ein anderer Abguß ohne die Tieck’sohen Armergänzungen
und ohne die von ihm hinzugefügte Inschrift: „Asmus Carstens fec.
Romae 1795“ ist später aus dem Besitz einer Frau von Heygen-
dorf-Ingemann in das Weimarer Museum gelangt. Auf diesem
Abguß beruhen die Vorlagen unserer Abbildungen.
121