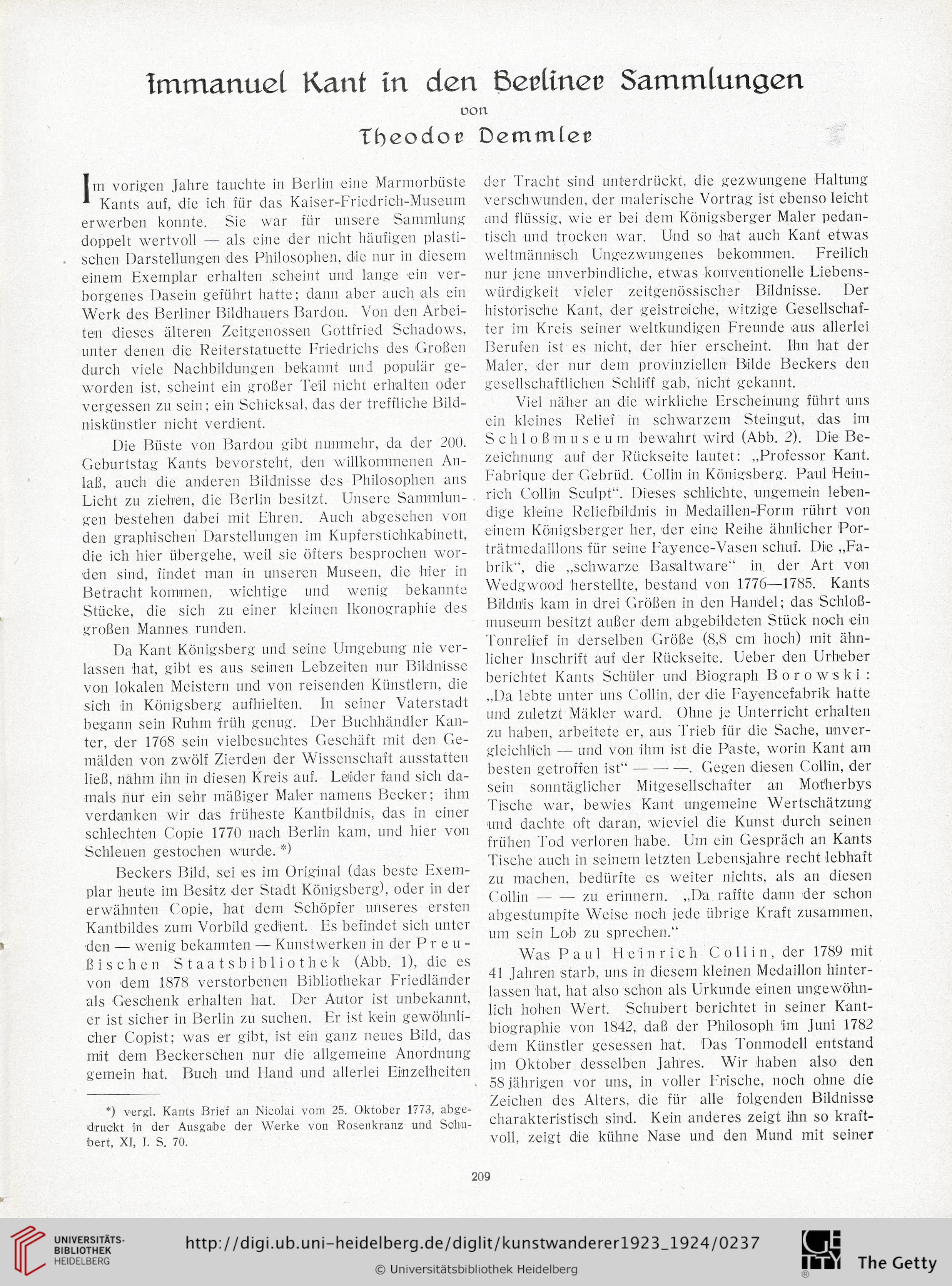Immanuel Kant tn den Qevltnev Sammtungen
oon
Tbcodot? Dcmmlet’
jm vorig-en Jahre tauchte in Berlin eine Marmorbüste
■“ Kants auf, die ich für das Kaiser-Friedrich-Museum
erwerben konnte. Sie war für unsere Sammlung
doppelt wertvoll — als eine der nicht häufigen plasti-
schen Darstellungen des Philosophen, die nur in diesem
einem Exemplar erhalten scheint und lange ein ver-
borgenes Dasein geführt hatte; dann aber auch als ein
Werk des Berliner Bildhauers Bardou. Von den Arbei-
ten dieses älteren Zeitgenossen Gottfried Schadows,
unter denen die Reiterstatuette Fricdrichs des Großen
durch viele Nachbildungen bekannt und populär ge-
worden ist, scheint ein großer Teil nicht erhalten oder
vergessen zu sein; ein Schicksal, das der treffliche Bild-
miskünstler nicht verdient.
Die Büste von Bardou gibt nunmehr, da der 200.
Geburtstag Kants bevorsteht, den willkommenen An-
laß, auch die anderen Bildnisse des Philosophen ans
Licht zu ziehen, die Berlin besitzt. Unsere Sammlun-
gen bestehen dabei mit Ehren. Auch abgesehen von
den grapbischen Darstellungen im Kupferstichkabinett,
die ich hier übergehe, weil sie öfters besprochen wor-
den sind, findet man in unseren Museen, die hier in
Betracht kommen, wichtige und wenig bekannte
Stücke, die sich zu einer kleineu Ikonographie des
großen Mannes runden.
Da Kant Königsberg und seine Umgebung nie ver-
lassen hat, gibt es aus seinen Lebzeiten nur Bildnisse
von lokalen Meistern und von reisenden Künstiern, die
sic'h in Königsberg aufhielten. In seiner Vaterstadt
begann sein Ruhm früh genug. Der Buchhändler Kan-
ter, der 1768 sein vielbesuchtes Geschäft mit den Ge-
mälden von zwölf Zierden der Wissenschaft ausstatten
ließ, nahm ihn in diesen Kreis auf. Leider fand sich da-
mais nur ein sehr mäßiger Maler namens Becker; ihm
verdanken wir das früheste Kantbildnis, das in einer
schlechten Copie 1770 nach Berlin kam, und hier von
Schleuen gestochen wurde. *)
Beckers Bild, sei es im Original (das beste Exem-
plar heute im Besiitz der Stadt Königsberg), oder in der
erwähnten Copie, hat dem Schöpfer unseres ersten
Kantbildes zum Vorbild gedient. Es befindet sich unter
den — wenig bekannten — Kunstwerken in der Preu-
ß i s c h e n Staatsbibliothek (Abb. 1), die es
von dem 1878 verstorbenen Bibliothekar Friedländer
als Geschenk erhalten liat. Der Autor ist unbekannt,
er ist sicher in Berlin zu suchen. Er ist kein gewöhnii-
cher Copist; was er gibt, ist eiu ganz neues Bild, das
mit dem Beckerschen nur die allgemeine Anordnung
gemein hat. Buch und Hand und allerlei Einzelheiten
*) vergl. Kants Brief an Nicolai vom 25. Oktober 1773, abge-
druckt in der Ausgabe der Werke von Rosenkranz und Sühu-
bert, XI, I. S. 70.
der Tracht sind unterdrückt, die gezwungene Haltung
verschwunden, der malerische Vortrag ist ebenso leicht
und flüssig, wie er bei dem Königsberger Maler pedan-
tisch und trocken war. Uud so hat auch Kant etwas
weltmännisch Ungezwungenes bekommen. Freilich
nur jene unverbindliche, etwas konventionelle Liebens-
würdigkeit vieler zeitgenössischer Bildnisse. Der
historische Kant, der geistreiche, witzige Gesellschaf-
ter im Kreis seiner weltkundigen Freunde aus allerlei
Berufen ist es nicht, der hier erscheint. Ihn hat der
Maler, der nur dem provinziellen Biilde Beckers den
gesellschaftlichen Schliff gab, nicht gekannt.
Viel näher an die wirkliche Erscheinung führt uns
ein kleines Relief in schwarzem Steingut, das im
Schloßmuseum bewahrt wird (Abb. 2). Die Be-
zeichnung auf der Rückseite lautet: „Professor Kant.
Fabrique der Gebrüd. Collin in Königsberg. Paul Hein-
rich Collin Sculpt“. Di'eses scbMchte, ungemein leben-
dige kieine Reliefbildnis in Medaillen-Form rührt von
einem Königsberger her, der eine Reihe ähnlicher Por-
trätmedaillons für seine Fayence-Vasen schuf. Die „Fa-
brik“, die „schwarze Basaltware“ in. der Art von
Wedgwood herstellte, bestand von 1776—1785. Kants
Bildn'is kam in drei Größen in den Handel; das Schloß-
museum besitzt außer dem abgebildeten Stück noch ein
Tonrelief in derselben Größe (8,8 cm hoch) mit ähn-
licher Inschrift auf der Rückseite. Ueber den Urheber
berichtet Kants Schüler und Biograph Borowski :
„Da lebte unter uns Collin, der die Fayencefabrik hatte
und zuletzt Mäkler ward. Ohne je Unterricht erhalten
zu haben, arbeitete er, aus Trieb für die Sache, unver-
gleichlich — und von ihm ist die Paste, worin Kant am
besten getroffen ist“ —-. Gegen diesen Collin, der
sein sonntäglicher Mitgesellschafter an Motherbys
Tische war, bewies Kant ungemeine Wertschätzung
und dachte oft daran, wieviel die Kunst durch seinen
frühen Tod verloren habe. Um ein Gespräch an Kants
Tische auch in seinem letzten Lebensjahre recht lebhaft
zu machen, bedürfte es weiter nichts, als an diesen
Collin-zu erinnern. „Da raffte dann der schon
abgestumpfte Weise noch jede übrige Kraft zusammen,
um sein Lob zu sprechen.“
Was Paul He'inrich Collin, der 1789 mit
41 Jahren starb, uns in diesem kleinen Medaillon hinter-
lassen hat, hat also schon als Urkunde einen ungewöhn-
lich hohen Wert. Schubert berichtet in seiner Kant-
biographie von 1842, daß der Philosoph 'im Juni 1782
dem Künstler gesessen hat. Das Tonmodell entstand
im Oktober desselben Jahres. Wir haben also den
58 jährigen vor uns, in voller Frische, noch ohne die
Zeichen des Alters, die für alle folgenden Bildnisse
charakteristisch sind. Kein anderes zeigt ihn so kraft-
voll, zeigt die kühne Nase und den Mund mit seiner
209
oon
Tbcodot? Dcmmlet’
jm vorig-en Jahre tauchte in Berlin eine Marmorbüste
■“ Kants auf, die ich für das Kaiser-Friedrich-Museum
erwerben konnte. Sie war für unsere Sammlung
doppelt wertvoll — als eine der nicht häufigen plasti-
schen Darstellungen des Philosophen, die nur in diesem
einem Exemplar erhalten scheint und lange ein ver-
borgenes Dasein geführt hatte; dann aber auch als ein
Werk des Berliner Bildhauers Bardou. Von den Arbei-
ten dieses älteren Zeitgenossen Gottfried Schadows,
unter denen die Reiterstatuette Fricdrichs des Großen
durch viele Nachbildungen bekannt und populär ge-
worden ist, scheint ein großer Teil nicht erhalten oder
vergessen zu sein; ein Schicksal, das der treffliche Bild-
miskünstler nicht verdient.
Die Büste von Bardou gibt nunmehr, da der 200.
Geburtstag Kants bevorsteht, den willkommenen An-
laß, auch die anderen Bildnisse des Philosophen ans
Licht zu ziehen, die Berlin besitzt. Unsere Sammlun-
gen bestehen dabei mit Ehren. Auch abgesehen von
den grapbischen Darstellungen im Kupferstichkabinett,
die ich hier übergehe, weil sie öfters besprochen wor-
den sind, findet man in unseren Museen, die hier in
Betracht kommen, wichtige und wenig bekannte
Stücke, die sich zu einer kleineu Ikonographie des
großen Mannes runden.
Da Kant Königsberg und seine Umgebung nie ver-
lassen hat, gibt es aus seinen Lebzeiten nur Bildnisse
von lokalen Meistern und von reisenden Künstiern, die
sic'h in Königsberg aufhielten. In seiner Vaterstadt
begann sein Ruhm früh genug. Der Buchhändler Kan-
ter, der 1768 sein vielbesuchtes Geschäft mit den Ge-
mälden von zwölf Zierden der Wissenschaft ausstatten
ließ, nahm ihn in diesen Kreis auf. Leider fand sich da-
mais nur ein sehr mäßiger Maler namens Becker; ihm
verdanken wir das früheste Kantbildnis, das in einer
schlechten Copie 1770 nach Berlin kam, und hier von
Schleuen gestochen wurde. *)
Beckers Bild, sei es im Original (das beste Exem-
plar heute im Besiitz der Stadt Königsberg), oder in der
erwähnten Copie, hat dem Schöpfer unseres ersten
Kantbildes zum Vorbild gedient. Es befindet sich unter
den — wenig bekannten — Kunstwerken in der Preu-
ß i s c h e n Staatsbibliothek (Abb. 1), die es
von dem 1878 verstorbenen Bibliothekar Friedländer
als Geschenk erhalten liat. Der Autor ist unbekannt,
er ist sicher in Berlin zu suchen. Er ist kein gewöhnii-
cher Copist; was er gibt, ist eiu ganz neues Bild, das
mit dem Beckerschen nur die allgemeine Anordnung
gemein hat. Buch und Hand und allerlei Einzelheiten
*) vergl. Kants Brief an Nicolai vom 25. Oktober 1773, abge-
druckt in der Ausgabe der Werke von Rosenkranz und Sühu-
bert, XI, I. S. 70.
der Tracht sind unterdrückt, die gezwungene Haltung
verschwunden, der malerische Vortrag ist ebenso leicht
und flüssig, wie er bei dem Königsberger Maler pedan-
tisch und trocken war. Uud so hat auch Kant etwas
weltmännisch Ungezwungenes bekommen. Freilich
nur jene unverbindliche, etwas konventionelle Liebens-
würdigkeit vieler zeitgenössischer Bildnisse. Der
historische Kant, der geistreiche, witzige Gesellschaf-
ter im Kreis seiner weltkundigen Freunde aus allerlei
Berufen ist es nicht, der hier erscheint. Ihn hat der
Maler, der nur dem provinziellen Biilde Beckers den
gesellschaftlichen Schliff gab, nicht gekannt.
Viel näher an die wirkliche Erscheinung führt uns
ein kleines Relief in schwarzem Steingut, das im
Schloßmuseum bewahrt wird (Abb. 2). Die Be-
zeichnung auf der Rückseite lautet: „Professor Kant.
Fabrique der Gebrüd. Collin in Königsberg. Paul Hein-
rich Collin Sculpt“. Di'eses scbMchte, ungemein leben-
dige kieine Reliefbildnis in Medaillen-Form rührt von
einem Königsberger her, der eine Reihe ähnlicher Por-
trätmedaillons für seine Fayence-Vasen schuf. Die „Fa-
brik“, die „schwarze Basaltware“ in. der Art von
Wedgwood herstellte, bestand von 1776—1785. Kants
Bildn'is kam in drei Größen in den Handel; das Schloß-
museum besitzt außer dem abgebildeten Stück noch ein
Tonrelief in derselben Größe (8,8 cm hoch) mit ähn-
licher Inschrift auf der Rückseite. Ueber den Urheber
berichtet Kants Schüler und Biograph Borowski :
„Da lebte unter uns Collin, der die Fayencefabrik hatte
und zuletzt Mäkler ward. Ohne je Unterricht erhalten
zu haben, arbeitete er, aus Trieb für die Sache, unver-
gleichlich — und von ihm ist die Paste, worin Kant am
besten getroffen ist“ —-. Gegen diesen Collin, der
sein sonntäglicher Mitgesellschafter an Motherbys
Tische war, bewies Kant ungemeine Wertschätzung
und dachte oft daran, wieviel die Kunst durch seinen
frühen Tod verloren habe. Um ein Gespräch an Kants
Tische auch in seinem letzten Lebensjahre recht lebhaft
zu machen, bedürfte es weiter nichts, als an diesen
Collin-zu erinnern. „Da raffte dann der schon
abgestumpfte Weise noch jede übrige Kraft zusammen,
um sein Lob zu sprechen.“
Was Paul He'inrich Collin, der 1789 mit
41 Jahren starb, uns in diesem kleinen Medaillon hinter-
lassen hat, hat also schon als Urkunde einen ungewöhn-
lich hohen Wert. Schubert berichtet in seiner Kant-
biographie von 1842, daß der Philosoph 'im Juni 1782
dem Künstler gesessen hat. Das Tonmodell entstand
im Oktober desselben Jahres. Wir haben also den
58 jährigen vor uns, in voller Frische, noch ohne die
Zeichen des Alters, die für alle folgenden Bildnisse
charakteristisch sind. Kein anderes zeigt ihn so kraft-
voll, zeigt die kühne Nase und den Mund mit seiner
209