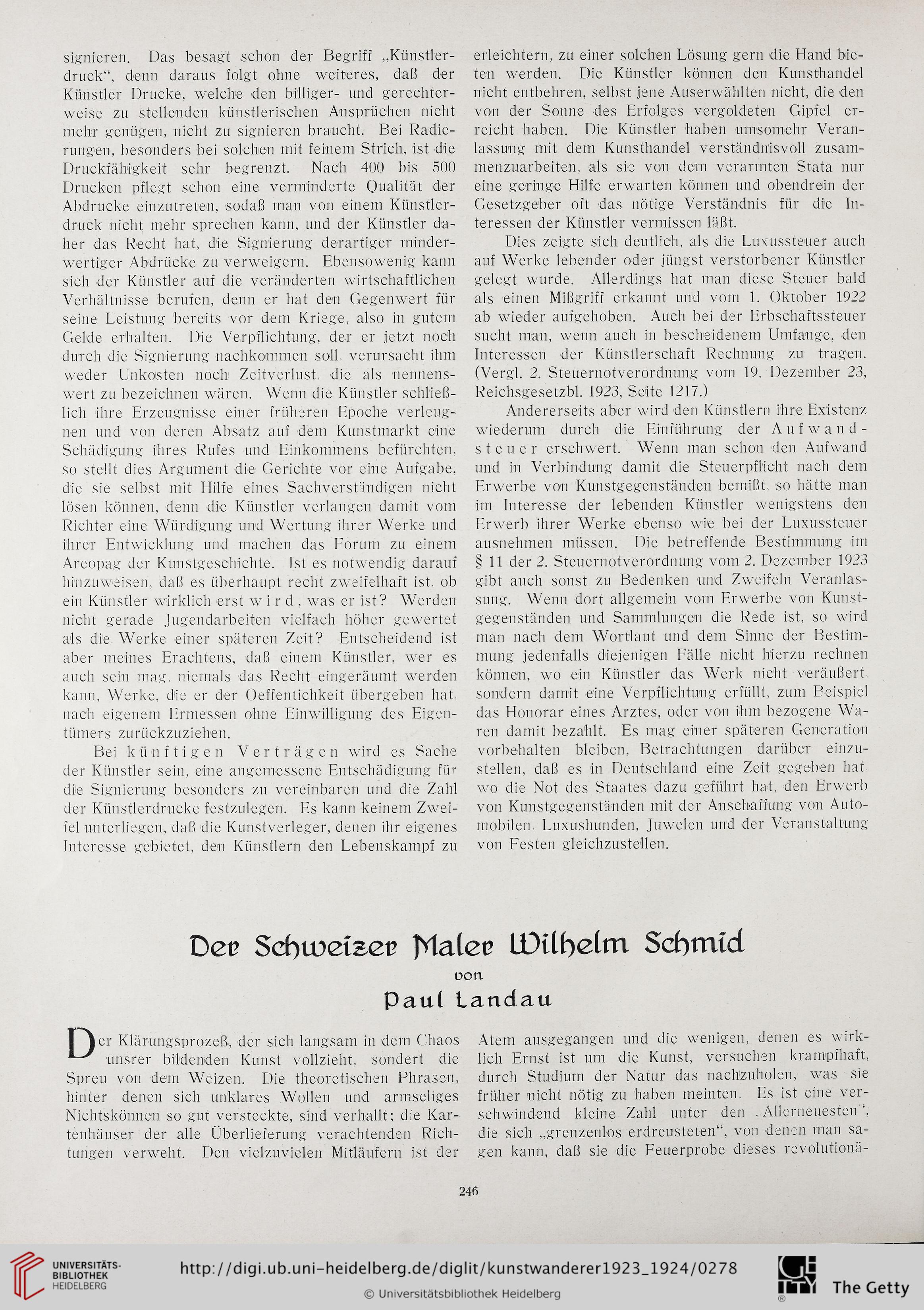signieren. Das besagt schon der Begriff „Künstler-
druck“, denn daraus folgt ohne weiteres, daß der
Künstler Drucke, welche den billiger- und gerechter-
weise zu stellenden kiiustlerischen Ansprüchen nicht
mehr genügen, nicht zu signieren braucht. Bei Rad'ie-
rungen, besonders bei solchen mit feinern Strich, ist die
Druckfähigkeit sehr begrenzt. Nach 400 bis 500
Drucken pflegt schon eine verminderte Qualität der
Abdrucke einzutreten, sodaß man von einem Künstler-
druck nicht mehr sprechen kann, und der Kiinstler da-
her das Recht hat, die Signierung derartiger minder-
wertiger Abdrücke zu verweigern. Ebensowenig kann
sich der Kiinstler auf die veränderten wirtschaftlichen
Verhältnisse berufen, denn er hat den Gegenwert für
seine Leistung bereits vor dem Kriege, also in gutem
Gelde erhalten. Die Verpflichtung, der er jetzt noch
durch die Signierung nachkommen soll. verursacht ihm
weder Unkosten noch Zeitverlust, die als nennens-
wert zu bezeichnen wären. Wenn die Kiinstler schließ-
lich ihre Erzeugnisse einer früheren Epoche verleug-
nen und von deren Absatz auf dem Kunstmarkt eine
Schädigung ihres Rufes und Einkommens befürchten,
so stellt dies Argument die Gerichte vor eine Aufgabe,
die sie selbst mit Hilfe eines Sachverständigen nicht
lösen können, denn die Künstler verlangen damit vom
Richter eine Würdigung und Wertung ihrer Werke und
ihrer Entwicklung und machen das Forum zu einem
Areopag der Kunstgeschichte. Ist es notwendig darauf
hinzuweisen, daß es überhaupt recht zweifelhaft ist, ob
ein Künstler wirklich erst w i r d , was er ist? Werden
nicht gerade Jugendarbeiten vielfach höher gewertet
ais die Werke einer späteren Zeit? Entscheidend ist
aber meines Erachtens, daß einem Künstler, wer es
auch sein mag, niemals das Recht eingeräumt werden
kann, Werke, die er der Oeffentichkeit übergeben hat,
nach eigenem Ermessen ohne Einwilligung des Eigen-
tümers zurückzuziehen.
Bei k ü n f t i g e n Verträgen wird es Sache
der Künstler sein, eine angemessene Entschädigung fü^
die Signierung besonders zu vereinbaren und die Zahl
der Künstlerdrucke festzulegen. Es kann keinem Zwei-
fel unterliegen, daß die Kunstverleger, denen ihr eigenes
Interesse gebietet, den Künstlern den Lebenskampf zu
erleichtern, zu einer solchen Lösung gern die Hand bie-
ten werden. Die Künstler können den Kunsthandel
nicht entbehren, selbst jene Auserwählten nicht, die den
von der Sonne des Erfolges vergoldeten Gipfel er-
reicht haben. Die Künstler haben umsomehr Veran-
lassung mit dem Kunsthandel verständnisvoll zusam-
menzuarbeiten, als sie von dem verarmten Stata nur
eine geringe Hilfe erwarten können und obendrein der
Gesetzgeber oft das nötige Verständnis für die In-
teressen der Kiinstler vermissen läßt.
Dies zeigte sich deutlich, als die Luxussteuer auch
auf Werke lebender oder jüngst verstorbener Künstler
gelegt wurde. Allerdings hat man diese Steuer bald
als einen Mißgriff erkannt und vom 1. Oktober 1922
ab wieder aufgehoben. Auch bei der Erbschaftssteuer
sucht man, wenn auch in bescheidenem Umfange, den
Interessen der Künstlerschaft Rechnung zu tragen.
(Vergl. 2. Steuernotverordnung vom 19. Dezember 23,
Reichsgesetzbl. 1923, Seite 1217.)
Andererseits aber wird den Künstlern ihre Existenz
wiederum durch die Einführung der A u f w a n d -
s t e u e r erschwert. Wenn man schon den Aufwand
und in Verbindung damit die Steuerpflicht nach dem
Erwerbe von Kunstgegenständen bemißt, so hätte man
im Interesse der lebenden Künstler wenigstens den
Erwerb ihrer Werke ebenso wie bei der Luxussteuer
ausnehmen müssen. Die betreffende Bestimmung im
§ 11 der 2. Steuernotverordnung vom 2. Dezember 1923
gibt auch sonst zu Bedenken und Zweifeln Veranlas-
sung. Wenti dort allgemein vom Erwerbe von Kunst-
gegenständen und Sammlungen die Rede ist, so wird
man nach dem Wortlaut und dem Sinne der Bestim-
mung jedenfalls diejenigen Fälle nicht hierzu rechnen
können, wo ein Künstler das Werk nicht veräußert,
sondern damit eine Verpflichtung erfüllt, zutn Beispiel
das Honorar eines Arztes, oder von ihm bezogene Wa-
ren damit bezählt. Es mag einer späteren Generation
vorbehalten bleiben, Betrachtungen darüber einzu-
stellen, daß es in Deutschland eine Zeit gegeben hat,
wo die Not des Staates dazu geführt 'hat, den Erwerb
von Kunstgegenständen mit der Anscbaffung von Auto-
mobilen, Luxushunden, Juwelen und der Veranstaltung
von Festen gleichzustellen.
Dct? Scbweizev jvtatcü LDÜbeltn Scbtrttd
üon
Paut tandau
jer Klärungsprozeß, der sich langsam in dem C’naos
unsrer bildenden Kunst vollzieht, sondert die
Spreu von dem Weizen. Die theoretischen Phrasen,
hinter denen sich unklares Wollen und armseliges
Nichtskönnen so gut versteckte, sind verhallt; die Kar-
tenhäuser der alle Überlieferung verachtenden Rich-
tungen verweht. Den vielzuvielen Mitläufern ist der
Atem ausgegangen und die wenigen, denen es wirk-
lich Ernst ist um die Kunst, versuchen krampfhaft,
durch Studium der Natur das nachzuholen, was sie
früher nioht nötig zu haben meinten, Es ist eine ver-
schwindend kleine Zahl unter den . Allerneuesten \
die sich „grenzenlos erdreusteten“, von denen man sa-
gen kann, daß sie die Feuerprobe dieses revolutionä-
246
druck“, denn daraus folgt ohne weiteres, daß der
Künstler Drucke, welche den billiger- und gerechter-
weise zu stellenden kiiustlerischen Ansprüchen nicht
mehr genügen, nicht zu signieren braucht. Bei Rad'ie-
rungen, besonders bei solchen mit feinern Strich, ist die
Druckfähigkeit sehr begrenzt. Nach 400 bis 500
Drucken pflegt schon eine verminderte Qualität der
Abdrucke einzutreten, sodaß man von einem Künstler-
druck nicht mehr sprechen kann, und der Kiinstler da-
her das Recht hat, die Signierung derartiger minder-
wertiger Abdrücke zu verweigern. Ebensowenig kann
sich der Kiinstler auf die veränderten wirtschaftlichen
Verhältnisse berufen, denn er hat den Gegenwert für
seine Leistung bereits vor dem Kriege, also in gutem
Gelde erhalten. Die Verpflichtung, der er jetzt noch
durch die Signierung nachkommen soll. verursacht ihm
weder Unkosten noch Zeitverlust, die als nennens-
wert zu bezeichnen wären. Wenn die Kiinstler schließ-
lich ihre Erzeugnisse einer früheren Epoche verleug-
nen und von deren Absatz auf dem Kunstmarkt eine
Schädigung ihres Rufes und Einkommens befürchten,
so stellt dies Argument die Gerichte vor eine Aufgabe,
die sie selbst mit Hilfe eines Sachverständigen nicht
lösen können, denn die Künstler verlangen damit vom
Richter eine Würdigung und Wertung ihrer Werke und
ihrer Entwicklung und machen das Forum zu einem
Areopag der Kunstgeschichte. Ist es notwendig darauf
hinzuweisen, daß es überhaupt recht zweifelhaft ist, ob
ein Künstler wirklich erst w i r d , was er ist? Werden
nicht gerade Jugendarbeiten vielfach höher gewertet
ais die Werke einer späteren Zeit? Entscheidend ist
aber meines Erachtens, daß einem Künstler, wer es
auch sein mag, niemals das Recht eingeräumt werden
kann, Werke, die er der Oeffentichkeit übergeben hat,
nach eigenem Ermessen ohne Einwilligung des Eigen-
tümers zurückzuziehen.
Bei k ü n f t i g e n Verträgen wird es Sache
der Künstler sein, eine angemessene Entschädigung fü^
die Signierung besonders zu vereinbaren und die Zahl
der Künstlerdrucke festzulegen. Es kann keinem Zwei-
fel unterliegen, daß die Kunstverleger, denen ihr eigenes
Interesse gebietet, den Künstlern den Lebenskampf zu
erleichtern, zu einer solchen Lösung gern die Hand bie-
ten werden. Die Künstler können den Kunsthandel
nicht entbehren, selbst jene Auserwählten nicht, die den
von der Sonne des Erfolges vergoldeten Gipfel er-
reicht haben. Die Künstler haben umsomehr Veran-
lassung mit dem Kunsthandel verständnisvoll zusam-
menzuarbeiten, als sie von dem verarmten Stata nur
eine geringe Hilfe erwarten können und obendrein der
Gesetzgeber oft das nötige Verständnis für die In-
teressen der Kiinstler vermissen läßt.
Dies zeigte sich deutlich, als die Luxussteuer auch
auf Werke lebender oder jüngst verstorbener Künstler
gelegt wurde. Allerdings hat man diese Steuer bald
als einen Mißgriff erkannt und vom 1. Oktober 1922
ab wieder aufgehoben. Auch bei der Erbschaftssteuer
sucht man, wenn auch in bescheidenem Umfange, den
Interessen der Künstlerschaft Rechnung zu tragen.
(Vergl. 2. Steuernotverordnung vom 19. Dezember 23,
Reichsgesetzbl. 1923, Seite 1217.)
Andererseits aber wird den Künstlern ihre Existenz
wiederum durch die Einführung der A u f w a n d -
s t e u e r erschwert. Wenn man schon den Aufwand
und in Verbindung damit die Steuerpflicht nach dem
Erwerbe von Kunstgegenständen bemißt, so hätte man
im Interesse der lebenden Künstler wenigstens den
Erwerb ihrer Werke ebenso wie bei der Luxussteuer
ausnehmen müssen. Die betreffende Bestimmung im
§ 11 der 2. Steuernotverordnung vom 2. Dezember 1923
gibt auch sonst zu Bedenken und Zweifeln Veranlas-
sung. Wenti dort allgemein vom Erwerbe von Kunst-
gegenständen und Sammlungen die Rede ist, so wird
man nach dem Wortlaut und dem Sinne der Bestim-
mung jedenfalls diejenigen Fälle nicht hierzu rechnen
können, wo ein Künstler das Werk nicht veräußert,
sondern damit eine Verpflichtung erfüllt, zutn Beispiel
das Honorar eines Arztes, oder von ihm bezogene Wa-
ren damit bezählt. Es mag einer späteren Generation
vorbehalten bleiben, Betrachtungen darüber einzu-
stellen, daß es in Deutschland eine Zeit gegeben hat,
wo die Not des Staates dazu geführt 'hat, den Erwerb
von Kunstgegenständen mit der Anscbaffung von Auto-
mobilen, Luxushunden, Juwelen und der Veranstaltung
von Festen gleichzustellen.
Dct? Scbweizev jvtatcü LDÜbeltn Scbtrttd
üon
Paut tandau
jer Klärungsprozeß, der sich langsam in dem C’naos
unsrer bildenden Kunst vollzieht, sondert die
Spreu von dem Weizen. Die theoretischen Phrasen,
hinter denen sich unklares Wollen und armseliges
Nichtskönnen so gut versteckte, sind verhallt; die Kar-
tenhäuser der alle Überlieferung verachtenden Rich-
tungen verweht. Den vielzuvielen Mitläufern ist der
Atem ausgegangen und die wenigen, denen es wirk-
lich Ernst ist um die Kunst, versuchen krampfhaft,
durch Studium der Natur das nachzuholen, was sie
früher nioht nötig zu haben meinten, Es ist eine ver-
schwindend kleine Zahl unter den . Allerneuesten \
die sich „grenzenlos erdreusteten“, von denen man sa-
gen kann, daß sie die Feuerprobe dieses revolutionä-
246