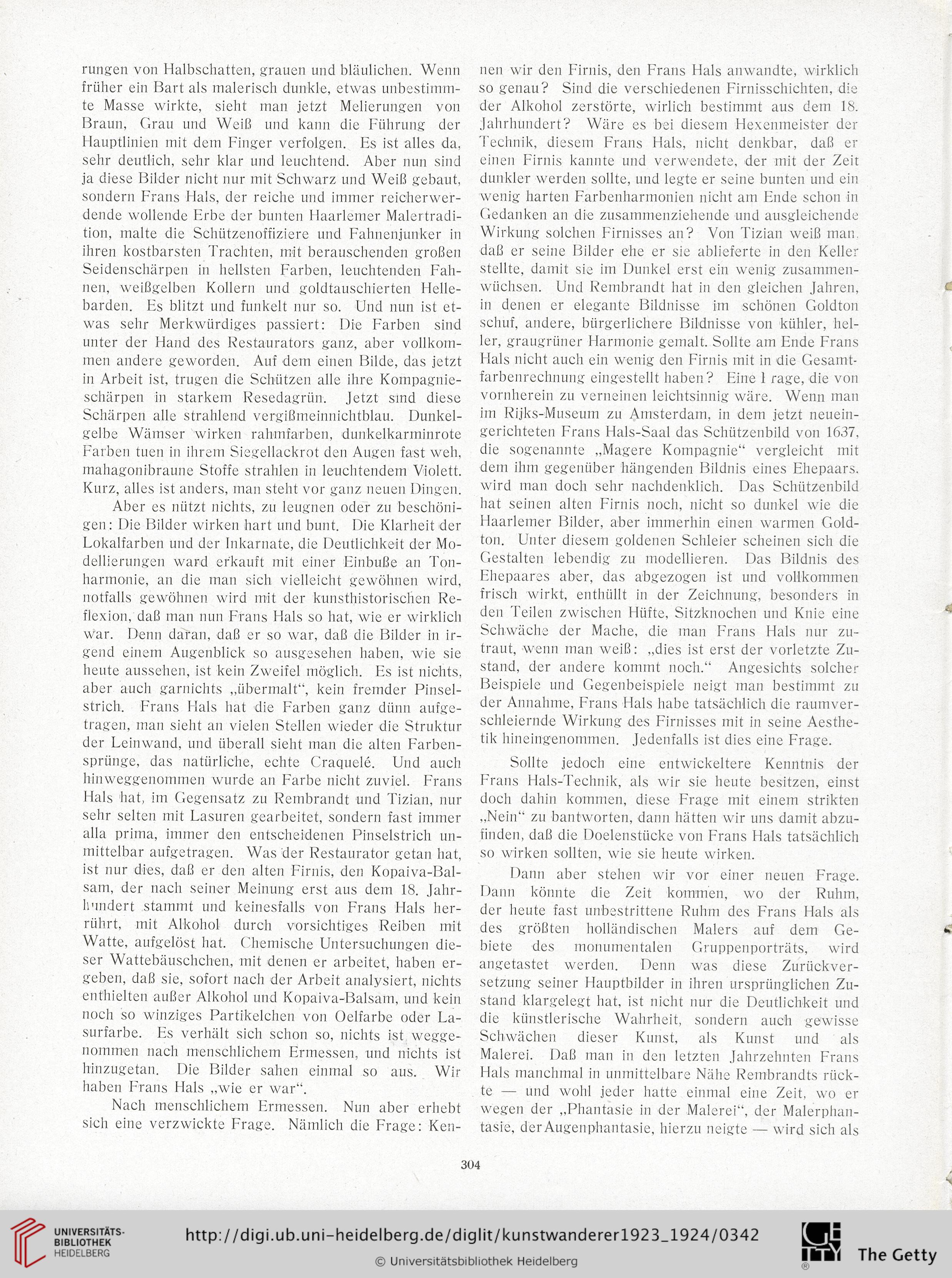rungen von Halbschatten, grauen und bläulichen. Wenn
früher ein Bart als malerisch dunkle, etwas unbestimm-
te Masse wirkte, sieht man jetzt Melierungen von
Braun, Grau und Weiß und kann die Führung der
Hauptlinien mit dem Finger verfolgen. Es ist alles da,
sehr deutlich, sehr klar und leuchtend. Aber nun sind
ja diese Bilder nicht nur mit Schwarz und Weiß gebaut,
sondern Frans Hals, der reiche und immer reicherwer-
dende wollende Erbe der bunten Haarlemer Malertradi-
tion, malte die Schützenoffiziere und Fahnenjunker in
ihren kostbarsten Trachten, mit berauschenden großen
Seidenschärpen in hellsten Farben, leuchtenden Fah-
nen, weißgelben Kollern und goldtauschierten Helle-
barden. Es blitzt und funkelt nur so. Und nun ist et-
was sehr Merkwürdiges passiert: Die Farben sind
unter der Hand des Restaurators ganz, aber vollkom-
men andere geworden. Auf dem einen Bilde, das jetzt
in Arbeit ist, trugen die Scbützen alle ihre Kompagnie-
schärpen in starkem Resedagrün. Jetzt sind diese
Schärpen alle strahlend vergißmeinnichtblau. Dunkel-
gelbe Wämser wirken rahmfarben, dunkelkarminrote
Farben tuen in ihrem Siegeliackrot den Augen fast weh,
mahagonibraune Stoffe strahlen in leuchtendem Violett.
Kurz, alles ist anders, man steht vor ganz neuen Dingen.
Aber es nützt nichts, zu leugnen oder zu beschöni-
gen: Die Bilder wirken hart und bunt. Die Klarheit der
Lokalfarben und der Inkarnate, die Deutlichkeit der Mo-
dellierungen ward er'kauft mit einer Einbuße an Ton-
harmonie, an die man sich vielleicht gewöhnen wird,
notfalls gewöhnen wird mit der kunsthistorischen Re-
flexion, daß man nun Frans Hals so hat, wie er wirklich
war. Denn däran, daß er so war, daß die Bilder in ir-
gend einem Augenblick so ausgesehen haben, wie sie
heute aussehen, ist kein Zweifel möglich. Es ist nichts,
aber auch garnichts „übermalt“, kein fremder Pinsel-
strich. Frans Hals hat die Farben ganz dünn aufge-
tragen, man sieht an vielen Stellen wieder die Struktur
der Leinwand, und überall sieht man die alten Farben-
sprünge, das natürliche, echte Craquele. Und auch
hinweggenommen wurde an Farbe nicht zuviel. Frans
Hals 'hat, im Gegensatz zu Rembrandt und Tizian, nur
sehr selten mit Lasuren gearbeitet, sondern fast immer
alla prima, immer den entscheidenen Pinselstrich un-
mittelbar aufgetragen. Was der Restaurator getan hat,
ist nur dies, daß er den alten Firnis, den Kopaiva-Bal-
sam, der nach seiner Meinung erst aus dem 18. Jahr-
hundert stammt und keinesfalls von Frans Hals her-
rührt, mit Alkohol durch vorsichtiges Reiben mit
Watte, aufgelöst hat. (ihemische Untersuchungen die-
ser Wattebäuschchen, mit denen er arbeitet, haben er-
geben, daß sie, sofort nach der Arbeit analysiert, nichts
ent'hielten außer Alkohol und Kopaiva-Balsam, und kein
noch so winziges Partikelchen von Oelfarbe oder La-
surfarbe. Es verhält sich schon so, nichts ist wegge-
nommen nacli menschlichem Ermessen, und nichts ist
hinzugetan. Die Bilder sahen einmal so aus. Wir
haben Frans Hals „wie er war“.
Nach menschlichem Ermessen. Nun aber erhebt
sich eine verzwickte Frage. Nämlich die Frage: Ken-
nen wir den Firnis, den Frans Hals anwandte, wirklich
so genau? Sind die verschiedenen Firnisschichten, die
der Alkohol zerstörte, wirlich bestimmt aus dem 18.
Jahrhundert? Wäre es bei diesem Hexenmeister der
Technik, diesem Frans Hals, nicht denkbar, daß er
einen Firnis kannte und verwendete, der mit der Zeit
dunkler werden sollte, und legte er seine bunten und ein
wenig harten Farbenharmonien nicht am Ende schon in
Gedanken an die zusammenziehende und ausgleichende
Wirkung solchen Firnisses an? Von Tizian weiß man,
daß er seine Bilder ehe er sie ablieferte in den Keller
stellte, damit sie im Dunkel erst ein wenig zusammen-
wüchsen. Und Rembrandt hat in den gleichen Jahren,
in denen er elegante Bildnisse im schönen Goldton
schuf, andere, biirgerlichere Bildnisse von kühler, hel-
ler, graugrüner Harmonie gemalt. Sollte am Ende Frans
Hals nicht auch ein wenig den Firnis mit in die Gesamt-
farbenrechnung eingestej.lt haben? Eine 1 rage, die von
vornherein zu verneinen leichtsinnig wäre. Wenn man
im Rijks-Museum zu Amsterdam, in dem jetzt neuein-
gerichteten Frans Hals-Saal das Schützenbild von 1637,
die sogenannte „Magere Kompagnie“ vergleicht mit
dem ihm gegenüber hängenden Bildnis eines Ehepaars.
wird man doch sehr nachdenklich. Das Schützenbild
hat seinen alten Firnis noch, nicht so dunkel wie die
Haarlemer Bilder, aber immerhin einen warmen Gold-
ton. Unter diesem goldenen Schleier scheinen sich die
Gestalten lebendig zu modellieren. Das Bildnis des
Ehepaares aber, das abgezogen ist und vollkommen
frisch wirkt, enthüllt in der Zeichnung, besonders in
den Teilen zwischen Hüfte, Sitzknochen und Knie eine
Schwäche der Mache, die man Frans Hals nur zu-
traut, wenn man weiß: „dies ist erst der vorletzte Zu-
stand, der andere kommt noch.“ Angesichts solcher
Beispiele und Gegenbeispiele neigt man bestimmt zu
der Annahme, Frans Hals habe tatsächlich die raumver-
schleiernde Wirkung des Firnisses mit in seine Aesthe-
tik hineingenommen. Jedenfalls ist dies eine Frage.
Sollte jedoch eine entwickeltere Kenntnis der
Frans Hals-Technik, als wir sie heute besitzen, einst
doch dahin kommen, diese Frage mit einem strikten
„Nein“ zu bantworten, dann hätten wir uns damit abzu-
finden, daß die Doelenstücke von Frans Hals tatsächlich
so wirken sollten, wie sie heute wirken.
Dann aber stehen wir vor einer neuen Frage.
Dann könnte die Zeit kommen, wo der Ruhm,
der lieute fast unbestrittene Rulmi des Frans Hals als
des größten holländischen Malers auf dem Ge-
biete des monumentalen Gruppenporträts, wird
angetastet werden. Denn was diese Zurückver-
setzung seiner Hauptbilder in ihren ursprünglichen Zu-
stand klargelegt hat, ist nicht nur die Deutlichkeit und
die künstlerische Wahrheit, sondern auch gewisse
Schwächen dieser Kunst, als Kunst und als
Malerei. Daß man in den letzten Jahrzehnten Frans
Hals manchmal in unmittelbare Nähe Rembrandts rück-
te — und wohl jeder hatte einmal eine Zeit, wo er
wegen der „Phantasie in der Malerei“, der Malerphan-
tasie, derAugenphantasie, hierzu neigte — wird sich als
3Ü4
früher ein Bart als malerisch dunkle, etwas unbestimm-
te Masse wirkte, sieht man jetzt Melierungen von
Braun, Grau und Weiß und kann die Führung der
Hauptlinien mit dem Finger verfolgen. Es ist alles da,
sehr deutlich, sehr klar und leuchtend. Aber nun sind
ja diese Bilder nicht nur mit Schwarz und Weiß gebaut,
sondern Frans Hals, der reiche und immer reicherwer-
dende wollende Erbe der bunten Haarlemer Malertradi-
tion, malte die Schützenoffiziere und Fahnenjunker in
ihren kostbarsten Trachten, mit berauschenden großen
Seidenschärpen in hellsten Farben, leuchtenden Fah-
nen, weißgelben Kollern und goldtauschierten Helle-
barden. Es blitzt und funkelt nur so. Und nun ist et-
was sehr Merkwürdiges passiert: Die Farben sind
unter der Hand des Restaurators ganz, aber vollkom-
men andere geworden. Auf dem einen Bilde, das jetzt
in Arbeit ist, trugen die Scbützen alle ihre Kompagnie-
schärpen in starkem Resedagrün. Jetzt sind diese
Schärpen alle strahlend vergißmeinnichtblau. Dunkel-
gelbe Wämser wirken rahmfarben, dunkelkarminrote
Farben tuen in ihrem Siegeliackrot den Augen fast weh,
mahagonibraune Stoffe strahlen in leuchtendem Violett.
Kurz, alles ist anders, man steht vor ganz neuen Dingen.
Aber es nützt nichts, zu leugnen oder zu beschöni-
gen: Die Bilder wirken hart und bunt. Die Klarheit der
Lokalfarben und der Inkarnate, die Deutlichkeit der Mo-
dellierungen ward er'kauft mit einer Einbuße an Ton-
harmonie, an die man sich vielleicht gewöhnen wird,
notfalls gewöhnen wird mit der kunsthistorischen Re-
flexion, daß man nun Frans Hals so hat, wie er wirklich
war. Denn däran, daß er so war, daß die Bilder in ir-
gend einem Augenblick so ausgesehen haben, wie sie
heute aussehen, ist kein Zweifel möglich. Es ist nichts,
aber auch garnichts „übermalt“, kein fremder Pinsel-
strich. Frans Hals hat die Farben ganz dünn aufge-
tragen, man sieht an vielen Stellen wieder die Struktur
der Leinwand, und überall sieht man die alten Farben-
sprünge, das natürliche, echte Craquele. Und auch
hinweggenommen wurde an Farbe nicht zuviel. Frans
Hals 'hat, im Gegensatz zu Rembrandt und Tizian, nur
sehr selten mit Lasuren gearbeitet, sondern fast immer
alla prima, immer den entscheidenen Pinselstrich un-
mittelbar aufgetragen. Was der Restaurator getan hat,
ist nur dies, daß er den alten Firnis, den Kopaiva-Bal-
sam, der nach seiner Meinung erst aus dem 18. Jahr-
hundert stammt und keinesfalls von Frans Hals her-
rührt, mit Alkohol durch vorsichtiges Reiben mit
Watte, aufgelöst hat. (ihemische Untersuchungen die-
ser Wattebäuschchen, mit denen er arbeitet, haben er-
geben, daß sie, sofort nach der Arbeit analysiert, nichts
ent'hielten außer Alkohol und Kopaiva-Balsam, und kein
noch so winziges Partikelchen von Oelfarbe oder La-
surfarbe. Es verhält sich schon so, nichts ist wegge-
nommen nacli menschlichem Ermessen, und nichts ist
hinzugetan. Die Bilder sahen einmal so aus. Wir
haben Frans Hals „wie er war“.
Nach menschlichem Ermessen. Nun aber erhebt
sich eine verzwickte Frage. Nämlich die Frage: Ken-
nen wir den Firnis, den Frans Hals anwandte, wirklich
so genau? Sind die verschiedenen Firnisschichten, die
der Alkohol zerstörte, wirlich bestimmt aus dem 18.
Jahrhundert? Wäre es bei diesem Hexenmeister der
Technik, diesem Frans Hals, nicht denkbar, daß er
einen Firnis kannte und verwendete, der mit der Zeit
dunkler werden sollte, und legte er seine bunten und ein
wenig harten Farbenharmonien nicht am Ende schon in
Gedanken an die zusammenziehende und ausgleichende
Wirkung solchen Firnisses an? Von Tizian weiß man,
daß er seine Bilder ehe er sie ablieferte in den Keller
stellte, damit sie im Dunkel erst ein wenig zusammen-
wüchsen. Und Rembrandt hat in den gleichen Jahren,
in denen er elegante Bildnisse im schönen Goldton
schuf, andere, biirgerlichere Bildnisse von kühler, hel-
ler, graugrüner Harmonie gemalt. Sollte am Ende Frans
Hals nicht auch ein wenig den Firnis mit in die Gesamt-
farbenrechnung eingestej.lt haben? Eine 1 rage, die von
vornherein zu verneinen leichtsinnig wäre. Wenn man
im Rijks-Museum zu Amsterdam, in dem jetzt neuein-
gerichteten Frans Hals-Saal das Schützenbild von 1637,
die sogenannte „Magere Kompagnie“ vergleicht mit
dem ihm gegenüber hängenden Bildnis eines Ehepaars.
wird man doch sehr nachdenklich. Das Schützenbild
hat seinen alten Firnis noch, nicht so dunkel wie die
Haarlemer Bilder, aber immerhin einen warmen Gold-
ton. Unter diesem goldenen Schleier scheinen sich die
Gestalten lebendig zu modellieren. Das Bildnis des
Ehepaares aber, das abgezogen ist und vollkommen
frisch wirkt, enthüllt in der Zeichnung, besonders in
den Teilen zwischen Hüfte, Sitzknochen und Knie eine
Schwäche der Mache, die man Frans Hals nur zu-
traut, wenn man weiß: „dies ist erst der vorletzte Zu-
stand, der andere kommt noch.“ Angesichts solcher
Beispiele und Gegenbeispiele neigt man bestimmt zu
der Annahme, Frans Hals habe tatsächlich die raumver-
schleiernde Wirkung des Firnisses mit in seine Aesthe-
tik hineingenommen. Jedenfalls ist dies eine Frage.
Sollte jedoch eine entwickeltere Kenntnis der
Frans Hals-Technik, als wir sie heute besitzen, einst
doch dahin kommen, diese Frage mit einem strikten
„Nein“ zu bantworten, dann hätten wir uns damit abzu-
finden, daß die Doelenstücke von Frans Hals tatsächlich
so wirken sollten, wie sie heute wirken.
Dann aber stehen wir vor einer neuen Frage.
Dann könnte die Zeit kommen, wo der Ruhm,
der lieute fast unbestrittene Rulmi des Frans Hals als
des größten holländischen Malers auf dem Ge-
biete des monumentalen Gruppenporträts, wird
angetastet werden. Denn was diese Zurückver-
setzung seiner Hauptbilder in ihren ursprünglichen Zu-
stand klargelegt hat, ist nicht nur die Deutlichkeit und
die künstlerische Wahrheit, sondern auch gewisse
Schwächen dieser Kunst, als Kunst und als
Malerei. Daß man in den letzten Jahrzehnten Frans
Hals manchmal in unmittelbare Nähe Rembrandts rück-
te — und wohl jeder hatte einmal eine Zeit, wo er
wegen der „Phantasie in der Malerei“, der Malerphan-
tasie, derAugenphantasie, hierzu neigte — wird sich als
3Ü4