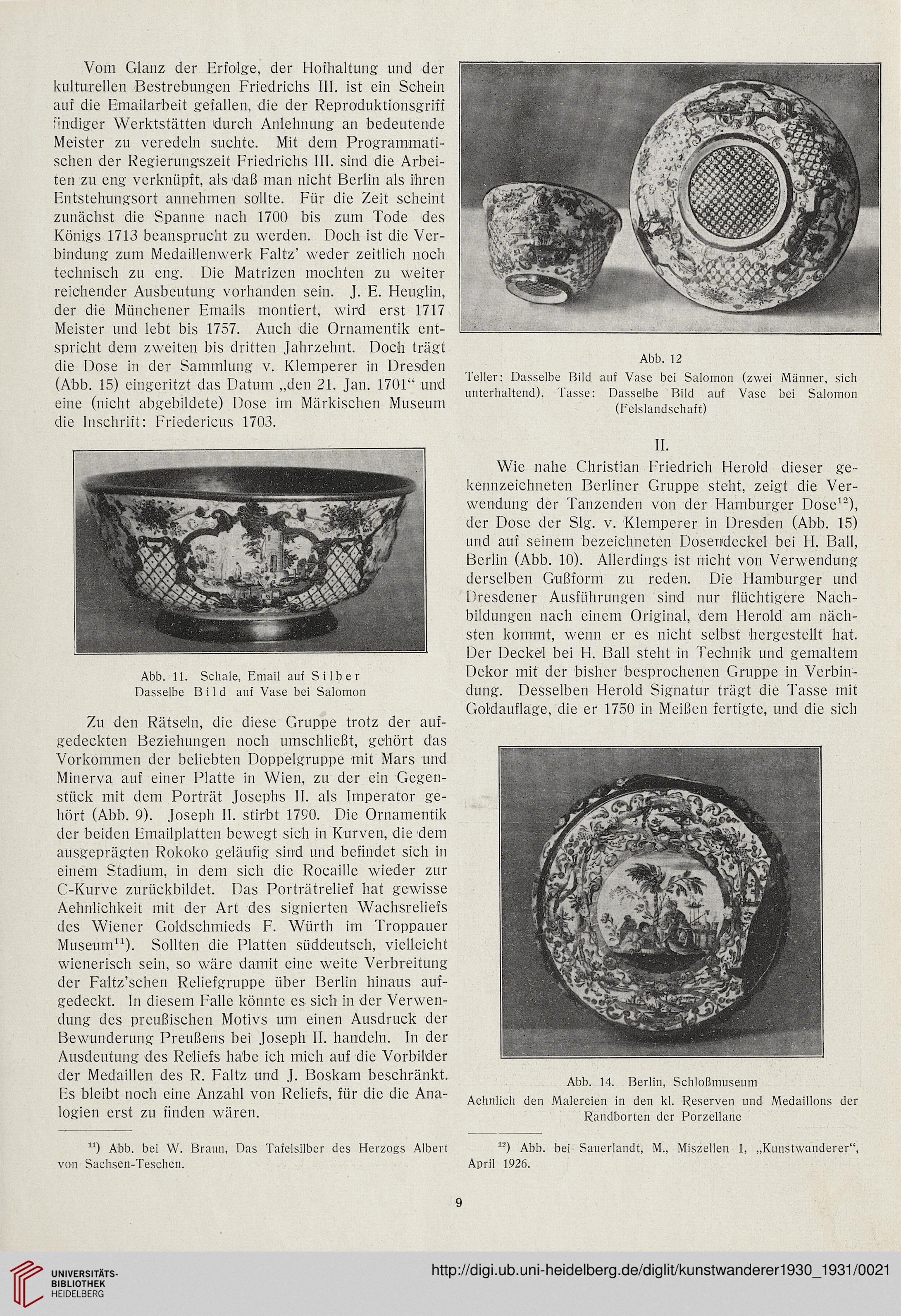Vom Glanz der Erfoige, der Hofhaltung und der
kulturellen Bestrebungen Friedrichs III. ist ein Schein
auf die Emailarbeit gefallen, die der Reproduktionsgriff
findiger Werktstätten durch Anlehnung an bedeutende
Meister zu veredeln suchte. Mit dem Programmati-
schen der Regierungszeit Friedrichs III. sind die Arbei-
ten zu eng verknüpft, als daß man nicht Berlin als ihren
Entstehungsort annehmen sollte. Für die Zeit scheint
zunächst die Spanne nach 1700 bis zum Tode des
Königs 1713 beansprucht zu werden. Doch ist die Ver-
bindung zum Medaillenwerk Faltz’ weder zeitlich noch
technisch zu eng. Die Matrizen mochten zu weiter
reichender Ausbeutung vorhanden sein. J. E. Heuglin,
der die Münchener Emails montiert, wird erst 1717
Meister und lebt bis 1757. Auch die Ornamentik ent-
spricht dem zweiten bis dritten Jahrzehnt. Doch trägt
die Dose in der Sammlung v. Klemperer in Dresden
(Abb. 15) eingeritzt das Datum „den 21. Jan. 1701“ und
eine (nicht abgebildete) Dose im Märkischen Museum
die Inschrift: Friedericus 1703.
Abb. 11. Schale, Email auf Silber
Dasselbe B i 1 d auf Vase bei Salomon
Zu den Rätsetn, die diese Gruppe trotz der auf-
gedeckten Beziehungen noch umschtießt, gehört das
Vorkommen der beliebten Doppelgruppe mit Mars und
Minerva auf einer Platte in Wien, zu der ein Gegen-
stück mit dem Porträt Josephs II. als Imperator ge-
liört (Abb. 9). Joseph II. stir'bt 1790. Die Ornamentik
der beiden Emailplatten bewegt sich in Kurven, die dem
ausgeprägten Rokoko geläufig sind und befindet sich in
einem Stadium, in dem sich die Rocaille wieder zur
C-Kurve zurückbildet. Das Porträtrelief hat gewisse
Aehnlichkeit mit der Art des signierten Wachsreliefs
des Wiener Goldschmieds F. Würth im Troppauer
Museum11). Sollten die Platten süddeutsch, vielleicht
wienerisch sein, so wäre damit eine weite Verbreitung
der Faltz’schen Reliefgruppe über Berlin hinaus auf-
gedeckt. In diesem Falle könnte es sich in dcr Verwen-
dung des preußischen Motivs um einen Ausdruck der
Bewunderung Preußens bei Joseph II. handeln. In der
Ausdeutung des Reliefs ha'be ich mich auf die Vorbilder
der Medaillen des R. Faltz und J. Boskam beschränkt.
Fs bleibt noch eine Anzahl von Reliefs, für die die Ana-
logien erst zu finden wären.
u) Abb. bei W. Braun, Das Tafelsilber des Herzogs Albert
von Sachsen-Teschen.
Abb. 12
Teller: Dasselbe Bild auf Vase bei Salomon (zwei Männer, sicli
unterhaltend). Tasse: Dasselbe Bild auf Vase bei Salomon
(Felslandschaft)
II.
Wie nahe Christian Friedrich Herold dieser ge-
kennzeichneten Berliner Gruppe steht, zeigt die Ver-
wendung der Tanzenden von der Hamburger Dose12),
der Dose der Slg. v. Klemperer in Dresden (Abb. 15)
und auf seinem bezeichneten Doserrdeckel bei H. Ball,
Berlin (Abb. 10). Allerdings ist nicht von Verwendung
derselben Gußform zu reden. Die Hamburger und
Dresdener Ausftihrungen sind nur flüchtigere Nach-
bildungen nach einem Original, dem Herold am näch-
sten kommt, wenn er es nicht selbst hergestellt hat.
Der Deckel bei H. Ball steht in Technik und gemaltem
Dekor mit der bisher besprochenen Gruppe in Verbin-
dung. Desselben Herold Signatur trägt die Tasse mit
Goldauflage, die er 1750 in Meißen fertigte, und die sich
Abb. 14. Berlin, Schloßmuseum
Aehnlich den Malereien in den kl. Reserven und Medaillons der
Randborten der Porzellane
12) Abb. bei Sauerlandt, M., Miszellen 1, „Kunstwanderer“,
April 1926.
9
kulturellen Bestrebungen Friedrichs III. ist ein Schein
auf die Emailarbeit gefallen, die der Reproduktionsgriff
findiger Werktstätten durch Anlehnung an bedeutende
Meister zu veredeln suchte. Mit dem Programmati-
schen der Regierungszeit Friedrichs III. sind die Arbei-
ten zu eng verknüpft, als daß man nicht Berlin als ihren
Entstehungsort annehmen sollte. Für die Zeit scheint
zunächst die Spanne nach 1700 bis zum Tode des
Königs 1713 beansprucht zu werden. Doch ist die Ver-
bindung zum Medaillenwerk Faltz’ weder zeitlich noch
technisch zu eng. Die Matrizen mochten zu weiter
reichender Ausbeutung vorhanden sein. J. E. Heuglin,
der die Münchener Emails montiert, wird erst 1717
Meister und lebt bis 1757. Auch die Ornamentik ent-
spricht dem zweiten bis dritten Jahrzehnt. Doch trägt
die Dose in der Sammlung v. Klemperer in Dresden
(Abb. 15) eingeritzt das Datum „den 21. Jan. 1701“ und
eine (nicht abgebildete) Dose im Märkischen Museum
die Inschrift: Friedericus 1703.
Abb. 11. Schale, Email auf Silber
Dasselbe B i 1 d auf Vase bei Salomon
Zu den Rätsetn, die diese Gruppe trotz der auf-
gedeckten Beziehungen noch umschtießt, gehört das
Vorkommen der beliebten Doppelgruppe mit Mars und
Minerva auf einer Platte in Wien, zu der ein Gegen-
stück mit dem Porträt Josephs II. als Imperator ge-
liört (Abb. 9). Joseph II. stir'bt 1790. Die Ornamentik
der beiden Emailplatten bewegt sich in Kurven, die dem
ausgeprägten Rokoko geläufig sind und befindet sich in
einem Stadium, in dem sich die Rocaille wieder zur
C-Kurve zurückbildet. Das Porträtrelief hat gewisse
Aehnlichkeit mit der Art des signierten Wachsreliefs
des Wiener Goldschmieds F. Würth im Troppauer
Museum11). Sollten die Platten süddeutsch, vielleicht
wienerisch sein, so wäre damit eine weite Verbreitung
der Faltz’schen Reliefgruppe über Berlin hinaus auf-
gedeckt. In diesem Falle könnte es sich in dcr Verwen-
dung des preußischen Motivs um einen Ausdruck der
Bewunderung Preußens bei Joseph II. handeln. In der
Ausdeutung des Reliefs ha'be ich mich auf die Vorbilder
der Medaillen des R. Faltz und J. Boskam beschränkt.
Fs bleibt noch eine Anzahl von Reliefs, für die die Ana-
logien erst zu finden wären.
u) Abb. bei W. Braun, Das Tafelsilber des Herzogs Albert
von Sachsen-Teschen.
Abb. 12
Teller: Dasselbe Bild auf Vase bei Salomon (zwei Männer, sicli
unterhaltend). Tasse: Dasselbe Bild auf Vase bei Salomon
(Felslandschaft)
II.
Wie nahe Christian Friedrich Herold dieser ge-
kennzeichneten Berliner Gruppe steht, zeigt die Ver-
wendung der Tanzenden von der Hamburger Dose12),
der Dose der Slg. v. Klemperer in Dresden (Abb. 15)
und auf seinem bezeichneten Doserrdeckel bei H. Ball,
Berlin (Abb. 10). Allerdings ist nicht von Verwendung
derselben Gußform zu reden. Die Hamburger und
Dresdener Ausftihrungen sind nur flüchtigere Nach-
bildungen nach einem Original, dem Herold am näch-
sten kommt, wenn er es nicht selbst hergestellt hat.
Der Deckel bei H. Ball steht in Technik und gemaltem
Dekor mit der bisher besprochenen Gruppe in Verbin-
dung. Desselben Herold Signatur trägt die Tasse mit
Goldauflage, die er 1750 in Meißen fertigte, und die sich
Abb. 14. Berlin, Schloßmuseum
Aehnlich den Malereien in den kl. Reserven und Medaillons der
Randborten der Porzellane
12) Abb. bei Sauerlandt, M., Miszellen 1, „Kunstwanderer“,
April 1926.
9