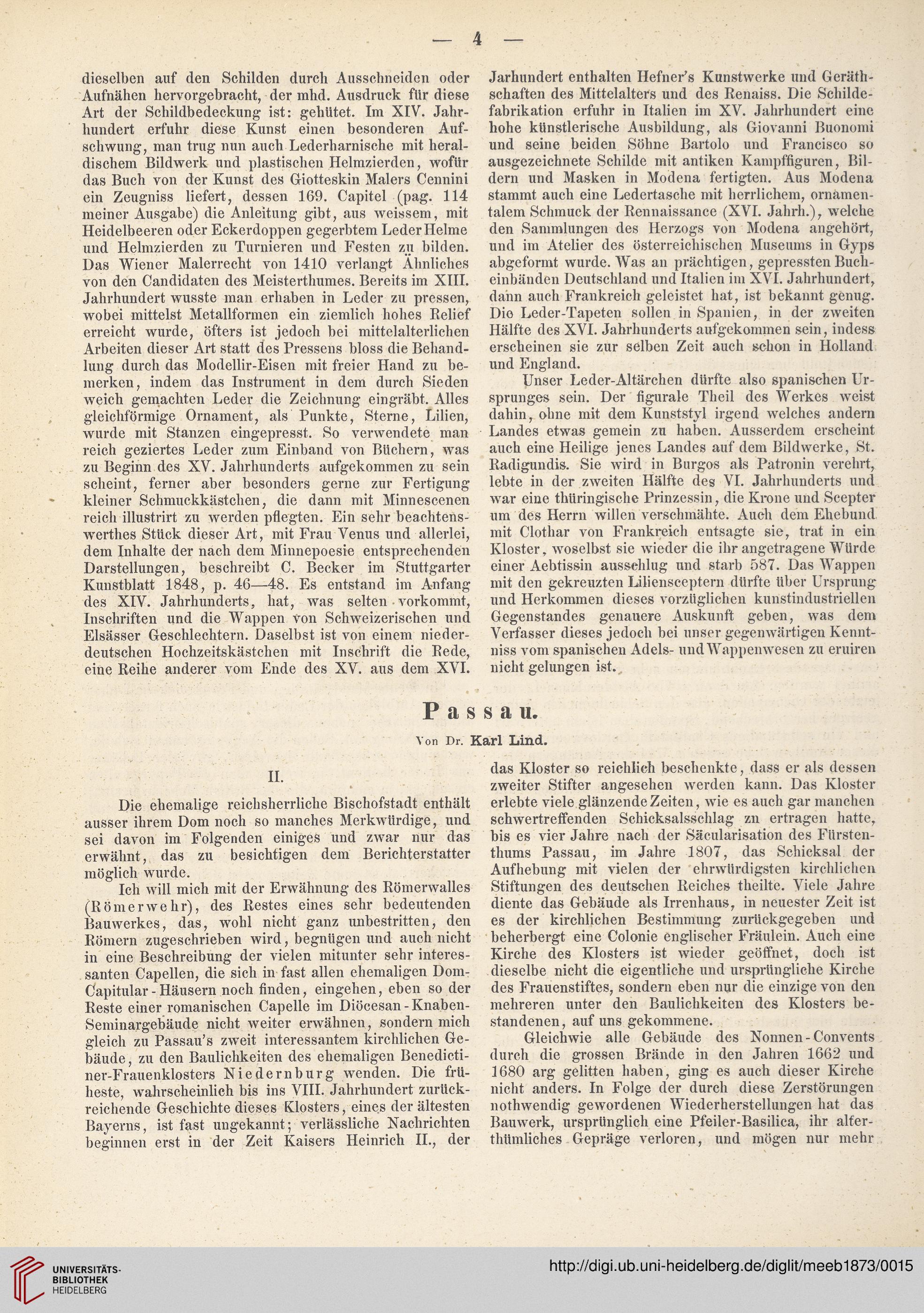dieselben auf den Schilden durch Ausschneiden oder
Aufnähen hervorgebracht, der rnlid. Ausdruck für diese
Art der Schildbedeckung ist: gehütet. Im XIV. Jahr-
hundert erfuhr diese Kunst einen besonderen Auf-
schwung, man trug nun auch Lederharnische mit heral-
dischem Bildwerk und plastischen Helmzierden, wofür
das Buch von der Kunst des Giotteskin Malers Cennini
ein Zeugniss liefert, dessen 169. Capitel (pag. 114
meiner Ausgabe) die Anleitung gibt, aus weissem, mit
Heidelbeeren oder Eckerdoppen gegerbtem Leder Helme
und Helmzierden zu Turnieren und Festen zu bilden.
Das Wiener Malerrecht von 1410 verlangt Ähnliches
von den Candidaten des Meisterthumes. Bereits im XIII.
Jahrhundert wusste man erhaben in Leder zu pressen,
wobei mittelst Metallformen ein ziemlich hohes Relief
erreicht wurde, öfters ist jedoch bei mittelalterlichen
Arbeiten dieser Art statt des Pressens bloss die Behand-
lung durch das Modellir-Eisen mit freier Hand zu be-
merken, indem das Instrument in dem durch Sieden
weich gemachten Leder die Zeichnung eingräbt. Alles
gleichförmige Ornament, als Punkte, Sterne, Lilien,
wurde mit Stanzen eingepresst. So verwendete man
reich geziertes Leder zum Einband von Büchern, was
zu Beginn des XV. Jahrhunderts aufgekommen zu sein
scheint, ferner aber besonders gerne zur Fertigung
kleiner Schmuckkästchen, die dann mit Minnescenen
reich illustrirt zu werden pflegten. Ein sehr beachtens-
werthes Stück dieser Art, mit Frau Venus und allerlei,
dem Inhalte der nach dem Minnepoesie entsprechenden
Darstellungen, beschreibt C. Becker im Stuttgarter
Kunstblatt 1848, p. 46—48. Es entstand im Anfang
des XIV. Jahrhunderts, hat, was selten vorkommt,
Inschriften und die Wappen von Schweizerischen und
Elsässer Geschlechtern. Daselbst ist von einem nieder-
deutschen Hochzeitskästchen mit Inschrift die Rede,
eine Reihe anderer vom Ende des XV. aus dem XVI.
Jarhundert enthalten Hefner's Kunstwerke und Gerätli-
schaften des Mittelalters und des Renaiss. Die Schilde-
fabrikation erfuhr in Italien im XV. Jahrhundert eine
hohe künstlerische Ausbildung, als Giovanni Buonomi
und seine beiden Söhne Bartolo und Francisco so
ausgezeichnete Schilde mit antiken Kampffiguren, Bil-
dern und Masken in Modena fertigten. Aus Modena
stammt auch eine Ledertasche mit herrlichem, ornamen-
talem Schmuck der Rennaissance (XVI. Jahrh.), welche
den Sammlungen des Herzogs von Modena angehört,
und im Atelier des österreichischen Museums in Gyps
abgeformt wurde. Was an prächtigen, gepressten Buch-
einbänden Deutschland und Italien im XVI. Jahrhundert,
dann auch Frankreich geleistet hat, ist bekannt genug.
Die Leder-Tapeten sollen in Spanien, in der zweiten
Hälfte des XVI. Jahrhunderts aufgekommen sein, indess
erscheinen sie zur selben Zeit auch schon in Holland
und England.
Unser Leder-Altärchen dürfte also spanischen Ur-
sprunges sein. Der figurale Theil des Werkes weist
dahin, ohne mit dem Kunststyl irgend welches andern
Landes etwas gemein zu haben. Ausserdem erscheint
auch eine Heilige jenes Landes auf dem Bildwerke, St.
Radigundis. Sie wird in Burgos als Patronin verehrt,
lebte in der zweiten Hälfte des VI. Jahrhunderts und
war eine thüringische Prinzessin, die Krone und Scepter
um des Herrn willen verschmähte. Auch dem Ehebund
mit Clothar von Frankreich entsagte sie, trat in ein
Kloster, woselbst sie wieder die ihr angetragene Würde
einer Aebtissin aussehlug und starb 587. Das Wappen
mit den gekreuzten Liliensceptern dürfte über Ursprung
und Herkommen dieses vorzüglichen kunstindustriellen
Gegenstandes genauere Auskunft geben, was dem
Verfasser dieses jedoch bei unser gegenwärtigen Kennt-
niss vom spanischen Adels- und Wappenwesen zu eruiren
nicht gelungen ist.
P a s s a u
Von Dr. Karl Lind.
II.
Die ehemalige reichsherrliche Bischofstadt enthält
ausser ihrem Dom noch so manches Merkwürdige, und
sei davon im Folgenden einiges und zwar nur das
erwähnt, das zu besichtigen dem Berichterstatter
möglich wurde.
Ich will mich mit der Erwähnung des Römerwalles
(Römerwehr), des Restes eines sehr bedeutenden
Bauwerkes, das, wohl nicht ganz unbestritten, den
Römern zugeschrieben wird, begnügen und auch nicht
in eine Beschreibung der vielen mitunter sehr interes-
santen Capellen, die sich in fast allen ehemaligen Dom-
Capitular - Häusern noch finden, eingehen, eben so der
Reste einer romanischen Capelle im Diöcesan - Knaben-
Seminargebäude nicht weiter erwähnen, sondern mich
gleich zu Passau’s zweit interessantem kirchlichen Ge-
bäude, zu den Baulichkeiten des ehemaligen Benedicti-
ner-Frauenklosters Niedern bürg wenden. Die frü-
heste, wahrscheinlich bis ins VIII. Jahrhundert zurttek-
reichende Geschichte dieses Klosters, eines der ältesten
Bayerns, ist fast ungekannt; verlässliche Nachrichten
beginnen erst in der Zeit Kaisers Heinrich II., der
das Kloster so reichlich beschenkte, dass er als dessen
zweiter Stifter angesehen werden kann. Das Kloster
erlebte viele glänzende Zeiten, wie es auch gar manchen
schwertreffenden Schicksalsschlag zn ertragen hatte,
bis es vier Jahre nach der Säcularisation des Fürsten-
thums Passau, im Jahre 1807, das Schicksal der
Aufhebung mit vielen der ehrwürdigsten kirchlichen
Stiftungen des deutschen Reiches theilte. Viele Jahre
diente das Gebäude als Irrenhaus, in neuester Zeit ist
es der kirchlichen Bestimmung zurückgegeben und
beherbergt eine Colonie englischer Fräulein. Auch eine
Kirche des Klosters ist wieder geöffnet, doch ist
dieselbe nicht die eigentliche und ursprüngliche Kirche
des Frauenstiftes, sondern eben nur die einzige von den
mehreren unter den Baulichkeiten des Klosters be-
standenen, auf uns gekommene.
Gleichwie alle Gebäude des Nonnen - Convents
durch die grossen Brände in den Jahren 1662 und
1680 arg gelitten haben, ging es auch dieser Kirche
nicht anders. In Folge der durch diese Zerstörungen
nothwendig gewordenen Wiederherstellungen hat das
Bauwerk, ursprünglich eine Pfeiler-Basilica, ihr alfer-
thümliches Gepräge verloren, und mögen nur mehr
Aufnähen hervorgebracht, der rnlid. Ausdruck für diese
Art der Schildbedeckung ist: gehütet. Im XIV. Jahr-
hundert erfuhr diese Kunst einen besonderen Auf-
schwung, man trug nun auch Lederharnische mit heral-
dischem Bildwerk und plastischen Helmzierden, wofür
das Buch von der Kunst des Giotteskin Malers Cennini
ein Zeugniss liefert, dessen 169. Capitel (pag. 114
meiner Ausgabe) die Anleitung gibt, aus weissem, mit
Heidelbeeren oder Eckerdoppen gegerbtem Leder Helme
und Helmzierden zu Turnieren und Festen zu bilden.
Das Wiener Malerrecht von 1410 verlangt Ähnliches
von den Candidaten des Meisterthumes. Bereits im XIII.
Jahrhundert wusste man erhaben in Leder zu pressen,
wobei mittelst Metallformen ein ziemlich hohes Relief
erreicht wurde, öfters ist jedoch bei mittelalterlichen
Arbeiten dieser Art statt des Pressens bloss die Behand-
lung durch das Modellir-Eisen mit freier Hand zu be-
merken, indem das Instrument in dem durch Sieden
weich gemachten Leder die Zeichnung eingräbt. Alles
gleichförmige Ornament, als Punkte, Sterne, Lilien,
wurde mit Stanzen eingepresst. So verwendete man
reich geziertes Leder zum Einband von Büchern, was
zu Beginn des XV. Jahrhunderts aufgekommen zu sein
scheint, ferner aber besonders gerne zur Fertigung
kleiner Schmuckkästchen, die dann mit Minnescenen
reich illustrirt zu werden pflegten. Ein sehr beachtens-
werthes Stück dieser Art, mit Frau Venus und allerlei,
dem Inhalte der nach dem Minnepoesie entsprechenden
Darstellungen, beschreibt C. Becker im Stuttgarter
Kunstblatt 1848, p. 46—48. Es entstand im Anfang
des XIV. Jahrhunderts, hat, was selten vorkommt,
Inschriften und die Wappen von Schweizerischen und
Elsässer Geschlechtern. Daselbst ist von einem nieder-
deutschen Hochzeitskästchen mit Inschrift die Rede,
eine Reihe anderer vom Ende des XV. aus dem XVI.
Jarhundert enthalten Hefner's Kunstwerke und Gerätli-
schaften des Mittelalters und des Renaiss. Die Schilde-
fabrikation erfuhr in Italien im XV. Jahrhundert eine
hohe künstlerische Ausbildung, als Giovanni Buonomi
und seine beiden Söhne Bartolo und Francisco so
ausgezeichnete Schilde mit antiken Kampffiguren, Bil-
dern und Masken in Modena fertigten. Aus Modena
stammt auch eine Ledertasche mit herrlichem, ornamen-
talem Schmuck der Rennaissance (XVI. Jahrh.), welche
den Sammlungen des Herzogs von Modena angehört,
und im Atelier des österreichischen Museums in Gyps
abgeformt wurde. Was an prächtigen, gepressten Buch-
einbänden Deutschland und Italien im XVI. Jahrhundert,
dann auch Frankreich geleistet hat, ist bekannt genug.
Die Leder-Tapeten sollen in Spanien, in der zweiten
Hälfte des XVI. Jahrhunderts aufgekommen sein, indess
erscheinen sie zur selben Zeit auch schon in Holland
und England.
Unser Leder-Altärchen dürfte also spanischen Ur-
sprunges sein. Der figurale Theil des Werkes weist
dahin, ohne mit dem Kunststyl irgend welches andern
Landes etwas gemein zu haben. Ausserdem erscheint
auch eine Heilige jenes Landes auf dem Bildwerke, St.
Radigundis. Sie wird in Burgos als Patronin verehrt,
lebte in der zweiten Hälfte des VI. Jahrhunderts und
war eine thüringische Prinzessin, die Krone und Scepter
um des Herrn willen verschmähte. Auch dem Ehebund
mit Clothar von Frankreich entsagte sie, trat in ein
Kloster, woselbst sie wieder die ihr angetragene Würde
einer Aebtissin aussehlug und starb 587. Das Wappen
mit den gekreuzten Liliensceptern dürfte über Ursprung
und Herkommen dieses vorzüglichen kunstindustriellen
Gegenstandes genauere Auskunft geben, was dem
Verfasser dieses jedoch bei unser gegenwärtigen Kennt-
niss vom spanischen Adels- und Wappenwesen zu eruiren
nicht gelungen ist.
P a s s a u
Von Dr. Karl Lind.
II.
Die ehemalige reichsherrliche Bischofstadt enthält
ausser ihrem Dom noch so manches Merkwürdige, und
sei davon im Folgenden einiges und zwar nur das
erwähnt, das zu besichtigen dem Berichterstatter
möglich wurde.
Ich will mich mit der Erwähnung des Römerwalles
(Römerwehr), des Restes eines sehr bedeutenden
Bauwerkes, das, wohl nicht ganz unbestritten, den
Römern zugeschrieben wird, begnügen und auch nicht
in eine Beschreibung der vielen mitunter sehr interes-
santen Capellen, die sich in fast allen ehemaligen Dom-
Capitular - Häusern noch finden, eingehen, eben so der
Reste einer romanischen Capelle im Diöcesan - Knaben-
Seminargebäude nicht weiter erwähnen, sondern mich
gleich zu Passau’s zweit interessantem kirchlichen Ge-
bäude, zu den Baulichkeiten des ehemaligen Benedicti-
ner-Frauenklosters Niedern bürg wenden. Die frü-
heste, wahrscheinlich bis ins VIII. Jahrhundert zurttek-
reichende Geschichte dieses Klosters, eines der ältesten
Bayerns, ist fast ungekannt; verlässliche Nachrichten
beginnen erst in der Zeit Kaisers Heinrich II., der
das Kloster so reichlich beschenkte, dass er als dessen
zweiter Stifter angesehen werden kann. Das Kloster
erlebte viele glänzende Zeiten, wie es auch gar manchen
schwertreffenden Schicksalsschlag zn ertragen hatte,
bis es vier Jahre nach der Säcularisation des Fürsten-
thums Passau, im Jahre 1807, das Schicksal der
Aufhebung mit vielen der ehrwürdigsten kirchlichen
Stiftungen des deutschen Reiches theilte. Viele Jahre
diente das Gebäude als Irrenhaus, in neuester Zeit ist
es der kirchlichen Bestimmung zurückgegeben und
beherbergt eine Colonie englischer Fräulein. Auch eine
Kirche des Klosters ist wieder geöffnet, doch ist
dieselbe nicht die eigentliche und ursprüngliche Kirche
des Frauenstiftes, sondern eben nur die einzige von den
mehreren unter den Baulichkeiten des Klosters be-
standenen, auf uns gekommene.
Gleichwie alle Gebäude des Nonnen - Convents
durch die grossen Brände in den Jahren 1662 und
1680 arg gelitten haben, ging es auch dieser Kirche
nicht anders. In Folge der durch diese Zerstörungen
nothwendig gewordenen Wiederherstellungen hat das
Bauwerk, ursprünglich eine Pfeiler-Basilica, ihr alfer-
thümliches Gepräge verloren, und mögen nur mehr