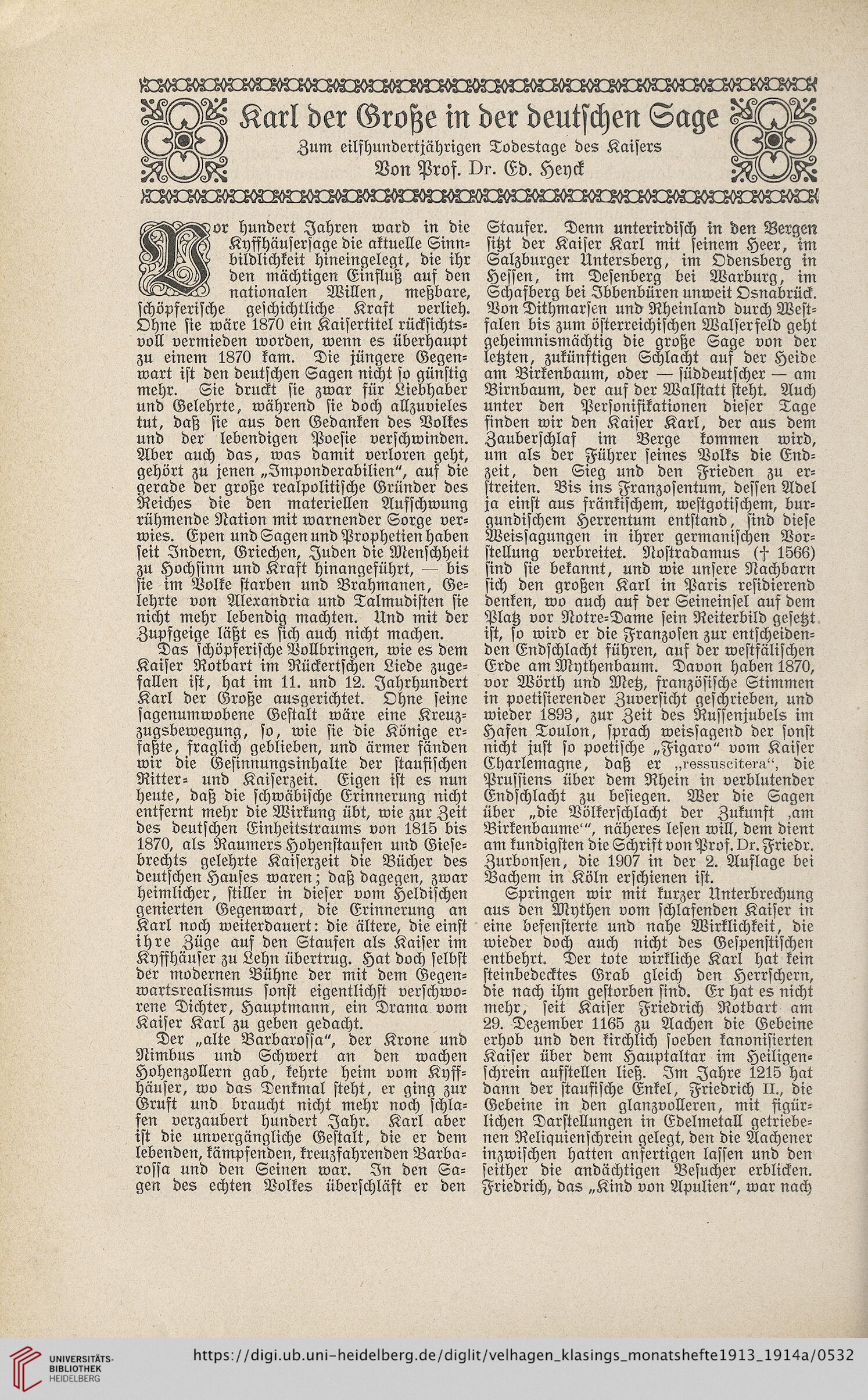S
@
M
Z Lor hundert Jahren ward in die
Q Kyffhäuſerſage die aktuelle Sinn-
bildlichkeit hineingelegt, die ihr
@ 4 den mächtigen Einfluß auf den
nationalen Willen, meßbare,
ſchöpferiſche geſchichtliche Kraft verlieh.
Ohne ſie wäre 1870 ein Kaiſertitel rückſichts-
voll vermieden worden, wenn es überhaupt
zu einem 1870 kam. Die jüngere Gegen-
wart iſt den deutſchen Sagen nicht ſo günſtig
mehr. Sie druckt ſie zwar für Liebhaber
und Gelehrte, während ſie doch allzuvieles
tut, daß ſie aus den Gedanken des Volkes
und der lebendigen Poeſie verſchwinden.
Aber auch das, was damit verloren geht,
gehört zu jenen „Imponderabilien“, auf die
gerade der große realpolitiſche Gründer des
Reiches die den materiellen Aufſchwung
rühmende Nation mit warnender Sorge ver-
wies. Epen und Sagen und Prophetien haben
ſeit Indern, Griechen, Juden die Menſchheit
zu Hochſinn und Kraft hinangeführt, — bis
ſie im Volke ſtarben und Brahmanen, Ge-
lehrte von Alexandria und Talmudiſten ſie
nicht mehr lebendig machten. Und mit der
Zupfgeige läßt es ſich auch nicht machen.
as ſchöpferiſche Vollbringen, wie es dem
Kaiſer Rotbart im Rückertſchen Liede zuge-
fallen iſt, hat im 11. und 12. Jahrhundert
Karl der Große ausgerichtet. Ohne ſeine
ſagenumwobene Geſtalt wäre eine Kreuz-
zugsbewegung, ſo, wie ſie die Könige er-
faßte, fraglich geblieben, und ärmer fänden
wir die Geſinnungsinhalte der ſtaufiſchen
Ritter⸗ und Kaiſerzeit. Eigen iſt es nun
heute, daß die ſchwäbiſche Erinnerung nicht
entfernt mehr die Wirkung übt, wie zur Zeit
des deutſchen Einheitstraums von 1815 bis
1870, als Raumers Hohenſtaufen und Gieſe-
brechts gelehrte Kaiſerzeit die Bücher des
deutſchen Hauſes waren; daß dagegen, zwar
heimlicher, ſtiller in dieſer vom Heldiſchen
genierten Gegenwart, die Erinnerung an
Karl noch weiterdauert: die ältere, die einſt
ihre Züge auf den Staufen als Kaiſer im
Kyffhäuſer zu Lehn übertrug. Hat doch ſelbſt
der modernen Bühne der mit dem Gegen-
wartsrealismus ſonſt eigentlichſt verſchwo-
rene Dichter, Hauptmann, ein Drama vom
Kaiſer Karl zu geben gedacht. ;
Der „alte Barbaroſſa“, der Krone und
Nimbus und Schwert an den wachen
Hohenzollern gab, kehrte heim vom Kyff-
häuſer, wo das Denkmal ſteht, er ging zur
Gruft und braucht nicht mehr noch ſchla-
fen verzaubert hundert Jahr. Karl aber
iſt die unvergängliche Geſtalt, die er dem
lebenden, kämpfenden, kreuzfahrenden Barba-
roſſa und den Seinen war. In den Sa-
gen des echten Volkes überſchläft er den
Staufer. Denn unterirdiſch in den Bergen
ſitzt der Kaiſer Karl mit ſeinem Heer, im
Salzburger Untersberg, im Odensberg in
Heſſen, im Deſenberg bei Warburg, im
Schafberg bei Ibbenbüren unweit Osnabrück.
Von Dithmarſen und Rheinland durch Weſt-
falen bis zum öſterreichiſchen Walſerfeld geht
geheimnismächtig die große Sage von der
letzten, zukünftigen Schlacht auf der Heide
am Birkenbaum, oder — ſüddeutſcher — am
Birnbaum, der auf der Walſtatt ſteht. Auch
unter den Perſonifikationen dieſer Tage
finden wir den Kaiſer Karl, der aus dem
Zauberſchlafß im Berge kommen wird,
um als der Führer ſeines Volks die End-
zeit, den Sieg und den Frieden zu er-
ſtreiten. Bis ins Franzoſentum, deſſen Adel
ja einſt aus fränkiſchem, weſtgotiſchem, bur-
gundiſchem Herrentum entſtand, ſind dieſe
Weisſagungen in ihrer germaniſchen Vor-
ſtellung verbreitet. Noſtradamus ( 1566)
ſind ſie bekannt, und wie unſere Nachbarn
ſich den großen Karl in Paris reſidierend
denken, wo auch auf der Seineinſel auf dem
Platz vor Notre⸗Dame ſein Reiterbild geſetzt
iſt, ſo wird er die Franzoſen zur entſcheiden-
den Endſchlacht führen, auf der weſtfäliſchen
Erde am Mythenbaum. Davon haben 1870,
in poetiſierender Zuverſicht geſchrieben, und
wieder 1893, zur Zeit des Ruſſenjubels im
Hafen Toulon, ſprach weisſagend der ſonſt
nicht juſt ſo poetiſche „Figaro“ vom Kaiſer
Charlemagne, daß er „ressuseitera“, die
Pruſſiens über dem Rhein in verblutender
Endſchlacht zu beſiegen. Wer die Sagen
über „die Völkerſchlacht der Zukunft ‚am
Birkenbaume“, näheres leſen will, dem dient
am kundigſten die Schrift von Prof. Dr. Friedr.
Zurbonſen, die 1907 in der 2. Auflage bei
Bachem in Köln erſchienen iſt.
Springen wir mit kurzer Unterbrechung
aus den Mythen vom ſchlafenden Kaiſer in
eine befenſterte und nahe Wirklichkeit, die
wieder doch auch nicht des Geſpenſtiſchen
entbehrt. Der tote wirkliche Karl hat kein
ſteinbedecktes Grab gleich den Herrſchern,
die nach ihm geſtorben ſind. Er hat es nicht
mehr, ſeit Kaiſer Friedrich Rotbart am
29. Dezember 1165 zu Aachen die Gebeine
erhob und den kirchlich ſoeben kanoniſierten
Kaiſer über dem Hauptaltar im Heiligen-
ſchrein aufſtellen ließ. Im Jahre 1215 hat
dann der ſtaufiſche Enkel, Friedrich II., die
Gebeine in den glanzvolleren, mit figür-
lichen Darſtellungen in Edelmetall getriebe-
nen Reliquienſchrein gelegt, den die Aachener
inzwiſchen hatten anfertigen laſſen und den
ſeither die andächtigen Beſucher erblicken.
Friedrich, das „Kind von Apulien“, war nach
@
M
Z Lor hundert Jahren ward in die
Q Kyffhäuſerſage die aktuelle Sinn-
bildlichkeit hineingelegt, die ihr
@ 4 den mächtigen Einfluß auf den
nationalen Willen, meßbare,
ſchöpferiſche geſchichtliche Kraft verlieh.
Ohne ſie wäre 1870 ein Kaiſertitel rückſichts-
voll vermieden worden, wenn es überhaupt
zu einem 1870 kam. Die jüngere Gegen-
wart iſt den deutſchen Sagen nicht ſo günſtig
mehr. Sie druckt ſie zwar für Liebhaber
und Gelehrte, während ſie doch allzuvieles
tut, daß ſie aus den Gedanken des Volkes
und der lebendigen Poeſie verſchwinden.
Aber auch das, was damit verloren geht,
gehört zu jenen „Imponderabilien“, auf die
gerade der große realpolitiſche Gründer des
Reiches die den materiellen Aufſchwung
rühmende Nation mit warnender Sorge ver-
wies. Epen und Sagen und Prophetien haben
ſeit Indern, Griechen, Juden die Menſchheit
zu Hochſinn und Kraft hinangeführt, — bis
ſie im Volke ſtarben und Brahmanen, Ge-
lehrte von Alexandria und Talmudiſten ſie
nicht mehr lebendig machten. Und mit der
Zupfgeige läßt es ſich auch nicht machen.
as ſchöpferiſche Vollbringen, wie es dem
Kaiſer Rotbart im Rückertſchen Liede zuge-
fallen iſt, hat im 11. und 12. Jahrhundert
Karl der Große ausgerichtet. Ohne ſeine
ſagenumwobene Geſtalt wäre eine Kreuz-
zugsbewegung, ſo, wie ſie die Könige er-
faßte, fraglich geblieben, und ärmer fänden
wir die Geſinnungsinhalte der ſtaufiſchen
Ritter⸗ und Kaiſerzeit. Eigen iſt es nun
heute, daß die ſchwäbiſche Erinnerung nicht
entfernt mehr die Wirkung übt, wie zur Zeit
des deutſchen Einheitstraums von 1815 bis
1870, als Raumers Hohenſtaufen und Gieſe-
brechts gelehrte Kaiſerzeit die Bücher des
deutſchen Hauſes waren; daß dagegen, zwar
heimlicher, ſtiller in dieſer vom Heldiſchen
genierten Gegenwart, die Erinnerung an
Karl noch weiterdauert: die ältere, die einſt
ihre Züge auf den Staufen als Kaiſer im
Kyffhäuſer zu Lehn übertrug. Hat doch ſelbſt
der modernen Bühne der mit dem Gegen-
wartsrealismus ſonſt eigentlichſt verſchwo-
rene Dichter, Hauptmann, ein Drama vom
Kaiſer Karl zu geben gedacht. ;
Der „alte Barbaroſſa“, der Krone und
Nimbus und Schwert an den wachen
Hohenzollern gab, kehrte heim vom Kyff-
häuſer, wo das Denkmal ſteht, er ging zur
Gruft und braucht nicht mehr noch ſchla-
fen verzaubert hundert Jahr. Karl aber
iſt die unvergängliche Geſtalt, die er dem
lebenden, kämpfenden, kreuzfahrenden Barba-
roſſa und den Seinen war. In den Sa-
gen des echten Volkes überſchläft er den
Staufer. Denn unterirdiſch in den Bergen
ſitzt der Kaiſer Karl mit ſeinem Heer, im
Salzburger Untersberg, im Odensberg in
Heſſen, im Deſenberg bei Warburg, im
Schafberg bei Ibbenbüren unweit Osnabrück.
Von Dithmarſen und Rheinland durch Weſt-
falen bis zum öſterreichiſchen Walſerfeld geht
geheimnismächtig die große Sage von der
letzten, zukünftigen Schlacht auf der Heide
am Birkenbaum, oder — ſüddeutſcher — am
Birnbaum, der auf der Walſtatt ſteht. Auch
unter den Perſonifikationen dieſer Tage
finden wir den Kaiſer Karl, der aus dem
Zauberſchlafß im Berge kommen wird,
um als der Führer ſeines Volks die End-
zeit, den Sieg und den Frieden zu er-
ſtreiten. Bis ins Franzoſentum, deſſen Adel
ja einſt aus fränkiſchem, weſtgotiſchem, bur-
gundiſchem Herrentum entſtand, ſind dieſe
Weisſagungen in ihrer germaniſchen Vor-
ſtellung verbreitet. Noſtradamus ( 1566)
ſind ſie bekannt, und wie unſere Nachbarn
ſich den großen Karl in Paris reſidierend
denken, wo auch auf der Seineinſel auf dem
Platz vor Notre⸗Dame ſein Reiterbild geſetzt
iſt, ſo wird er die Franzoſen zur entſcheiden-
den Endſchlacht führen, auf der weſtfäliſchen
Erde am Mythenbaum. Davon haben 1870,
in poetiſierender Zuverſicht geſchrieben, und
wieder 1893, zur Zeit des Ruſſenjubels im
Hafen Toulon, ſprach weisſagend der ſonſt
nicht juſt ſo poetiſche „Figaro“ vom Kaiſer
Charlemagne, daß er „ressuseitera“, die
Pruſſiens über dem Rhein in verblutender
Endſchlacht zu beſiegen. Wer die Sagen
über „die Völkerſchlacht der Zukunft ‚am
Birkenbaume“, näheres leſen will, dem dient
am kundigſten die Schrift von Prof. Dr. Friedr.
Zurbonſen, die 1907 in der 2. Auflage bei
Bachem in Köln erſchienen iſt.
Springen wir mit kurzer Unterbrechung
aus den Mythen vom ſchlafenden Kaiſer in
eine befenſterte und nahe Wirklichkeit, die
wieder doch auch nicht des Geſpenſtiſchen
entbehrt. Der tote wirkliche Karl hat kein
ſteinbedecktes Grab gleich den Herrſchern,
die nach ihm geſtorben ſind. Er hat es nicht
mehr, ſeit Kaiſer Friedrich Rotbart am
29. Dezember 1165 zu Aachen die Gebeine
erhob und den kirchlich ſoeben kanoniſierten
Kaiſer über dem Hauptaltar im Heiligen-
ſchrein aufſtellen ließ. Im Jahre 1215 hat
dann der ſtaufiſche Enkel, Friedrich II., die
Gebeine in den glanzvolleren, mit figür-
lichen Darſtellungen in Edelmetall getriebe-
nen Reliquienſchrein gelegt, den die Aachener
inzwiſchen hatten anfertigen laſſen und den
ſeither die andächtigen Beſucher erblicken.
Friedrich, das „Kind von Apulien“, war nach