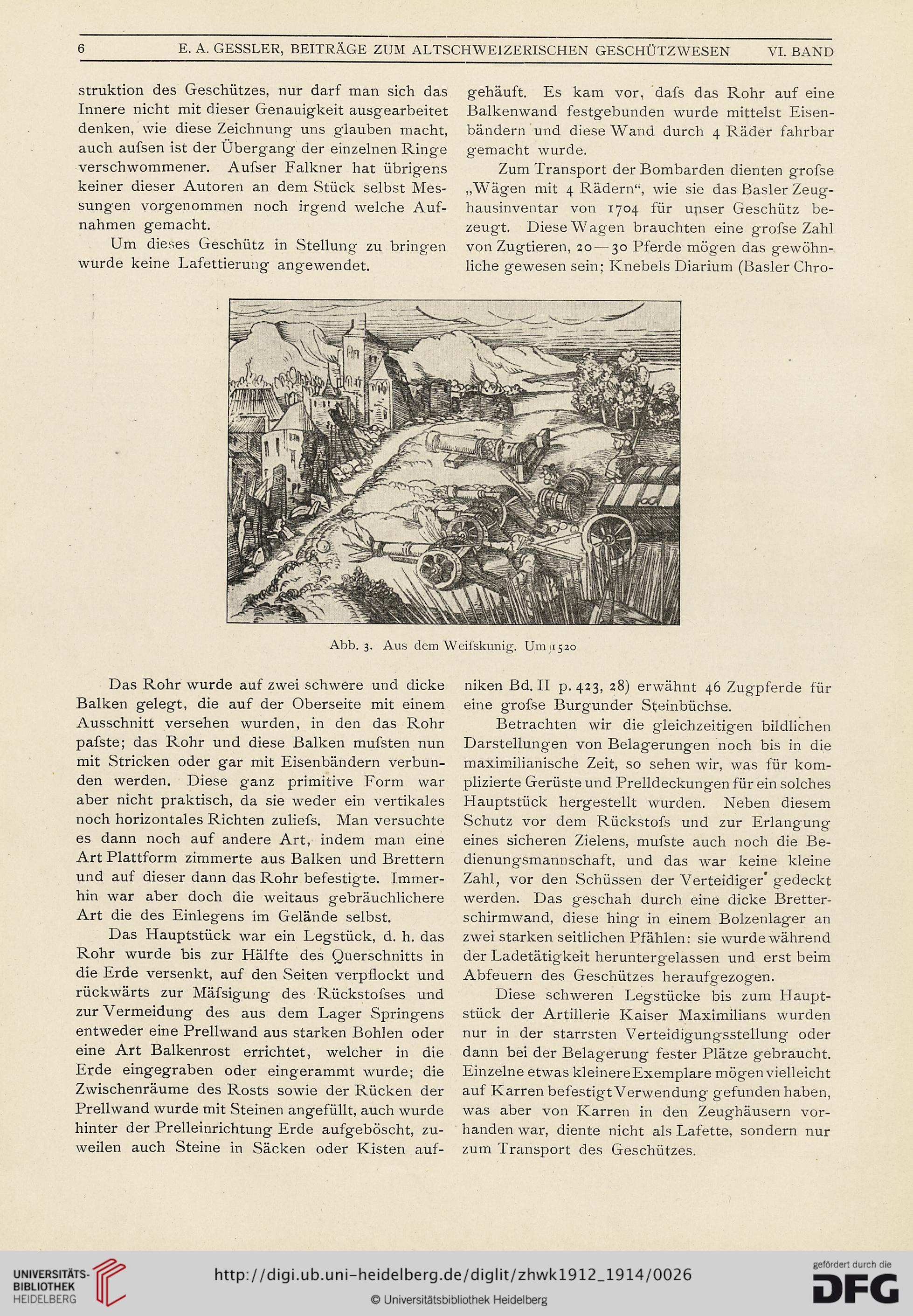6
E. A. GESSLER, BEITRÄGE ZUM ALTSCHWEIZERISCHEN GESCHÜTZ WESEN
VI. BAND
struktion des Geschützes, nur darf man sich das
Innere nicht mit dieser Genauigkeit ausgearbeitet
denken, wie diese Zeichnung uns glauben macht,
auch aufsen ist der Übergang der einzelnen Ringe
verschwommener. Aufser Falkner hat übrigens
keiner dieser Autoren an dem Stück selbst Mes-
sungen vorgenommen noch irgend welche Auf-
nahmen gemacht.
Um dieses Geschütz in Stellung zu bringen
wurde keine Lafettierung angewendet.
gehäuft. Es kam vor, dafs das Rohr auf eine
Balkenwand festgebunden wurde mittelst Eisen-
bändern und diese Wand durch 4 Räder fahrbar
gemacht wurde.
Zum Transport der Bombarden dienten grofse
„Wägen mit 4 Rädern“, wie sie das Basler Zeug-
hausinventar von 1704 für unser Geschütz be-
zeugt. Diese W agen brauchten eine grofse Zahl
von Zugtieren, 20 — 30 Pferde mögen das gewöhn-
liche gewesen sein; Knebels Diarium (Basler Chro-
Abb. 3. Aus dem Weifskunig. Um 11520
Das Rohr wurde auf zwei schwere und dicke
Balken gelegt, die auf der Oberseite mit einem
Ausschnitt versehen wurden, in den das Rohr
pafste; das Rohr und diese Balken mufsten nun
mit Stricken oder gar mit Eisenbändern verbun-
den werden. Diese ganz primitive Form war
aber nicht praktisch, da sie weder ein vertikales
noch horizontales Richten zuliefs. Man versuchte
es dann noch auf andere Art, indem man eine
Art Plattform zimmerte aus Balken und Brettern
und auf dieser dann das Rohr befestigte. Immer-
hin war aber doch die weitaus gebräuchlichere
Art die des Einlegens im Gelände selbst.
Das Hauptstück war ein Legstück, d. h. das
Rohr wurde bis zur Hälfte des Querschnitts in
die Erde versenkt, auf den Seiten verpflockt und
rückwärts zur Mäfsigung des Rückstofses und
zur Vermeidung des aus dem Lager Springens
entweder eine Prellwand aus starken Bohlen oder
eine Art Balkenrost errichtet, welcher in die
Erde eingegraben oder eingerammt wurde; die
Zwischenräume des Rosts sowie der Rücken der
Prellwand wurde mit Steinen angefüllt, auch wurde
hinter der Prelleinrichtung Erde aufgeböscht, zu-
weilen auch Steine in Säcken oder Kisten auf-
niken Bd. II p. 423, 28) erwähnt 46 Zugpferde für
eine grofse Burgunder Steinbüchse.
Betrachten wir die gleichzeitigen bildlichen
Darstellungen von Belagerungen noch bis in die
maximilianische Zeit, so sehen wir, was für kom-
plizierte Gerüste und Prelldeckungen für ein solches
Hauptstück hergestellt wurden. Neben diesem
Schutz vor dem Rückstofs und zur Erlangung
eines sicheren Zielens, mufste auch noch die Be-
dienungsmannschaft, und das war keine kleine
Zahl, vor den Schüssen der Verteidiger* gedeckt
werden. Das geschah durch eine dicke Bretter-
schirmwand, diese hing in einem Bolzenlager an
zwei starken seitlichen Pfählen: sie wurde während
der Ladetätigkeit heruntergelassen und erst beim
Abfeuern des Geschützes heraufgezogen.
Diese schweren Legstücke bis zum Haupt-
stück der Artillerie Kaiser Maximilians wurden
nur in der starrsten Verteidigungsstellung oder
dann bei der Belagerung fester Plätze gebraucht.
Einzelne etwas kleinereExemplare mögen vielleicht
auf Karren befestigt Verwendung gefunden haben,
was aber von Karren in den Zeughäusern vor-
handen war, diente nicht als Lafette, sondern nur
zum Transport des Geschützes.
E. A. GESSLER, BEITRÄGE ZUM ALTSCHWEIZERISCHEN GESCHÜTZ WESEN
VI. BAND
struktion des Geschützes, nur darf man sich das
Innere nicht mit dieser Genauigkeit ausgearbeitet
denken, wie diese Zeichnung uns glauben macht,
auch aufsen ist der Übergang der einzelnen Ringe
verschwommener. Aufser Falkner hat übrigens
keiner dieser Autoren an dem Stück selbst Mes-
sungen vorgenommen noch irgend welche Auf-
nahmen gemacht.
Um dieses Geschütz in Stellung zu bringen
wurde keine Lafettierung angewendet.
gehäuft. Es kam vor, dafs das Rohr auf eine
Balkenwand festgebunden wurde mittelst Eisen-
bändern und diese Wand durch 4 Räder fahrbar
gemacht wurde.
Zum Transport der Bombarden dienten grofse
„Wägen mit 4 Rädern“, wie sie das Basler Zeug-
hausinventar von 1704 für unser Geschütz be-
zeugt. Diese W agen brauchten eine grofse Zahl
von Zugtieren, 20 — 30 Pferde mögen das gewöhn-
liche gewesen sein; Knebels Diarium (Basler Chro-
Abb. 3. Aus dem Weifskunig. Um 11520
Das Rohr wurde auf zwei schwere und dicke
Balken gelegt, die auf der Oberseite mit einem
Ausschnitt versehen wurden, in den das Rohr
pafste; das Rohr und diese Balken mufsten nun
mit Stricken oder gar mit Eisenbändern verbun-
den werden. Diese ganz primitive Form war
aber nicht praktisch, da sie weder ein vertikales
noch horizontales Richten zuliefs. Man versuchte
es dann noch auf andere Art, indem man eine
Art Plattform zimmerte aus Balken und Brettern
und auf dieser dann das Rohr befestigte. Immer-
hin war aber doch die weitaus gebräuchlichere
Art die des Einlegens im Gelände selbst.
Das Hauptstück war ein Legstück, d. h. das
Rohr wurde bis zur Hälfte des Querschnitts in
die Erde versenkt, auf den Seiten verpflockt und
rückwärts zur Mäfsigung des Rückstofses und
zur Vermeidung des aus dem Lager Springens
entweder eine Prellwand aus starken Bohlen oder
eine Art Balkenrost errichtet, welcher in die
Erde eingegraben oder eingerammt wurde; die
Zwischenräume des Rosts sowie der Rücken der
Prellwand wurde mit Steinen angefüllt, auch wurde
hinter der Prelleinrichtung Erde aufgeböscht, zu-
weilen auch Steine in Säcken oder Kisten auf-
niken Bd. II p. 423, 28) erwähnt 46 Zugpferde für
eine grofse Burgunder Steinbüchse.
Betrachten wir die gleichzeitigen bildlichen
Darstellungen von Belagerungen noch bis in die
maximilianische Zeit, so sehen wir, was für kom-
plizierte Gerüste und Prelldeckungen für ein solches
Hauptstück hergestellt wurden. Neben diesem
Schutz vor dem Rückstofs und zur Erlangung
eines sicheren Zielens, mufste auch noch die Be-
dienungsmannschaft, und das war keine kleine
Zahl, vor den Schüssen der Verteidiger* gedeckt
werden. Das geschah durch eine dicke Bretter-
schirmwand, diese hing in einem Bolzenlager an
zwei starken seitlichen Pfählen: sie wurde während
der Ladetätigkeit heruntergelassen und erst beim
Abfeuern des Geschützes heraufgezogen.
Diese schweren Legstücke bis zum Haupt-
stück der Artillerie Kaiser Maximilians wurden
nur in der starrsten Verteidigungsstellung oder
dann bei der Belagerung fester Plätze gebraucht.
Einzelne etwas kleinereExemplare mögen vielleicht
auf Karren befestigt Verwendung gefunden haben,
was aber von Karren in den Zeughäusern vor-
handen war, diente nicht als Lafette, sondern nur
zum Transport des Geschützes.