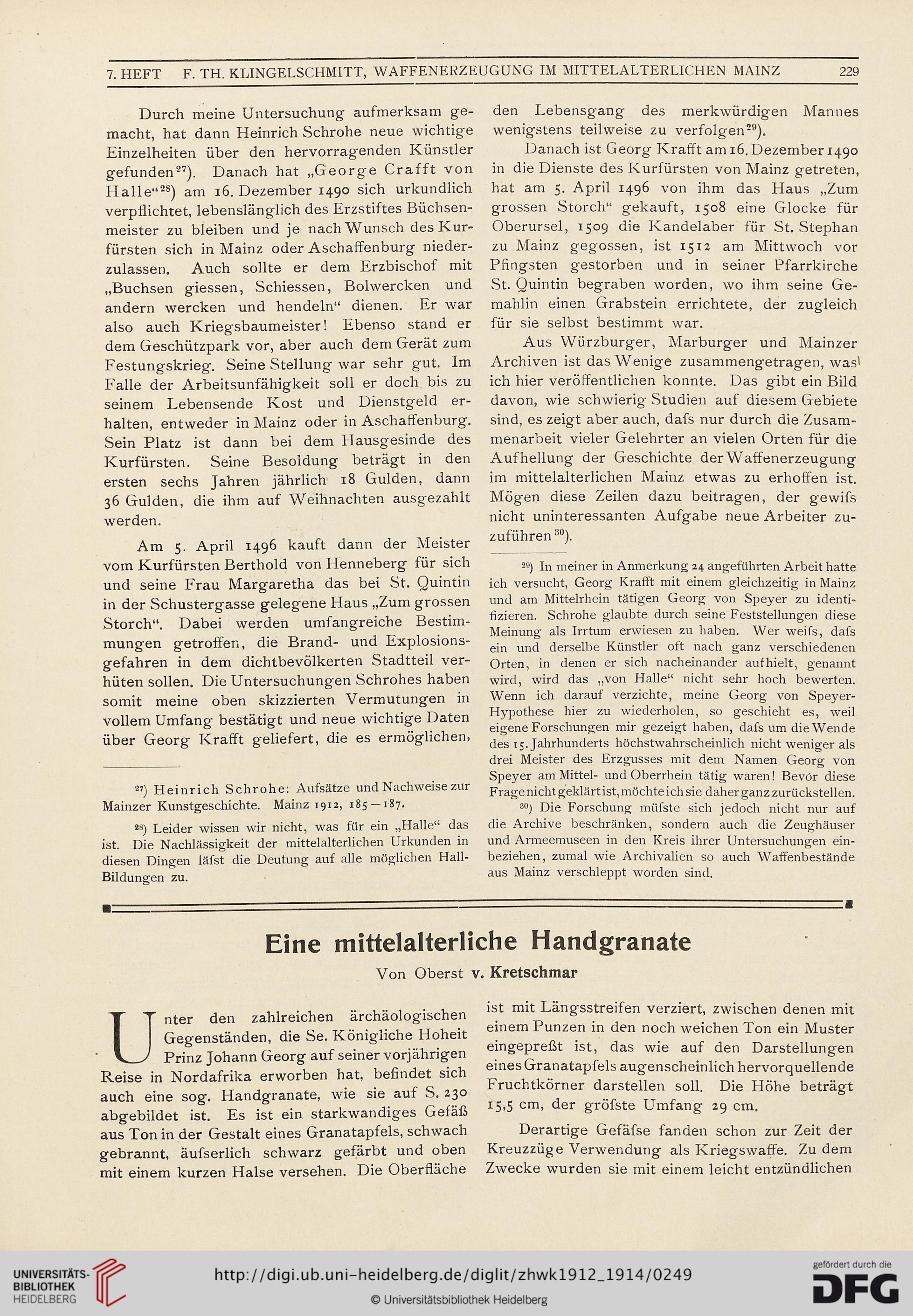7. HEFT F. TH. KLINGELSCHMITT, WAFFENERZEUGUNG IM MITTELALTERLICHEN MAINZ 229
Durch meine Untersuchung aufmerksam ge-
macht, hat dann Heinrich Schrohe neue wichtige
Einzelheiten über den hervorragenden Künstler
gefunden27). Danach hat „George Crafft von
Halle“28) am 16. Dezember 1490 sich urkundlich
verpflichtet, lebenslänglich des Erzstiftes Büchsen-
meister zu bleiben und je nach Wunsch des Kur-
fürsten sich in Mainz oder Aschaffenburg nieder-
zulassen, Auch sollte er dem Erzbischof mit
„Buchsen giessen, Schiessen, Bolwercken und
andern wercken und hendeln“ dienen. Er war
also auch Kriegsbaumeister! Ebenso stand er
dem Geschützpark vor, aber auch dem Gerät zum
Festungskrieg. Seine Stellung war sehr gut. Im
Falle der Arbeitsunfähigkeit soll er doch bis zu
seinem Lebensende Kost und Dienstgeld er-
halten, entweder in Mainz oder in Aschaffenburg.
Sein Platz ist dann bei dem Hausgesinde des
Kurfürsten. Seine Besoldung beträgt in den
ersten sechs Jahren jährlich 18 Gulden, dann
36 Gulden, die ihm auf Weihnachten ausgezahlt
werden.
Am 5. April 1496 kauft dann der Meister
vom Kurfürsten Berthold von Henneberg für sich
und seine Frau Margaretha das bei St. Quintin
in der Schustergasse gelegene Haus „Zum grossen
Storch“. Dabei werden umfangreiche Bestim-
mungen getroffen, die Brand- und Explosions-
gefahren in dem dichtbevölkerten Stadtteil ver-
hüten sollen. Die Untersuchungen Schrohes haben
somit meine oben skizzierten Vermutungen in
vollem Umfang bestätigt und neue wichtige Daten
über Georg Krafft geliefert, die es ermöglichen,
2I) Heinrich Schrohe: Aufsätze und Nachweise zur
Mainzer Kunstgeschichte. Mainz 1912, 185 — 187.
2S) Leider wissen wir nicht, was für ein „Halle“ das
ist. Die Nachlässigkeit der mittelalterlichen Urkunden in
diesen Dingen läfst die Deutung auf alle möglichen Hall-
Bildungen zu.
den Lebensgang des merkwürdigen Mannes
wenigstens teilweise zu verfolgen29).
Danach ist Georg Krafft am 16. Dezember 1490
in die Dienste des Kurfürsten von Mainz getreten,
hat am 5. April 1496 von ihm das Haus „Zum
grossen Storch“ gekauft, 1508 eine Glocke für
Oberursel, 1509 die Kandelaber für St. Stephan
zu Mainz gegossen, ist 1512 am Mittwoch vor
Pfingsten gestorben und in seiner Pfarrkirche
St. Quintin begraben worden, wo ihm seine Ge-
mahlin einen Grabstein errichtete, der zugleich
für sie selbst bestimmt war.
Aus Würzburger, Marburger und Mainzer
Archiven ist das Wenige zusammengetragen, was'
ich hier veröffentlichen konnte. Das gibt ein Bild
davon, wie schwierig Studien auf diesem Gebiete
sind, es zeigt aber auch, dafs nur durch die Zusam-
menarbeit vieler Gelehrter an vielen Orten für die
Aufhellung der Geschichte der Waffenerzeugung
im mittelalterlichen Mainz etwas zu erhoffen ist.
Mögen diese Zeilen dazu beitragen, der gewifs
nicht uninteressanten Aufgabe neue Arbeiter zu-
zuführen30).
2n) In meiner in Anmerkung 24 angeführten Arbeit hatte
ich versucht, Georg Krafft mit einem gleichzeitig in Mainz
und am Mittelrhein tätigen Georg von Speyer zu identi-
fizieren. Schrohe glaubte durch seine Feststellungen diese
Meinung als Irrtum erwiesen zu haben. Wer weifs, dafs
ein und derselbe Künstler oft nach ganz verschiedenen
Orten, in denen er sich nacheinander aufhielt, genannt
wird, wird das „von Halle“ nicht sehr hoch bewerten.
Wenn ich darauf verzichte, meine Georg von Speyer-
Hypothese hier zu wiederholen, so geschieht es, weil
eigene Forschungen mir gezeigt haben, dafs um die Wende
des 15. Jahrhunderts höchstwahrscheinlich nicht weniger als
drei Meister des Erzgusses mit dem Namen Georg von
Speyer am Mittel- und Oberrhein tätig waren! Bevor diese
Frage nicht geklärt ist, möchte ich sie daher ganz zurückstellen.
30) Die Forschung miifste sich jedoch nicht nur auf
die Archive beschränken, sondern auch die Zeughäuser
und Armeemuseen in den Kreis ihrer Untersuchungen ein-
beziehen, zumal wie Archivalien so auch Waffenbestände
aus Mainz verschleppt worden sind.
Eine mittelalterliche Handgranate
Von Oberst v. Kretschmar
Unter den zahlreichen ärchäologischen
Gegenständen, die Se. Königliche Hoheit
Prinz Johann Georg auf seiner vorjährigen
Reise in Nordafrika erworben hat, befindet sich
auch eine sog. Handgranate, wie sie auf S. 230
abgebildet ist. Es ist ein starkwandiges Gefäß
aus Ton in der Gestalt eines Granatapfels, schwach
gebrannt, äufserlich schwarz gefärbt und oben
mit einem kurzen Halse versehen. Die Oberfläche
ist mit Längsstreifen verziert, zwischen denen mit
einem Punzen in den noch weichen Ton ein Muster
eingepreßt ist, das wie auf den Darstellungen
eines Granatapfels augenscheinlich hervorquellende
Fruchtkörner darstellen soll. Die Höhe beträgt
15,5 cm, der gröfste Umfang 29 cm.
Derartige Gefäfse fanden schon zur Zeit der
Kreuzzüge Verwendung als Kriegswaffe. Zu dem
Zwecke wurden sie mit einem leicht entzündlichen
Durch meine Untersuchung aufmerksam ge-
macht, hat dann Heinrich Schrohe neue wichtige
Einzelheiten über den hervorragenden Künstler
gefunden27). Danach hat „George Crafft von
Halle“28) am 16. Dezember 1490 sich urkundlich
verpflichtet, lebenslänglich des Erzstiftes Büchsen-
meister zu bleiben und je nach Wunsch des Kur-
fürsten sich in Mainz oder Aschaffenburg nieder-
zulassen, Auch sollte er dem Erzbischof mit
„Buchsen giessen, Schiessen, Bolwercken und
andern wercken und hendeln“ dienen. Er war
also auch Kriegsbaumeister! Ebenso stand er
dem Geschützpark vor, aber auch dem Gerät zum
Festungskrieg. Seine Stellung war sehr gut. Im
Falle der Arbeitsunfähigkeit soll er doch bis zu
seinem Lebensende Kost und Dienstgeld er-
halten, entweder in Mainz oder in Aschaffenburg.
Sein Platz ist dann bei dem Hausgesinde des
Kurfürsten. Seine Besoldung beträgt in den
ersten sechs Jahren jährlich 18 Gulden, dann
36 Gulden, die ihm auf Weihnachten ausgezahlt
werden.
Am 5. April 1496 kauft dann der Meister
vom Kurfürsten Berthold von Henneberg für sich
und seine Frau Margaretha das bei St. Quintin
in der Schustergasse gelegene Haus „Zum grossen
Storch“. Dabei werden umfangreiche Bestim-
mungen getroffen, die Brand- und Explosions-
gefahren in dem dichtbevölkerten Stadtteil ver-
hüten sollen. Die Untersuchungen Schrohes haben
somit meine oben skizzierten Vermutungen in
vollem Umfang bestätigt und neue wichtige Daten
über Georg Krafft geliefert, die es ermöglichen,
2I) Heinrich Schrohe: Aufsätze und Nachweise zur
Mainzer Kunstgeschichte. Mainz 1912, 185 — 187.
2S) Leider wissen wir nicht, was für ein „Halle“ das
ist. Die Nachlässigkeit der mittelalterlichen Urkunden in
diesen Dingen läfst die Deutung auf alle möglichen Hall-
Bildungen zu.
den Lebensgang des merkwürdigen Mannes
wenigstens teilweise zu verfolgen29).
Danach ist Georg Krafft am 16. Dezember 1490
in die Dienste des Kurfürsten von Mainz getreten,
hat am 5. April 1496 von ihm das Haus „Zum
grossen Storch“ gekauft, 1508 eine Glocke für
Oberursel, 1509 die Kandelaber für St. Stephan
zu Mainz gegossen, ist 1512 am Mittwoch vor
Pfingsten gestorben und in seiner Pfarrkirche
St. Quintin begraben worden, wo ihm seine Ge-
mahlin einen Grabstein errichtete, der zugleich
für sie selbst bestimmt war.
Aus Würzburger, Marburger und Mainzer
Archiven ist das Wenige zusammengetragen, was'
ich hier veröffentlichen konnte. Das gibt ein Bild
davon, wie schwierig Studien auf diesem Gebiete
sind, es zeigt aber auch, dafs nur durch die Zusam-
menarbeit vieler Gelehrter an vielen Orten für die
Aufhellung der Geschichte der Waffenerzeugung
im mittelalterlichen Mainz etwas zu erhoffen ist.
Mögen diese Zeilen dazu beitragen, der gewifs
nicht uninteressanten Aufgabe neue Arbeiter zu-
zuführen30).
2n) In meiner in Anmerkung 24 angeführten Arbeit hatte
ich versucht, Georg Krafft mit einem gleichzeitig in Mainz
und am Mittelrhein tätigen Georg von Speyer zu identi-
fizieren. Schrohe glaubte durch seine Feststellungen diese
Meinung als Irrtum erwiesen zu haben. Wer weifs, dafs
ein und derselbe Künstler oft nach ganz verschiedenen
Orten, in denen er sich nacheinander aufhielt, genannt
wird, wird das „von Halle“ nicht sehr hoch bewerten.
Wenn ich darauf verzichte, meine Georg von Speyer-
Hypothese hier zu wiederholen, so geschieht es, weil
eigene Forschungen mir gezeigt haben, dafs um die Wende
des 15. Jahrhunderts höchstwahrscheinlich nicht weniger als
drei Meister des Erzgusses mit dem Namen Georg von
Speyer am Mittel- und Oberrhein tätig waren! Bevor diese
Frage nicht geklärt ist, möchte ich sie daher ganz zurückstellen.
30) Die Forschung miifste sich jedoch nicht nur auf
die Archive beschränken, sondern auch die Zeughäuser
und Armeemuseen in den Kreis ihrer Untersuchungen ein-
beziehen, zumal wie Archivalien so auch Waffenbestände
aus Mainz verschleppt worden sind.
Eine mittelalterliche Handgranate
Von Oberst v. Kretschmar
Unter den zahlreichen ärchäologischen
Gegenständen, die Se. Königliche Hoheit
Prinz Johann Georg auf seiner vorjährigen
Reise in Nordafrika erworben hat, befindet sich
auch eine sog. Handgranate, wie sie auf S. 230
abgebildet ist. Es ist ein starkwandiges Gefäß
aus Ton in der Gestalt eines Granatapfels, schwach
gebrannt, äufserlich schwarz gefärbt und oben
mit einem kurzen Halse versehen. Die Oberfläche
ist mit Längsstreifen verziert, zwischen denen mit
einem Punzen in den noch weichen Ton ein Muster
eingepreßt ist, das wie auf den Darstellungen
eines Granatapfels augenscheinlich hervorquellende
Fruchtkörner darstellen soll. Die Höhe beträgt
15,5 cm, der gröfste Umfang 29 cm.
Derartige Gefäfse fanden schon zur Zeit der
Kreuzzüge Verwendung als Kriegswaffe. Zu dem
Zwecke wurden sie mit einem leicht entzündlichen