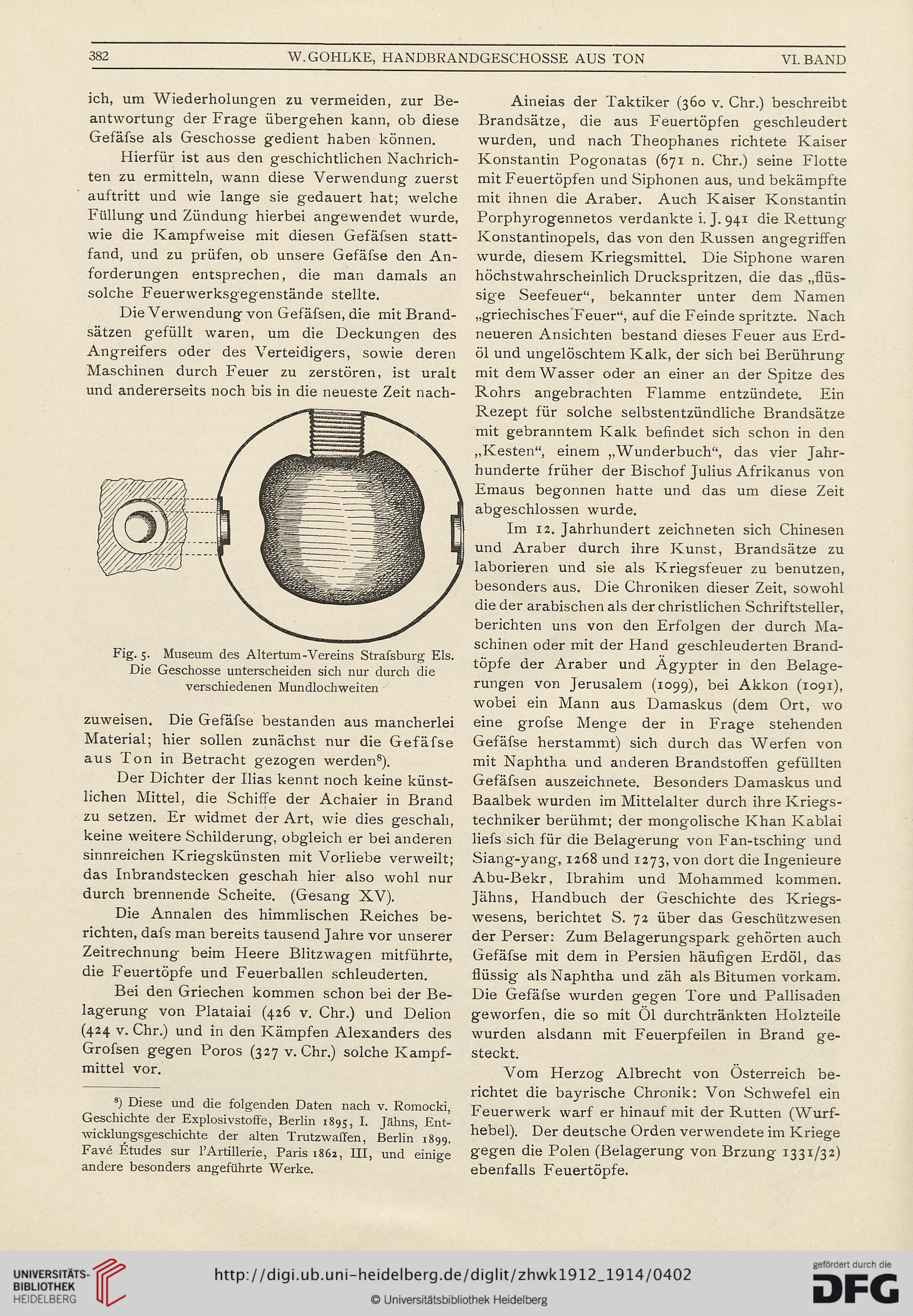382
W.GOHLKE, HANDBRANDGESCHOSSE AUS TON
VI. BAND
ich, um Wiederholungen zu vermeiden, zur Be-
antwortung der Frage übergehen kann, ob diese
Gefäfse als Geschosse gedient haben können.
Hierfür ist aus den geschichtlichen Nachrich-
ten zu ermitteln, wann diese Verwendung zuerst
auftritt und wie lange sie gedauert hat; welche
Füllung und Zündung hierbei angewendet wurde,
wie die Kampfweise mit diesen Gefäfsen statt-
fand, und zu prüfen, ob unsere Gefäfse den An-
forderungen entsprechen, die man damals an
solche Feuerwerksgegenstände stellte.
Die Verwendung von Gefäfsen, die mit Brand-
sätzen gefüllt waren, um die Deckungen des
Angreifers oder des Verteidigers, sowie deren
Maschinen durch Feuer zu zerstören, ist uralt
und andererseits noch bis in die neueste Zeit nach-
Fig. 5. Museum des Altertum-Vereins Strafsburg Eis.
Die Geschosse unterscheiden sich nur durch die
verschiedenen Mundlochweiten
zuweisen. Die Gefäfse bestanden aus mancherlei
Material; hier sollen zunächst nur die Gefäfse
aus Ton in Betracht gezogen werden8).
Der Dichter der Ilias kennt noch keine künst-
lichen Mittel, die Schiffe der Achaier in Brand
zu setzen. Er widmet der Art, wie dies geschah,
keine weitere Schilderung, obgleich er bei anderen
sinnreichen Kriegskünsten mit Vorliebe verweilt;
das Inbrandstecken geschah hier also wohl nur
durch brennende Scheite. (Gesang XV).
Die Annalen des himmlischen Reiches be-
richten, dafs man bereits tausend Jahre vor unserer
Zeitrechnung beim Heere Blitzwagen mitführte,
die Feuertöpfe und Feuerballen schleuderten.
Bei den Griechen kommen schon bei der Be-
lagerung von Plataiai (426 v. Chr.) und Delion
(424 v. Chr.) und in den Kämpfen Alexanders des
Grofsen gegen Poros (327 v. Chr.) solche Kampf-
mittel vor.
8) Diese und die folgenden Daten nach v. Romocki,
Geschichte der Explosivstoffe, Berlin 1895, I. Jähns, Ent-
wicklungsgeschichte der alten Trutzwaffen, Berlin 1899.
Favü fitudes sur l’Artillerie, Paris 1862, III, und einige
andere besonders angeführte Werke.
Aineias der Taktiker (360 v. Chr.) beschreibt
Brandsätze, die aus Feuertöpfen geschleudert
wurden, und nach Theophanes richtete Kaiser
Konstantin Pogonatas (671 n. Chr.) seine Flotte
mit Feuertöpfen und Siphonen aus, und bekämpfte
mit ihnen die Araber. Auch Kaiser Konstantin
Porphyrogennetos verdankte i. J. 941 die Rettung
Konstantinopels, das von den Russen angegriffen
wurde, diesem Kriegsmittel. Die Siphone waren
höchstwahrscheinlich Druckspritzen, die das „flüs-
sig-e Seefeuer“, bekannter unter dem Namen
„griechisches Feuer“, auf die Feinde spritzte. Nach
neueren Ansichten bestand dieses Feuer aus Erd-
öl und ungelöschtem Kalk, der sich bei Berührung
mit dem Wasser oder an einer an der Spitze des
Rohrs angebrachten Flamme entzündete. Ein
Rezept für solche selbstentzündliche Brandsätze
mit gebranntem Kalk befindet sich schon in den
„Kesten“, einem „Wunderbuch“, das vier Jahr-
hunderte früher der Bischof Julius Afrikanus von
Emaus begonnen hatte und das um diese Zeit
abgeschlossen wurde.
Im 12. Jahrhundert zeichneten sich Chinesen
und Araber durch ihre Kunst, Brandsätze zu
laborieren und sie als Kriegsfeuer zu benutzen,
besonders aus. Die Chroniken dieser Zeit, sowohl
die der arabischen als der christlichen Schriftsteller,
berichten uns von den Erfolgen der durch Ma-
schinen oder mit der Hand geschleuderten Brand-
töpfe der Araber und Ägypter in den Belage-
rungen von Jerusalem (1099), bei Akkon (1091),
wobei ein Mann aus Damaskus (dem Ort, wo
eine grofse Menge der in Frage stehenden
Gefäfse herstammt) sich durch das Werfen von
mit Naphtha und anderen Brandstoffen gefüllten
Gefäfsen auszeichnete. Besonders Damaskus und
Baalbek wurden im Mittelalter durch ihre Kriegs-
techniker berühmt; der mongolische Khan Kablai
liefs sich für die Belagerung von Fan-tsching und
Siang-yang, 1268 und 1273, von dort die Ingenieure
Abu-Bekr, Ibrahim und Mohammed kommen.
Jähns, Handbuch der Geschichte des Kriegs-
wesens, berichtet S. 72 über das Geschützwesen
der Perser: Zum Belagerungspark gehörten auch
Gefäfse mit dem in Persien häufigen Erdöl, das
flüssig als Naphtha und zäh als Bitumen vorkam.
Die Gefäfse wurden gegen Tore und Pallisaden
geworfen, die so mit 01 durch tränkten Holzteile
wurden alsdann mit Feuerpfeilen in Brand ge-
steckt.
Vom Herzog Albrecht von Österreich be-
richtet die bayrische Chronik: Von Schwefel ein
Feuerwerk warf er hinauf mit der Rutten (Wurf-
hebel). Der deutsche Orden verwendete im Kriege
gegen die Polen (Belagerung von Brzung 1331/32)
ebenfalls Feuertöpfe.
W.GOHLKE, HANDBRANDGESCHOSSE AUS TON
VI. BAND
ich, um Wiederholungen zu vermeiden, zur Be-
antwortung der Frage übergehen kann, ob diese
Gefäfse als Geschosse gedient haben können.
Hierfür ist aus den geschichtlichen Nachrich-
ten zu ermitteln, wann diese Verwendung zuerst
auftritt und wie lange sie gedauert hat; welche
Füllung und Zündung hierbei angewendet wurde,
wie die Kampfweise mit diesen Gefäfsen statt-
fand, und zu prüfen, ob unsere Gefäfse den An-
forderungen entsprechen, die man damals an
solche Feuerwerksgegenstände stellte.
Die Verwendung von Gefäfsen, die mit Brand-
sätzen gefüllt waren, um die Deckungen des
Angreifers oder des Verteidigers, sowie deren
Maschinen durch Feuer zu zerstören, ist uralt
und andererseits noch bis in die neueste Zeit nach-
Fig. 5. Museum des Altertum-Vereins Strafsburg Eis.
Die Geschosse unterscheiden sich nur durch die
verschiedenen Mundlochweiten
zuweisen. Die Gefäfse bestanden aus mancherlei
Material; hier sollen zunächst nur die Gefäfse
aus Ton in Betracht gezogen werden8).
Der Dichter der Ilias kennt noch keine künst-
lichen Mittel, die Schiffe der Achaier in Brand
zu setzen. Er widmet der Art, wie dies geschah,
keine weitere Schilderung, obgleich er bei anderen
sinnreichen Kriegskünsten mit Vorliebe verweilt;
das Inbrandstecken geschah hier also wohl nur
durch brennende Scheite. (Gesang XV).
Die Annalen des himmlischen Reiches be-
richten, dafs man bereits tausend Jahre vor unserer
Zeitrechnung beim Heere Blitzwagen mitführte,
die Feuertöpfe und Feuerballen schleuderten.
Bei den Griechen kommen schon bei der Be-
lagerung von Plataiai (426 v. Chr.) und Delion
(424 v. Chr.) und in den Kämpfen Alexanders des
Grofsen gegen Poros (327 v. Chr.) solche Kampf-
mittel vor.
8) Diese und die folgenden Daten nach v. Romocki,
Geschichte der Explosivstoffe, Berlin 1895, I. Jähns, Ent-
wicklungsgeschichte der alten Trutzwaffen, Berlin 1899.
Favü fitudes sur l’Artillerie, Paris 1862, III, und einige
andere besonders angeführte Werke.
Aineias der Taktiker (360 v. Chr.) beschreibt
Brandsätze, die aus Feuertöpfen geschleudert
wurden, und nach Theophanes richtete Kaiser
Konstantin Pogonatas (671 n. Chr.) seine Flotte
mit Feuertöpfen und Siphonen aus, und bekämpfte
mit ihnen die Araber. Auch Kaiser Konstantin
Porphyrogennetos verdankte i. J. 941 die Rettung
Konstantinopels, das von den Russen angegriffen
wurde, diesem Kriegsmittel. Die Siphone waren
höchstwahrscheinlich Druckspritzen, die das „flüs-
sig-e Seefeuer“, bekannter unter dem Namen
„griechisches Feuer“, auf die Feinde spritzte. Nach
neueren Ansichten bestand dieses Feuer aus Erd-
öl und ungelöschtem Kalk, der sich bei Berührung
mit dem Wasser oder an einer an der Spitze des
Rohrs angebrachten Flamme entzündete. Ein
Rezept für solche selbstentzündliche Brandsätze
mit gebranntem Kalk befindet sich schon in den
„Kesten“, einem „Wunderbuch“, das vier Jahr-
hunderte früher der Bischof Julius Afrikanus von
Emaus begonnen hatte und das um diese Zeit
abgeschlossen wurde.
Im 12. Jahrhundert zeichneten sich Chinesen
und Araber durch ihre Kunst, Brandsätze zu
laborieren und sie als Kriegsfeuer zu benutzen,
besonders aus. Die Chroniken dieser Zeit, sowohl
die der arabischen als der christlichen Schriftsteller,
berichten uns von den Erfolgen der durch Ma-
schinen oder mit der Hand geschleuderten Brand-
töpfe der Araber und Ägypter in den Belage-
rungen von Jerusalem (1099), bei Akkon (1091),
wobei ein Mann aus Damaskus (dem Ort, wo
eine grofse Menge der in Frage stehenden
Gefäfse herstammt) sich durch das Werfen von
mit Naphtha und anderen Brandstoffen gefüllten
Gefäfsen auszeichnete. Besonders Damaskus und
Baalbek wurden im Mittelalter durch ihre Kriegs-
techniker berühmt; der mongolische Khan Kablai
liefs sich für die Belagerung von Fan-tsching und
Siang-yang, 1268 und 1273, von dort die Ingenieure
Abu-Bekr, Ibrahim und Mohammed kommen.
Jähns, Handbuch der Geschichte des Kriegs-
wesens, berichtet S. 72 über das Geschützwesen
der Perser: Zum Belagerungspark gehörten auch
Gefäfse mit dem in Persien häufigen Erdöl, das
flüssig als Naphtha und zäh als Bitumen vorkam.
Die Gefäfse wurden gegen Tore und Pallisaden
geworfen, die so mit 01 durch tränkten Holzteile
wurden alsdann mit Feuerpfeilen in Brand ge-
steckt.
Vom Herzog Albrecht von Österreich be-
richtet die bayrische Chronik: Von Schwefel ein
Feuerwerk warf er hinauf mit der Rutten (Wurf-
hebel). Der deutsche Orden verwendete im Kriege
gegen die Polen (Belagerung von Brzung 1331/32)
ebenfalls Feuertöpfe.