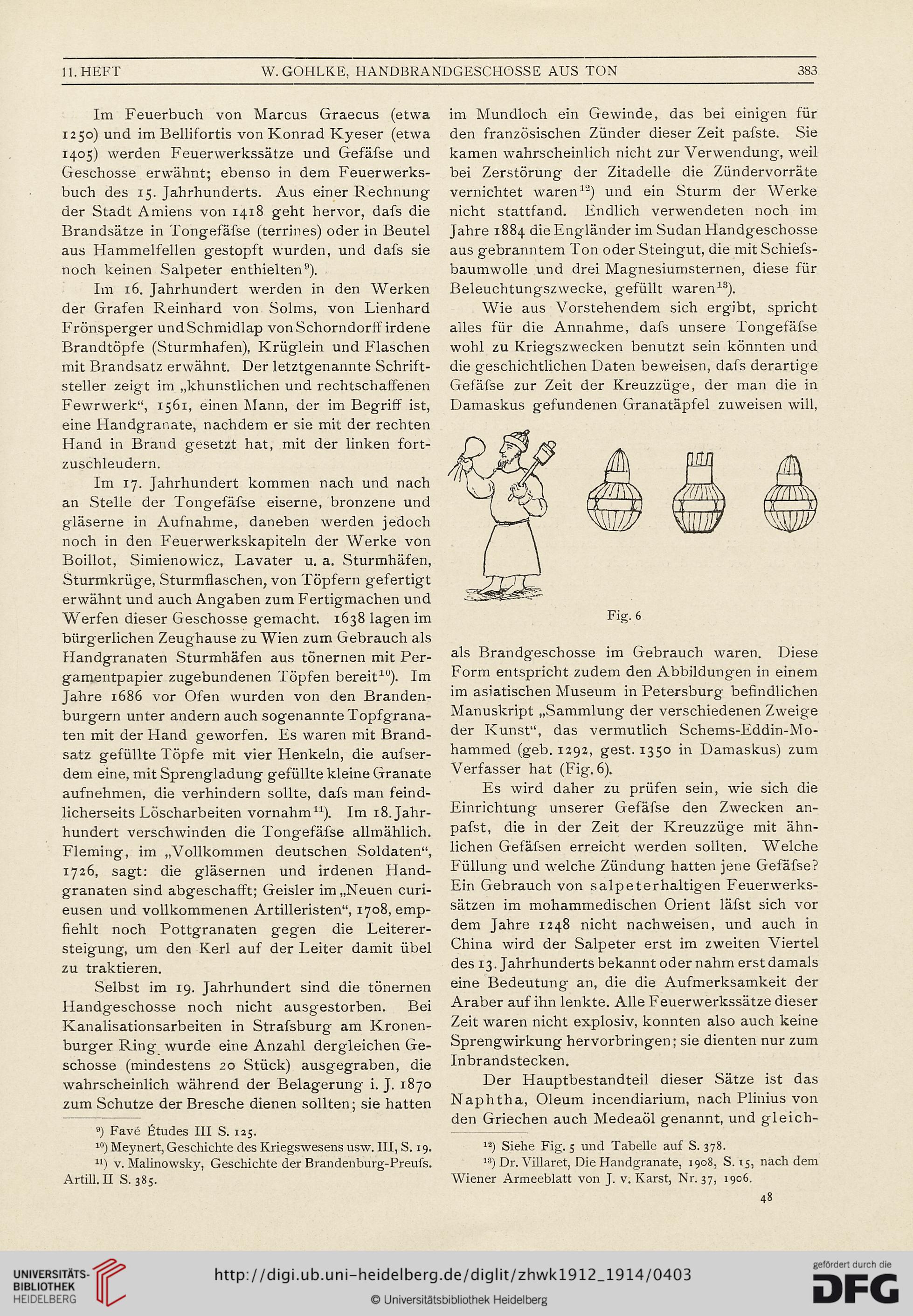11. HEFT
W.GOHLKE, HANDBRANDGESCHOSSE AUS TON
383
Im Feuerbuch von Marcus Graecus (etwa
1250) und im Bellifortis von Konrad Kyeser (etwa
1405) werden Feuerwerkssätze und Gefäfse und
Geschosse erwähnt; ebenso in dem Feuerwerks-
buch des 15. Jahrhunderts. Aus einer Rechnung
der Stadt Amiens von 1418 geht hervor, dafs die
Brandsätze in Tongefäfse (terrines) oder in Beutel
aus Hammelfellen gestopft wurden, und dafs sie
noch keinen Salpeter enthielten9).
Im 16. Jahrhundert werden in den Werken
der Grafen Reinhard von Solms, von Lienhard
Frönsperger undSchmidlap von Schorndorff irdene
Brandtöpfe (Sturmhafen), Krüglein und Flaschen
mit Brandsatz erwähnt. Der letztgenannte Schrift-
steller zeigt im „khunstlichen und rechtschaffenen
Fewrwerk“, 1561, einen Mann, der im Begriff ist,
eine Handgranate, nachdem er sie mit der rechten
Hand in Brand gesetzt hat, mit der linken fort-
zuschleudern.
Im 17. Jahrhundert kommen nach und nach
an Stelle der Tongefäfse eiserne, bronzene und
gläserne in Aufnahme, daneben werden jedoch
noch in den Feuerwerkskapiteln der Werke von
Boillot, Simienowicz, Lavater u, a. Sturmhäfen,
Sturmkrüge, Sturmflaschen, von Töpfern gefertigt
erwähnt und auch Angaben zum Fertigmachen und
Werfen dieser Geschosse gemacht. 1638 lagen im
bürgerlichen Zeughause zu Wien zum Gebrauch als
Handgranaten Sturmhäfen aus tönernen mit Per-
gamentpapier zugebundenen Töpfen bereit10). Im
Jahre 1686 vor Ofen wurden von den Branden-
burgern unter andern auch sogenannte Topfgrana-
ten mit der Hand geworfen. Es waren mit Brand-
satz gefüllte Töpfe mit vier Henkeln, die aufser-
dem eine, mit Sprengladung gefüllte kleine Granate
aufnehmen, die verhindern sollte, dafs man feind-
licherseits Löscharbeiten vornahm11 *). Im 18. Jahr-
hundert verschwinden die Tongefäfse allmählich.
Fleming, im „Vollkommen deutschen Soldaten“,
1726, sagt: die gläsernen und irdenen Hand-
granaten sind abgeschafft; Geisler im „Neuen curi-
eusen und vollkommenen Artilleristen“, 1708, emp-
fiehlt noch Pottgranaten gegen die Leiterer-
steigung, um den Kerl auf der Leiter damit übel
zu traktieren.
Selbst im 19. Jahrhundert sind die tönernen
Handgeschosse noch nicht ausgestorben. Bei
Kanalisationsarbeiten in Strafsburg am Kronen-
burger Ring wurde eine Anzahl dergleichen Ge-
schosse (mindestens 20 Stück) ausgegraben, die
wahrscheinlich während der Belagerung i. J. 1870
zum Schutze der Bresche dienen sollten; sie hatten
9) Fave Etudes III S. 125.
10) Meynert, Geschichte des Kriegswesens usw. III, S. 19.
u) v. Malinowsky, Geschichte der Brandenburg-Preufs.
Artill. II S. 385.
im Mundloch ein Gewinde, das bei einigen für
den französischen Zünder dieser Zeit pafste. Sie
kamen wahrscheinlich nicht zur Verwendung, weil
bei Zerstörung der Zitadelle die Zündervorräte
vernichtet waren13) und ein Sturm der Werke
nicht stattfand. Endlich verwendeten noch im
Jahre 1884 die Engländer im Sudan Handgeschosse
aus gebranntem Ton oder Steingut, die mit Schiefs-
baumwolle und drei Magnesiumsternen, diese für
Beleuchtungszwecke, gefüllt waren13).
Wie aus Vorstehendem sich ergibt, spricht
alles für die Annahme, dafs unsere Tongefäfse
wohl zu Kriegszwecken benutzt sein könnten und
die geschichtlichen Daten beweisen, dafs derartige
Gefäfse zur Zeit der Kreuzzüge, der man die in
Damaskus gefundenen Granatäpfel zuweisen will,
Fig. 6
als Brandg'eschosse im Gebrauch waren. Diese
Form entspricht zudem den Abbildungen in einem
im asiatischen Museum in Petersburg befindlichen
Manuskript „Sammlung der verschiedenen Zweige
der Kunst“, das vermutlich Schems-Eddin-Mo-
hammed (geb. 1292, gest. 1350 in Damaskus) zum
Verfasser hat (Fig. 6).
Es wird daher zu prüfen sein, wie sich die
Einrichtung unserer Gefäfse den Zwecken an-
pafst, die in der Zeit der Kreuzzüge mit ähn-
lichen Gefäfsen erreicht werden sollten. Welche
Füllung und welche Zündung hatten jene Gefäfse?
Ein Gebrauch von Salpeter haltigen Feuerwerks-
sätzen im mohammedischen Orient läfst sich vor
dem Jahre 1248 nicht nachweisen, und auch in
China wird der Salpeter erst im zweiten Viertel
des 13. Jahrhunderts bekannt oder nahm erst damals
eine Bedeutung an, die die Aufmerksamkeit der
Araber auf ihn lenkte. Alle Feuerwerkssätze dieser
Zeit waren nicht explosiv, konnten also auch keine
Sprengwirkung hervorbringen; sie dienten nur zum
Inbrandstecken.
Der Hauptbestandteil dieser Sätze ist das
Naphtha, Oleum incendiarium, nach Plinius von
den Griechen auch Medeaöl genannt, und gleich-
12) Siehe Fig. 5 und Tabelle auf S. 378.
13) Dr. Villaret, Die Handgranate, 1908, S. 15, nachdem
Wiener Armeeblatt von J. v. Karst, Nr. 37, 1906.
48
W.GOHLKE, HANDBRANDGESCHOSSE AUS TON
383
Im Feuerbuch von Marcus Graecus (etwa
1250) und im Bellifortis von Konrad Kyeser (etwa
1405) werden Feuerwerkssätze und Gefäfse und
Geschosse erwähnt; ebenso in dem Feuerwerks-
buch des 15. Jahrhunderts. Aus einer Rechnung
der Stadt Amiens von 1418 geht hervor, dafs die
Brandsätze in Tongefäfse (terrines) oder in Beutel
aus Hammelfellen gestopft wurden, und dafs sie
noch keinen Salpeter enthielten9).
Im 16. Jahrhundert werden in den Werken
der Grafen Reinhard von Solms, von Lienhard
Frönsperger undSchmidlap von Schorndorff irdene
Brandtöpfe (Sturmhafen), Krüglein und Flaschen
mit Brandsatz erwähnt. Der letztgenannte Schrift-
steller zeigt im „khunstlichen und rechtschaffenen
Fewrwerk“, 1561, einen Mann, der im Begriff ist,
eine Handgranate, nachdem er sie mit der rechten
Hand in Brand gesetzt hat, mit der linken fort-
zuschleudern.
Im 17. Jahrhundert kommen nach und nach
an Stelle der Tongefäfse eiserne, bronzene und
gläserne in Aufnahme, daneben werden jedoch
noch in den Feuerwerkskapiteln der Werke von
Boillot, Simienowicz, Lavater u, a. Sturmhäfen,
Sturmkrüge, Sturmflaschen, von Töpfern gefertigt
erwähnt und auch Angaben zum Fertigmachen und
Werfen dieser Geschosse gemacht. 1638 lagen im
bürgerlichen Zeughause zu Wien zum Gebrauch als
Handgranaten Sturmhäfen aus tönernen mit Per-
gamentpapier zugebundenen Töpfen bereit10). Im
Jahre 1686 vor Ofen wurden von den Branden-
burgern unter andern auch sogenannte Topfgrana-
ten mit der Hand geworfen. Es waren mit Brand-
satz gefüllte Töpfe mit vier Henkeln, die aufser-
dem eine, mit Sprengladung gefüllte kleine Granate
aufnehmen, die verhindern sollte, dafs man feind-
licherseits Löscharbeiten vornahm11 *). Im 18. Jahr-
hundert verschwinden die Tongefäfse allmählich.
Fleming, im „Vollkommen deutschen Soldaten“,
1726, sagt: die gläsernen und irdenen Hand-
granaten sind abgeschafft; Geisler im „Neuen curi-
eusen und vollkommenen Artilleristen“, 1708, emp-
fiehlt noch Pottgranaten gegen die Leiterer-
steigung, um den Kerl auf der Leiter damit übel
zu traktieren.
Selbst im 19. Jahrhundert sind die tönernen
Handgeschosse noch nicht ausgestorben. Bei
Kanalisationsarbeiten in Strafsburg am Kronen-
burger Ring wurde eine Anzahl dergleichen Ge-
schosse (mindestens 20 Stück) ausgegraben, die
wahrscheinlich während der Belagerung i. J. 1870
zum Schutze der Bresche dienen sollten; sie hatten
9) Fave Etudes III S. 125.
10) Meynert, Geschichte des Kriegswesens usw. III, S. 19.
u) v. Malinowsky, Geschichte der Brandenburg-Preufs.
Artill. II S. 385.
im Mundloch ein Gewinde, das bei einigen für
den französischen Zünder dieser Zeit pafste. Sie
kamen wahrscheinlich nicht zur Verwendung, weil
bei Zerstörung der Zitadelle die Zündervorräte
vernichtet waren13) und ein Sturm der Werke
nicht stattfand. Endlich verwendeten noch im
Jahre 1884 die Engländer im Sudan Handgeschosse
aus gebranntem Ton oder Steingut, die mit Schiefs-
baumwolle und drei Magnesiumsternen, diese für
Beleuchtungszwecke, gefüllt waren13).
Wie aus Vorstehendem sich ergibt, spricht
alles für die Annahme, dafs unsere Tongefäfse
wohl zu Kriegszwecken benutzt sein könnten und
die geschichtlichen Daten beweisen, dafs derartige
Gefäfse zur Zeit der Kreuzzüge, der man die in
Damaskus gefundenen Granatäpfel zuweisen will,
Fig. 6
als Brandg'eschosse im Gebrauch waren. Diese
Form entspricht zudem den Abbildungen in einem
im asiatischen Museum in Petersburg befindlichen
Manuskript „Sammlung der verschiedenen Zweige
der Kunst“, das vermutlich Schems-Eddin-Mo-
hammed (geb. 1292, gest. 1350 in Damaskus) zum
Verfasser hat (Fig. 6).
Es wird daher zu prüfen sein, wie sich die
Einrichtung unserer Gefäfse den Zwecken an-
pafst, die in der Zeit der Kreuzzüge mit ähn-
lichen Gefäfsen erreicht werden sollten. Welche
Füllung und welche Zündung hatten jene Gefäfse?
Ein Gebrauch von Salpeter haltigen Feuerwerks-
sätzen im mohammedischen Orient läfst sich vor
dem Jahre 1248 nicht nachweisen, und auch in
China wird der Salpeter erst im zweiten Viertel
des 13. Jahrhunderts bekannt oder nahm erst damals
eine Bedeutung an, die die Aufmerksamkeit der
Araber auf ihn lenkte. Alle Feuerwerkssätze dieser
Zeit waren nicht explosiv, konnten also auch keine
Sprengwirkung hervorbringen; sie dienten nur zum
Inbrandstecken.
Der Hauptbestandteil dieser Sätze ist das
Naphtha, Oleum incendiarium, nach Plinius von
den Griechen auch Medeaöl genannt, und gleich-
12) Siehe Fig. 5 und Tabelle auf S. 378.
13) Dr. Villaret, Die Handgranate, 1908, S. 15, nachdem
Wiener Armeeblatt von J. v. Karst, Nr. 37, 1906.
48