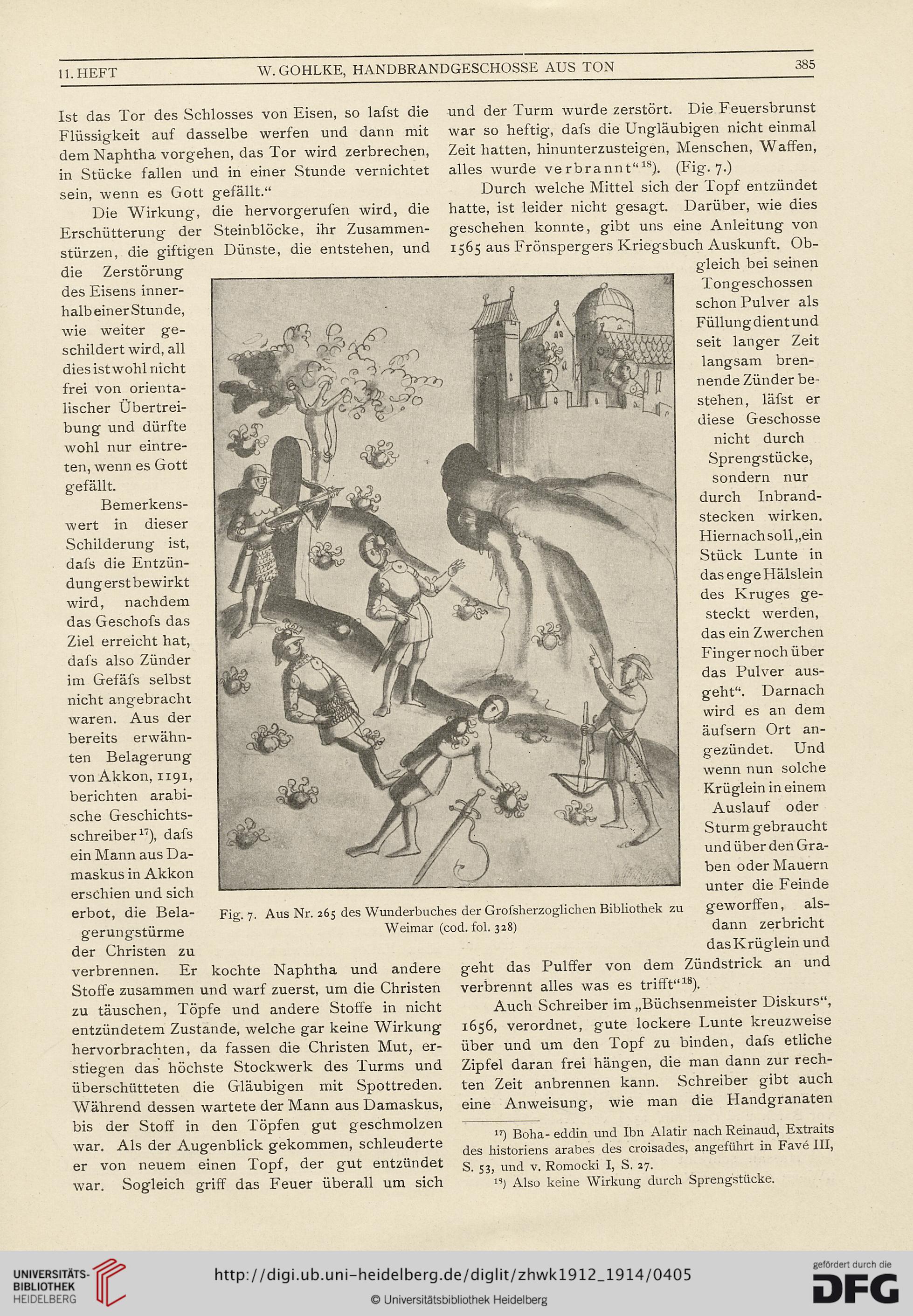11. HEFT
W. GOHLKE, HANDBRANDGESCHOSSE AUS TON
385
Ist das Tor des Schlosses von Eisen, so lafst die
Flüssigkeit auf dasselbe werfen und dann mit
dem Naphtha vorgehen, das Tor wird zerbrechen,
in Stücke fallen und in einer Stunde vernichtet
sein, wenn es Gott gefällt.“
Die Wirkung, die hervorgerufen wird, die
Erschütterung der Steinblöcke, ihr Zusammen-
stürzen, die giftigen Dünste, die entstehen, und
die Zerstörung
des Eisens inner-
halb einer Stunde,
wie weiter ge-
schildert wird, all
dies ist wohl nicht
frei von orienta-
lischer Übertrei-
bung und dürfte
wohl nur eintre-
ten, wenn es Gott
gefällt.
Bemerkens-
wert in dieser
Schilderung ist,
dafs die Entzün-
dung erst bewirkt
wird, nachdem
das Geschofs das
Ziel erreicht hat,
dafs also Zünder
im Gefäfs selbst
nicht angebracht
waren. Aus der
bereits erwähn-
ten Belagerung
von Akkon, 1191,
berichten arabi-
sche Geschichts-
schreiber17), dafs
ein Mann aus Da-
maskus in Akkon
erschien und sich
erbot, die Bela-
gerungstürme
der Christen zu
verbrennen. Er kochte Naphtha und andere
Stoffe zusammen und warf zuerst, um die Christen
zu täuschen, Töpfe und andere Stoffe in nicht
entzündetem Zustande, welche gar keine Wirkung
hervorbrachten, da fassen die Christen Mut, er-
stiegen das höchste Stockwerk des Turms und
überschütteten die Gläubigen mit Spottreden.
Während dessen wartete der Mann aus Damaskus,
bis der Stoff in den Töpfen gut geschmolzen
war. Als der Augenblick gekommen, schleuderte
er von neuem einen Topf, der gut entzündet
war. Sogleich griff das Feuer überall um sich
und der Turm wurde zerstört. Die Feuersbrunst
war so heftig, dafs die Ungläubigen nicht einmal
Zeit hatten, hinunterzusteigen, Menschen, Waffen,
alles wurde verbrannt“18). (Fig. 7.)
Durch welche Mittel sich der Topf entzündet
hatte, ist leider nicht gesagt. Darüber, wie dies
geschehen konnte, gibt uns eine Anleitung von
1565 aus Frönspergers Kriegsbuch Auskunft. Ob-
gleich bei seinen
Tongeschossen
schon Pulver als
Füllungdientund
seit langer Zeit
langsam bren-
nende Zünder be-
stehen, läfst er
diese Geschosse
nicht durch
Sprengstücke,
sondern nur
durch Inbrand-
stecken wirken.
Hiernach soll„ein
Stück Lunte in
das enge Hälslein
des Kruges ge-
steckt werden,
das ein Zwerchen
Finger noch über
das Pulver aus-
geht“. Darnach
wird es an dem
äufsern Ort an-
gezündet. Und
wenn nun solche
Krüglein in einem
Auslauf oder
Sturm gebraucht
und über den Gra-
ben oder Mauern
unter die Feinde
geworffen, als-
dann zerbricht
das Krüglein und
geht das Pulffer von dem Zündstrick an und
verbrennt alles was es trifft“18).
Auch Schreiber im „Büchsenmeister Diskurs“,
1656, verordnet, gute lockere Lunte kreuzweise
über und um den Topf zu binden, dafs etliche
Zipfel daran frei hängen, die man dann zur rech-
ten Zeit anbrennen kann. Schreiber gibt auch
eine Anweisung, wie man die Handgranaten
”) Boha- eddin und Ibn Alatir nach Reinaud, Extraits
des historiens arabes des croisades, angeführt in Fave III,
S. 53, und v. Romocki I, S. 27.
1S) Also keine Wirkung durch Sprengstücke.
Fig. 7. Aus Nr. 265 des Wunderbuches der Grofsherzoglichen Bibliothek zu
Weimar (cod. fol. 328)
W. GOHLKE, HANDBRANDGESCHOSSE AUS TON
385
Ist das Tor des Schlosses von Eisen, so lafst die
Flüssigkeit auf dasselbe werfen und dann mit
dem Naphtha vorgehen, das Tor wird zerbrechen,
in Stücke fallen und in einer Stunde vernichtet
sein, wenn es Gott gefällt.“
Die Wirkung, die hervorgerufen wird, die
Erschütterung der Steinblöcke, ihr Zusammen-
stürzen, die giftigen Dünste, die entstehen, und
die Zerstörung
des Eisens inner-
halb einer Stunde,
wie weiter ge-
schildert wird, all
dies ist wohl nicht
frei von orienta-
lischer Übertrei-
bung und dürfte
wohl nur eintre-
ten, wenn es Gott
gefällt.
Bemerkens-
wert in dieser
Schilderung ist,
dafs die Entzün-
dung erst bewirkt
wird, nachdem
das Geschofs das
Ziel erreicht hat,
dafs also Zünder
im Gefäfs selbst
nicht angebracht
waren. Aus der
bereits erwähn-
ten Belagerung
von Akkon, 1191,
berichten arabi-
sche Geschichts-
schreiber17), dafs
ein Mann aus Da-
maskus in Akkon
erschien und sich
erbot, die Bela-
gerungstürme
der Christen zu
verbrennen. Er kochte Naphtha und andere
Stoffe zusammen und warf zuerst, um die Christen
zu täuschen, Töpfe und andere Stoffe in nicht
entzündetem Zustande, welche gar keine Wirkung
hervorbrachten, da fassen die Christen Mut, er-
stiegen das höchste Stockwerk des Turms und
überschütteten die Gläubigen mit Spottreden.
Während dessen wartete der Mann aus Damaskus,
bis der Stoff in den Töpfen gut geschmolzen
war. Als der Augenblick gekommen, schleuderte
er von neuem einen Topf, der gut entzündet
war. Sogleich griff das Feuer überall um sich
und der Turm wurde zerstört. Die Feuersbrunst
war so heftig, dafs die Ungläubigen nicht einmal
Zeit hatten, hinunterzusteigen, Menschen, Waffen,
alles wurde verbrannt“18). (Fig. 7.)
Durch welche Mittel sich der Topf entzündet
hatte, ist leider nicht gesagt. Darüber, wie dies
geschehen konnte, gibt uns eine Anleitung von
1565 aus Frönspergers Kriegsbuch Auskunft. Ob-
gleich bei seinen
Tongeschossen
schon Pulver als
Füllungdientund
seit langer Zeit
langsam bren-
nende Zünder be-
stehen, läfst er
diese Geschosse
nicht durch
Sprengstücke,
sondern nur
durch Inbrand-
stecken wirken.
Hiernach soll„ein
Stück Lunte in
das enge Hälslein
des Kruges ge-
steckt werden,
das ein Zwerchen
Finger noch über
das Pulver aus-
geht“. Darnach
wird es an dem
äufsern Ort an-
gezündet. Und
wenn nun solche
Krüglein in einem
Auslauf oder
Sturm gebraucht
und über den Gra-
ben oder Mauern
unter die Feinde
geworffen, als-
dann zerbricht
das Krüglein und
geht das Pulffer von dem Zündstrick an und
verbrennt alles was es trifft“18).
Auch Schreiber im „Büchsenmeister Diskurs“,
1656, verordnet, gute lockere Lunte kreuzweise
über und um den Topf zu binden, dafs etliche
Zipfel daran frei hängen, die man dann zur rech-
ten Zeit anbrennen kann. Schreiber gibt auch
eine Anweisung, wie man die Handgranaten
”) Boha- eddin und Ibn Alatir nach Reinaud, Extraits
des historiens arabes des croisades, angeführt in Fave III,
S. 53, und v. Romocki I, S. 27.
1S) Also keine Wirkung durch Sprengstücke.
Fig. 7. Aus Nr. 265 des Wunderbuches der Grofsherzoglichen Bibliothek zu
Weimar (cod. fol. 328)