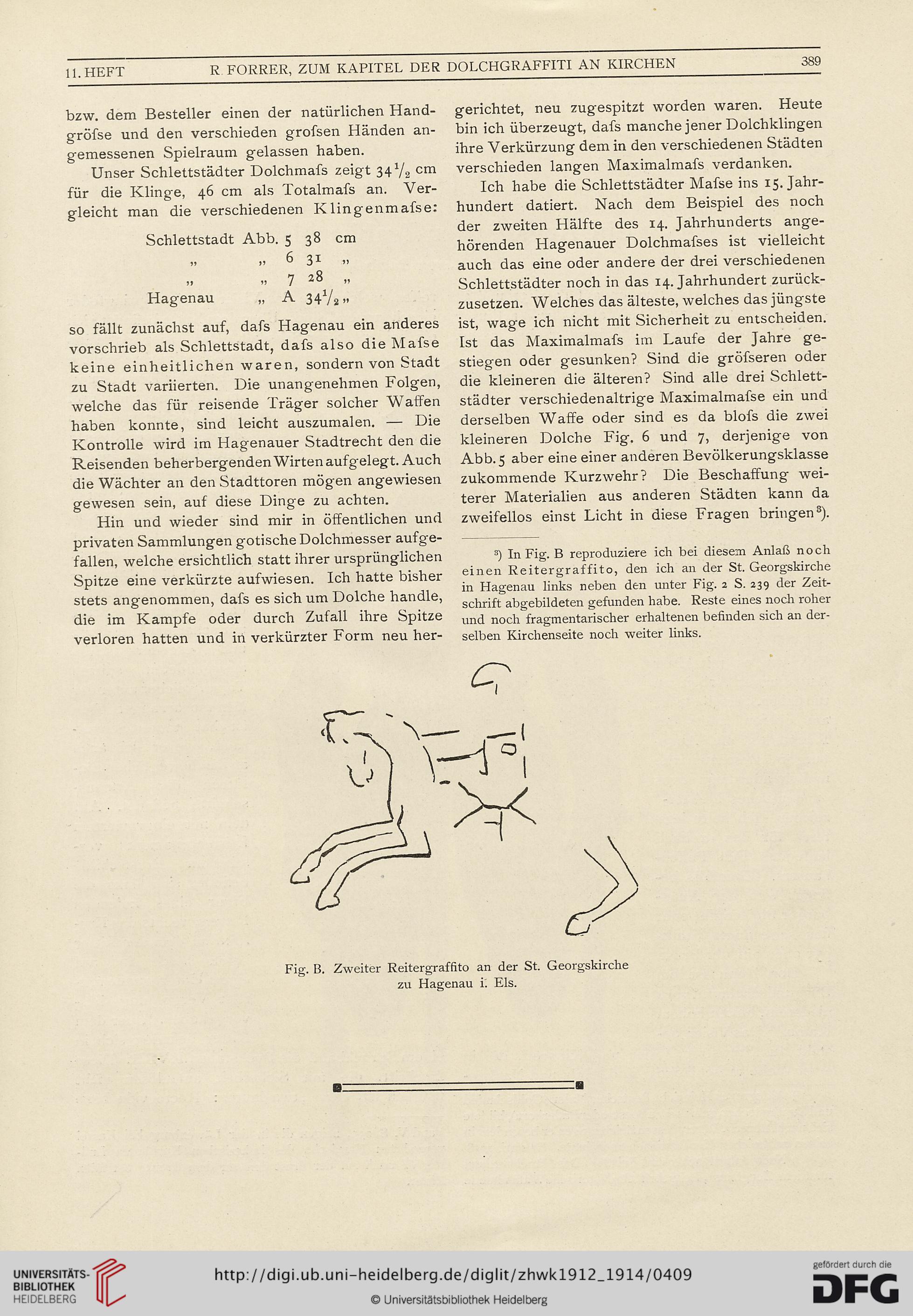11. HEFT
R FORRER, ZUM KAPITEL DER DOLCHGRAFFITI AN KIRCHEN
389
bzw. dem Besteller einen der natürlichen Hand-
gröfse und den verschieden grofsen Händen an-
gemessenen Spielraum gelassen haben.
Unser Schlettstädter Dolchmafs zeigt 341/2 cm
für die Klinge, 46 cm als Totalmafs an. Ver-
gleicht man die verschiedenen Klingenmafse:
Schlettstadt Abb. 5 38 cm
i» »> 6 3 * ji
„ „ 7 28 .»
Hagenau „ A 34Va>-
so fällt zunächst auf, dafs Hagenau ein anderes
vorschrieb als Schlettstadt, dafs also die Mafse
keine einheitlichen waren, sondern von Stadt
zu Stadt variierten. Die unangenehmen Folgen,
welche das für reisende Träger solcher Waffen
haben konnte, sind leicht auszumalen. — Die
Kontrolle wird im Hagenauer Stadtrecht den die
Reisenden beherbergenden Wirten aufgelegt. Auch
die Wächter an den Stadttoren mögen angewiesen
gewesen sein, auf diese Dinge zu achten.
Hin und wieder sind mir in öffentlichen und
privaten Sammlungen gotische Dolchmesser aufge-
fallen, welche ersichtlich statt ihrer ursprünglichen
Spitze eine verkürzte aufwiesen. Ich hatte bisher
stets angenommen, dafs es sich um Dolche handle,
die im Kampfe oder durch Zufall ihre Spitze
verloren hatten und in verkürzter Form neu her-
gerichtet, neu zugespitzt worden waren. Heute
bin ich überzeugt, dafs manche jener Dolchklingen
ihre Verkürzung dem in den verschiedenen Städten
verschieden langen Maximalmafs verdanken.
Ich habe die Schlettstädter Mafse ins 15. Jahr-
hundert datiert. Nach dem Beispiel des noch
der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts ange-
hörenden Hagenauer Dolchmafses ist vielleicht
auch das eine oder andere der drei verschiedenen
Schlettstädter noch in das 14. Jahrhundert zurück-
zusetzen. Welches das älteste, welches das jüngste
ist, wage ich nicht mit Sicherheit zu entscheiden.
Ist das Maximalmafs im Laufe der Jahre ge-
stiegen oder gesunken? Sind die gröfseren oder
die kleineren die älteren? Sind alle drei Schlett-
städter verschiedenaltrige Maximalmafse ein und
derselben Waffe oder sind es da blofs die zwei
kleineren Dolche Fig. 6 und 7, derjenige von
Abb.5 aber eine einer anderen Bevölkerungsklasse
zukommende Kurzwehr? Die Beschaffung wei-
terer Materialien aus anderen Städten kann da
zweifellos einst Licht in diese Fragen bringen3).
s) In Fig. B reproduziere ich bei diesem Anlaß noch
einen Reitergraffito, den ich an der St. Georgskirche
in Hagenau links neben den unter Fig. 2 S. 239 der Zeit-
schrift abgebildeten gefunden habe. Reste eines noch roher
und noch fragmentarischer erhaltenen befinden sich an der-
selben Kirchenseite noch weiter links.
Fig. B. Zweiter Reitergraffito an der St. Georgskirche
zu Hagenau i. Eis.
R FORRER, ZUM KAPITEL DER DOLCHGRAFFITI AN KIRCHEN
389
bzw. dem Besteller einen der natürlichen Hand-
gröfse und den verschieden grofsen Händen an-
gemessenen Spielraum gelassen haben.
Unser Schlettstädter Dolchmafs zeigt 341/2 cm
für die Klinge, 46 cm als Totalmafs an. Ver-
gleicht man die verschiedenen Klingenmafse:
Schlettstadt Abb. 5 38 cm
i» »> 6 3 * ji
„ „ 7 28 .»
Hagenau „ A 34Va>-
so fällt zunächst auf, dafs Hagenau ein anderes
vorschrieb als Schlettstadt, dafs also die Mafse
keine einheitlichen waren, sondern von Stadt
zu Stadt variierten. Die unangenehmen Folgen,
welche das für reisende Träger solcher Waffen
haben konnte, sind leicht auszumalen. — Die
Kontrolle wird im Hagenauer Stadtrecht den die
Reisenden beherbergenden Wirten aufgelegt. Auch
die Wächter an den Stadttoren mögen angewiesen
gewesen sein, auf diese Dinge zu achten.
Hin und wieder sind mir in öffentlichen und
privaten Sammlungen gotische Dolchmesser aufge-
fallen, welche ersichtlich statt ihrer ursprünglichen
Spitze eine verkürzte aufwiesen. Ich hatte bisher
stets angenommen, dafs es sich um Dolche handle,
die im Kampfe oder durch Zufall ihre Spitze
verloren hatten und in verkürzter Form neu her-
gerichtet, neu zugespitzt worden waren. Heute
bin ich überzeugt, dafs manche jener Dolchklingen
ihre Verkürzung dem in den verschiedenen Städten
verschieden langen Maximalmafs verdanken.
Ich habe die Schlettstädter Mafse ins 15. Jahr-
hundert datiert. Nach dem Beispiel des noch
der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts ange-
hörenden Hagenauer Dolchmafses ist vielleicht
auch das eine oder andere der drei verschiedenen
Schlettstädter noch in das 14. Jahrhundert zurück-
zusetzen. Welches das älteste, welches das jüngste
ist, wage ich nicht mit Sicherheit zu entscheiden.
Ist das Maximalmafs im Laufe der Jahre ge-
stiegen oder gesunken? Sind die gröfseren oder
die kleineren die älteren? Sind alle drei Schlett-
städter verschiedenaltrige Maximalmafse ein und
derselben Waffe oder sind es da blofs die zwei
kleineren Dolche Fig. 6 und 7, derjenige von
Abb.5 aber eine einer anderen Bevölkerungsklasse
zukommende Kurzwehr? Die Beschaffung wei-
terer Materialien aus anderen Städten kann da
zweifellos einst Licht in diese Fragen bringen3).
s) In Fig. B reproduziere ich bei diesem Anlaß noch
einen Reitergraffito, den ich an der St. Georgskirche
in Hagenau links neben den unter Fig. 2 S. 239 der Zeit-
schrift abgebildeten gefunden habe. Reste eines noch roher
und noch fragmentarischer erhaltenen befinden sich an der-
selben Kirchenseite noch weiter links.
Fig. B. Zweiter Reitergraffito an der St. Georgskirche
zu Hagenau i. Eis.