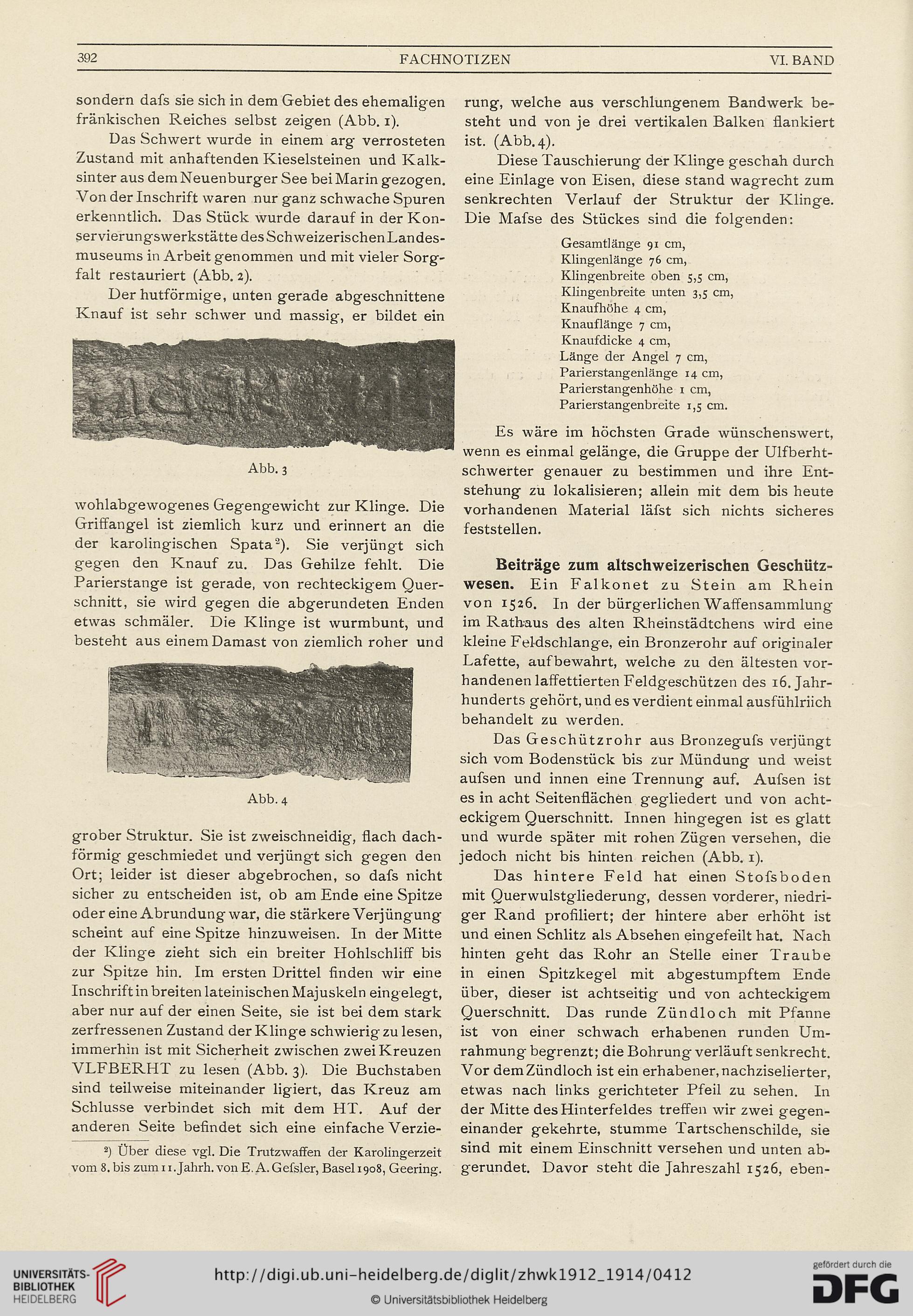392
FACHNOTIZEN
VI. BAND
sondern dafs sie sich in dem Gebiet des ehemaligen
fränkischen Reiches selbst zeigen (Abb. i).
Das Schwert wurde in einem arg verrosteten
Zustand mit anhaftenden Kieselsteinen und Kalk-
sinter aus dem Neuenburger See bei Marin gezogen.
Von der Inschrift waren nur ganz schwache Spuren
erkenntlich. Das Stück wurde darauf in der Kon-
servierungswerkstätte des Schweizerischen Landes-
museums in Arbeit genommen und mit vieler Sorg-
falt restauriert (Abb. 2).
Der hutförmige, unten gerade abgeschnittene
Knauf ist sehr schwer und massig, er bildet ein
Abb. 3
wohlabgewogenes Gegengewicht zur Klinge. Die
Griffangel ist ziemlich kurz und erinnert an die
der karolingischen Spata2). Sie verjüngt sich
gegen den Knauf zu. Das Gehilze fehlt. Die
Parierstange ist gerade, von rechteckigem Quer-
schnitt, sie wird gegen die abgerundeten Enden
etwas schmäler. Die Klinge ist wurmbunt, und
besteht aus einem Damast von ziemlich roher und
Abb. 4
grober Struktur. Sie ist zweischneidig, flach dach-
förmig geschmiedet und verjüngt sich gegen den
Ort; leider ist dieser abgebrochen, so dafs nicht
sicher zu entscheiden ist, ob am Ende eine Spitze
oder eine Abrundung war, die stärkere Verjüngung
scheint auf eine Spitze hinzuweisen. In der Mitte
der Klinge zieht sich ein breiter Hohlschliff bis
zur Spitze hin. Im ersten Drittel finden wir eine
Inschrift in breiten lateinischen Majuskeln eing elegt,
aber nur auf der einen Seite, sie ist bei dem stark
zerfressenen Zustand der Klinge schwierig zu lesen,
immerhin ist mit Sicherheit zwischen zwei Kreuzen
VLFBERHT zu lesen (Abb. 3). Die Buchstaben
sind teilweise miteinander ligiert, das Kreuz am
Schlüsse verbindet sich mit dem HT. Auf der
anderen Seite befindet sich eine einfache Verzie-
2) Über diese vgl. Die Trutzwaffen der Karolingerzeit
vom 8.bis zumn.Jahrh.vonE. A.Gefsler, Baseli<)o8, Geering.
rung, welche aus verschlungenem Bandwerk be-
steht und von je drei vertikalen Balken flankiert
ist. (Abb. 4).
Diese Tauschierung der Klinge geschah durch
eine Einlage von Eisen, diese stand wagrecht zum
senkrechten Verlauf der Struktur der Klinge.
Die Mafse des Stückes sind die folgenden:
Gesamtlänge 91 cm,
Klingenlänge 76 cm,
Klingenbreite oben 5,5 cm,
Klingenbreite unten 3,5 cm,
Knaufhöhe 4 cm,
Knauflänge 7 cm,
Knaufdicke 4 cm,
Länge der Angel 7 cm,
Parierstangenlänge 14 cm,
Parierstangenhöhe 1 cm,
Parierstangenbreite 1,5 cm.
Es wäre im höchsten Grade wünschenswert,
wenn es einmal gelänge, die Gruppe der Ulfberht-
schwerter genauer zu bestimmen und ihre Ent-
stehung zu lokalisieren; allein mit dem bis heute
vorhandenen Material läfst sich nichts sicheres
feststellen.
Beiträge zum altschweizerischen Geschütz-
wesen. Ein Falkonet zu Stein am Rhein
von 1526. In der bürgerlichen Waffensammlung
im Rathaus des alten Rheinstädtchens wird eine
kleine Feldschlange, ein Bronzerohr auf originaler
Lafette, aufbewahrt, welche zu den ältesten vor-
handenen laffettierten Feldgeschützen des 16. Jahr-
hunderts gehört, und es verdient einmal ausfühlriich
behandelt zu werden.
Das Geschützrohr aus Bronzegufs verjüngt
sich vom Bodenstück bis zur Mündung und weist
aufsen und innen eine Trennung auf. Aufsen ist
es in acht Seitenflächen gegliedert und von acht-
eckigem Querschnitt. Innen hingegen ist es glatt
und wurde später mit rohen Zügen versehen, die
jedoch nicht bis hinten reichen (Abb. 1).
Das hintere Feld hat einen Stofsboden
mit Querwulstgliederung, dessen vorderer, niedri-
ger Rand profiliert; der hintere aber erhöht ist
und einen Schlitz als Absehen eingefeilt hat. Nach
hinten geht das Rohr an Stelle einer Traube
in einen Spitzkegel mit abgestumpftem Ende
über, dieser ist achtseitig und von achteckigem
Querschnitt. Das runde Zündloch mit Pfanne
ist von einer schwach erhabenen runden Um-
rahmung begrenzt; die Bohrung verläuft senkrecht.
Vor dem Zündloch ist ein erhabener, nachziselierter,
etwas nach links gerichteter Pfeil zu sehen. In
der Mitte des Hinterfeldes treffen wir zwei gegen-
einander gekehrte, stumme Tartschenschilde, sie
sind mit einem Einschnitt versehen und unten ab-
gerundet. Davor steht die Jahreszahl 1526, eben-
FACHNOTIZEN
VI. BAND
sondern dafs sie sich in dem Gebiet des ehemaligen
fränkischen Reiches selbst zeigen (Abb. i).
Das Schwert wurde in einem arg verrosteten
Zustand mit anhaftenden Kieselsteinen und Kalk-
sinter aus dem Neuenburger See bei Marin gezogen.
Von der Inschrift waren nur ganz schwache Spuren
erkenntlich. Das Stück wurde darauf in der Kon-
servierungswerkstätte des Schweizerischen Landes-
museums in Arbeit genommen und mit vieler Sorg-
falt restauriert (Abb. 2).
Der hutförmige, unten gerade abgeschnittene
Knauf ist sehr schwer und massig, er bildet ein
Abb. 3
wohlabgewogenes Gegengewicht zur Klinge. Die
Griffangel ist ziemlich kurz und erinnert an die
der karolingischen Spata2). Sie verjüngt sich
gegen den Knauf zu. Das Gehilze fehlt. Die
Parierstange ist gerade, von rechteckigem Quer-
schnitt, sie wird gegen die abgerundeten Enden
etwas schmäler. Die Klinge ist wurmbunt, und
besteht aus einem Damast von ziemlich roher und
Abb. 4
grober Struktur. Sie ist zweischneidig, flach dach-
förmig geschmiedet und verjüngt sich gegen den
Ort; leider ist dieser abgebrochen, so dafs nicht
sicher zu entscheiden ist, ob am Ende eine Spitze
oder eine Abrundung war, die stärkere Verjüngung
scheint auf eine Spitze hinzuweisen. In der Mitte
der Klinge zieht sich ein breiter Hohlschliff bis
zur Spitze hin. Im ersten Drittel finden wir eine
Inschrift in breiten lateinischen Majuskeln eing elegt,
aber nur auf der einen Seite, sie ist bei dem stark
zerfressenen Zustand der Klinge schwierig zu lesen,
immerhin ist mit Sicherheit zwischen zwei Kreuzen
VLFBERHT zu lesen (Abb. 3). Die Buchstaben
sind teilweise miteinander ligiert, das Kreuz am
Schlüsse verbindet sich mit dem HT. Auf der
anderen Seite befindet sich eine einfache Verzie-
2) Über diese vgl. Die Trutzwaffen der Karolingerzeit
vom 8.bis zumn.Jahrh.vonE. A.Gefsler, Baseli<)o8, Geering.
rung, welche aus verschlungenem Bandwerk be-
steht und von je drei vertikalen Balken flankiert
ist. (Abb. 4).
Diese Tauschierung der Klinge geschah durch
eine Einlage von Eisen, diese stand wagrecht zum
senkrechten Verlauf der Struktur der Klinge.
Die Mafse des Stückes sind die folgenden:
Gesamtlänge 91 cm,
Klingenlänge 76 cm,
Klingenbreite oben 5,5 cm,
Klingenbreite unten 3,5 cm,
Knaufhöhe 4 cm,
Knauflänge 7 cm,
Knaufdicke 4 cm,
Länge der Angel 7 cm,
Parierstangenlänge 14 cm,
Parierstangenhöhe 1 cm,
Parierstangenbreite 1,5 cm.
Es wäre im höchsten Grade wünschenswert,
wenn es einmal gelänge, die Gruppe der Ulfberht-
schwerter genauer zu bestimmen und ihre Ent-
stehung zu lokalisieren; allein mit dem bis heute
vorhandenen Material läfst sich nichts sicheres
feststellen.
Beiträge zum altschweizerischen Geschütz-
wesen. Ein Falkonet zu Stein am Rhein
von 1526. In der bürgerlichen Waffensammlung
im Rathaus des alten Rheinstädtchens wird eine
kleine Feldschlange, ein Bronzerohr auf originaler
Lafette, aufbewahrt, welche zu den ältesten vor-
handenen laffettierten Feldgeschützen des 16. Jahr-
hunderts gehört, und es verdient einmal ausfühlriich
behandelt zu werden.
Das Geschützrohr aus Bronzegufs verjüngt
sich vom Bodenstück bis zur Mündung und weist
aufsen und innen eine Trennung auf. Aufsen ist
es in acht Seitenflächen gegliedert und von acht-
eckigem Querschnitt. Innen hingegen ist es glatt
und wurde später mit rohen Zügen versehen, die
jedoch nicht bis hinten reichen (Abb. 1).
Das hintere Feld hat einen Stofsboden
mit Querwulstgliederung, dessen vorderer, niedri-
ger Rand profiliert; der hintere aber erhöht ist
und einen Schlitz als Absehen eingefeilt hat. Nach
hinten geht das Rohr an Stelle einer Traube
in einen Spitzkegel mit abgestumpftem Ende
über, dieser ist achtseitig und von achteckigem
Querschnitt. Das runde Zündloch mit Pfanne
ist von einer schwach erhabenen runden Um-
rahmung begrenzt; die Bohrung verläuft senkrecht.
Vor dem Zündloch ist ein erhabener, nachziselierter,
etwas nach links gerichteter Pfeil zu sehen. In
der Mitte des Hinterfeldes treffen wir zwei gegen-
einander gekehrte, stumme Tartschenschilde, sie
sind mit einem Einschnitt versehen und unten ab-
gerundet. Davor steht die Jahreszahl 1526, eben-