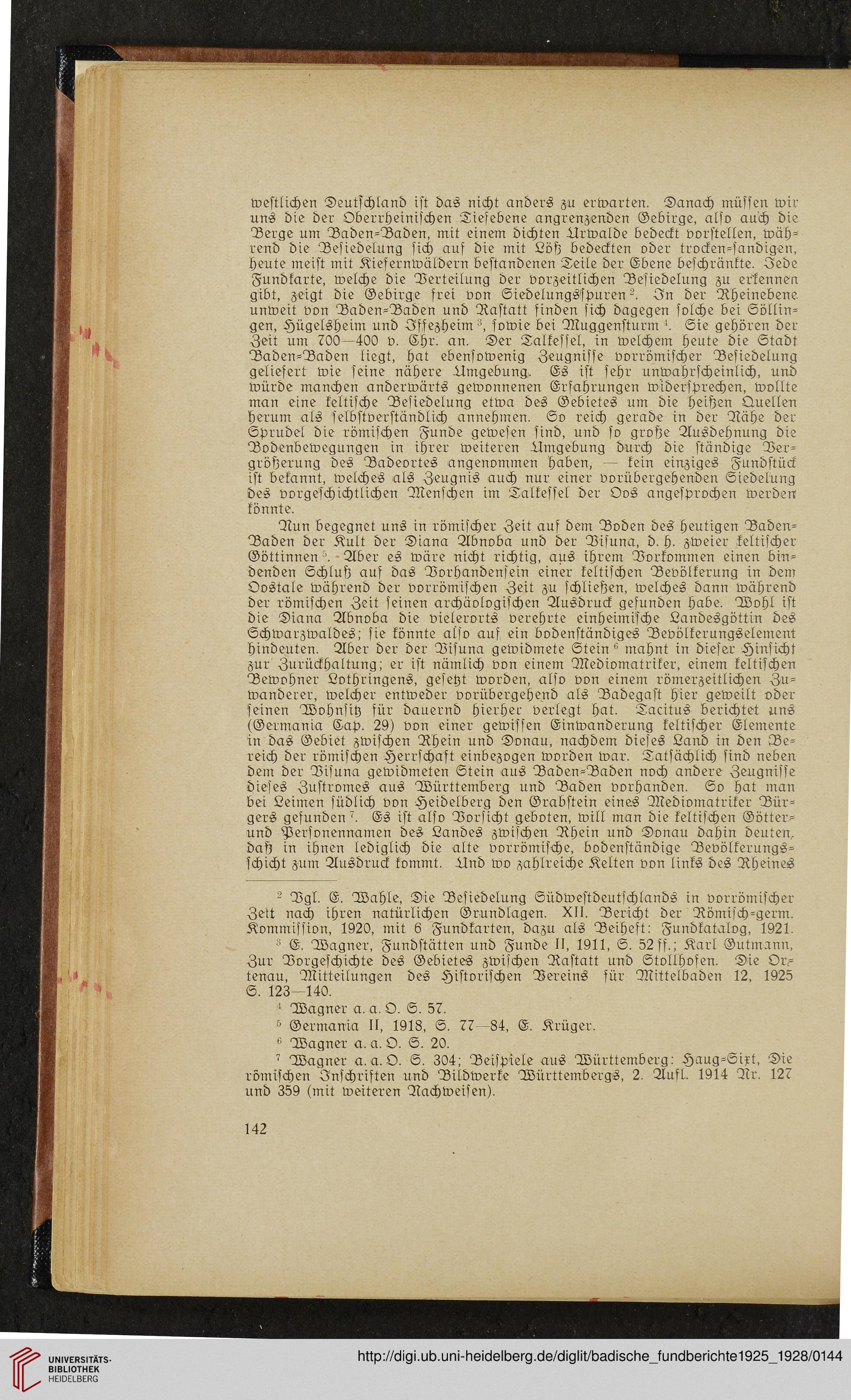westlichen Deutfchland ist das nichl anöers zu erwarlen. Danach müssen wir
uns die der Oberrheinischen Tiefebene angrenzenöen Gebirge, also auch die
Berge um Baden-Baden, mit einem öichten stlrwalde bedeckt vorstellen, wäh-
rend die Besieöelung sich auf öie mit Löst bedeckten oder trocken-sandigen,
Heute meist mit Kiefernwäldern bestandenen Teile der Ebene beschränkte. Jede
Fundkarte, welche die Derteilung der vorzeitlichen Besiedelung zu ertennen
gibt, zeigt die Gebirge frei von SiedelungsspurenJn öer Rheinebene
unweit von Daden-Baden und Rastatt finden sich öagegen solche bei Söllin-
gen, Hügelsheim und Jffezheim sowie bei Muggensturm p Sie gehören der
Zeit um 700—400 v. Chr. an. Der Talkessel, in welchem heute die Stadt
Baden-Baden liegt, hat ebensowenig Zeugnisse vorrömischer Besiedelung
geliefert wie seine nähere Llmgebung. Es ist sehr unwahrscheinlich, unL
würde manchen anderwärts gewonnenen Erfahrungen w'idersprechen, wvllte
man eine keltische Besiedelung etwa öes Gebietes um die heisten Quellen
herum als selbstverständlich annehmen. So reich gerade in öer Bähe der
Sprudel die römischen Funde gewesen sind, und so groste Ausdehnung die
Bodenbewegungen in ihrer weiteren Llmgebung durch öie ständigs Der-
gröherung des Badeortes angenommen 'haben, — kein einziges Fundstück
ist bekannt, welches als Zeugnis auch nur einer vorübergehenden Siedelung
des vorgeschichtlichen Menschen im Talkessel öer Oos angesprochen werden
könnte.
Bun begegnet uns in römischer Zeit auf dem Boden des heutigen Baden-
Baden der Kult der Diana Älbnoba und der Bisuna, d. h. zweier keltischer
Göttinnen Älber es wäre nicht richtig, aus ihrem Dorkommen einen bin-
denden Schlust auf das Borhandensein einer keltischen Bevölkerung in öem
Oostale während der vorrömischen Zeit zu schliehen, welches öann während
der römischen Zeit seinen archäolvgischen Ausdruck gefunden habe. Wohl ist
die Diana Abnoba die vielerorts verehrte einheimische Landesgöttin öes
Schwarzwaldes: sie könnte also auf ein bodenständiges Bevölkerungselement
hindeuten. 2lber der öer Bisuna gewidmete Stein ^ mahnt in dieser Hinsicht
zur Zurückhaltung; er ist nämlich von einem Mediomatriker, einem keltischen
Bewohner Lothringens, geseht worden, also von einem römerzeitlichen Zu-
wanderer, welcher entweder vorübergehend als Badegast hier geweilt oder
seinen Wohnsitz für dauernd hierher verlegt hat. Tacitus berichtet uns
(Germania Cap. 29) von einer gewissen Einwanderung keltischer Elemente
in das Gebiet zwischen Bhein und Donau, nachdem dieses Land in öen Be-
reich der römischen Herrschaft einbezvgen worden war. Tatsächlich sind neben
dem der Disuna gewidmeten Stein aus Daden-Baden noch andere Zeugnisse
dieses Zustromes aus Württemberg und Baden vorhanden. So hat man
bei Leimen südlich von Heidelberg den Grabstein eines Mediomatriker Bür-
gers gefunderw. Es ist akso Dorsicht geboten, will man öie keltischen Götter-
und Personennamen des Landes zwischen Rhein unö Donau dahin deuten,
dah in ihnen lediglich öie alte vorrömische, bodenständige Bevölkerungs-
schicht zum Älusdruck kvmmt. äknd wo zahlreiche Kelten von links des Rheines
^ Bgl. E. Wahle, Die Besiedelung Südwestdeutschlands in vorrömischer
Zeit nach ihren natürlichen Grundlagen. XII. Bericht der Römisch-germ.
Kommission, 1920, mit 6 Fundkarten, dazu als Beiheft: Fundkatalog, 1921.
s E. Wagner, Fundstätten und Funde II, 1911, S. 52 ff.; Karl Gutmann,
Zur Borgeschichke des Gebietes zwischen Rastatt und Stollhosen. Die Or^
tenau, Mitteilungen des Historischen Bereins für Mittelbaden 12, 1925
S. 123—140.
^ Wagner a. a.O. S. 57.
5 Germania II, 1918, S. 77—84, E. Krüger.
6 Wagner a. a. O. S. 20.
? Wagner a. a. O. S. 304; Beispiele aus Württemberg: Haug-Sixt, Die
römischen Jnschriften und Bildwerke Württembergs, 2. Aufl. 1914 Är. 127
und 359 (mit weiteren Bachweisen).
142
uns die der Oberrheinischen Tiefebene angrenzenöen Gebirge, also auch die
Berge um Baden-Baden, mit einem öichten stlrwalde bedeckt vorstellen, wäh-
rend die Besieöelung sich auf öie mit Löst bedeckten oder trocken-sandigen,
Heute meist mit Kiefernwäldern bestandenen Teile der Ebene beschränkte. Jede
Fundkarte, welche die Derteilung der vorzeitlichen Besiedelung zu ertennen
gibt, zeigt die Gebirge frei von SiedelungsspurenJn öer Rheinebene
unweit von Daden-Baden und Rastatt finden sich öagegen solche bei Söllin-
gen, Hügelsheim und Jffezheim sowie bei Muggensturm p Sie gehören der
Zeit um 700—400 v. Chr. an. Der Talkessel, in welchem heute die Stadt
Baden-Baden liegt, hat ebensowenig Zeugnisse vorrömischer Besiedelung
geliefert wie seine nähere Llmgebung. Es ist sehr unwahrscheinlich, unL
würde manchen anderwärts gewonnenen Erfahrungen w'idersprechen, wvllte
man eine keltische Besiedelung etwa öes Gebietes um die heisten Quellen
herum als selbstverständlich annehmen. So reich gerade in öer Bähe der
Sprudel die römischen Funde gewesen sind, und so groste Ausdehnung die
Bodenbewegungen in ihrer weiteren Llmgebung durch öie ständigs Der-
gröherung des Badeortes angenommen 'haben, — kein einziges Fundstück
ist bekannt, welches als Zeugnis auch nur einer vorübergehenden Siedelung
des vorgeschichtlichen Menschen im Talkessel öer Oos angesprochen werden
könnte.
Bun begegnet uns in römischer Zeit auf dem Boden des heutigen Baden-
Baden der Kult der Diana Älbnoba und der Bisuna, d. h. zweier keltischer
Göttinnen Älber es wäre nicht richtig, aus ihrem Dorkommen einen bin-
denden Schlust auf das Borhandensein einer keltischen Bevölkerung in öem
Oostale während der vorrömischen Zeit zu schliehen, welches öann während
der römischen Zeit seinen archäolvgischen Ausdruck gefunden habe. Wohl ist
die Diana Abnoba die vielerorts verehrte einheimische Landesgöttin öes
Schwarzwaldes: sie könnte also auf ein bodenständiges Bevölkerungselement
hindeuten. 2lber der öer Bisuna gewidmete Stein ^ mahnt in dieser Hinsicht
zur Zurückhaltung; er ist nämlich von einem Mediomatriker, einem keltischen
Bewohner Lothringens, geseht worden, also von einem römerzeitlichen Zu-
wanderer, welcher entweder vorübergehend als Badegast hier geweilt oder
seinen Wohnsitz für dauernd hierher verlegt hat. Tacitus berichtet uns
(Germania Cap. 29) von einer gewissen Einwanderung keltischer Elemente
in das Gebiet zwischen Bhein und Donau, nachdem dieses Land in öen Be-
reich der römischen Herrschaft einbezvgen worden war. Tatsächlich sind neben
dem der Disuna gewidmeten Stein aus Daden-Baden noch andere Zeugnisse
dieses Zustromes aus Württemberg und Baden vorhanden. So hat man
bei Leimen südlich von Heidelberg den Grabstein eines Mediomatriker Bür-
gers gefunderw. Es ist akso Dorsicht geboten, will man öie keltischen Götter-
und Personennamen des Landes zwischen Rhein unö Donau dahin deuten,
dah in ihnen lediglich öie alte vorrömische, bodenständige Bevölkerungs-
schicht zum Älusdruck kvmmt. äknd wo zahlreiche Kelten von links des Rheines
^ Bgl. E. Wahle, Die Besiedelung Südwestdeutschlands in vorrömischer
Zeit nach ihren natürlichen Grundlagen. XII. Bericht der Römisch-germ.
Kommission, 1920, mit 6 Fundkarten, dazu als Beiheft: Fundkatalog, 1921.
s E. Wagner, Fundstätten und Funde II, 1911, S. 52 ff.; Karl Gutmann,
Zur Borgeschichke des Gebietes zwischen Rastatt und Stollhosen. Die Or^
tenau, Mitteilungen des Historischen Bereins für Mittelbaden 12, 1925
S. 123—140.
^ Wagner a. a.O. S. 57.
5 Germania II, 1918, S. 77—84, E. Krüger.
6 Wagner a. a. O. S. 20.
? Wagner a. a. O. S. 304; Beispiele aus Württemberg: Haug-Sixt, Die
römischen Jnschriften und Bildwerke Württembergs, 2. Aufl. 1914 Är. 127
und 359 (mit weiteren Bachweisen).
142