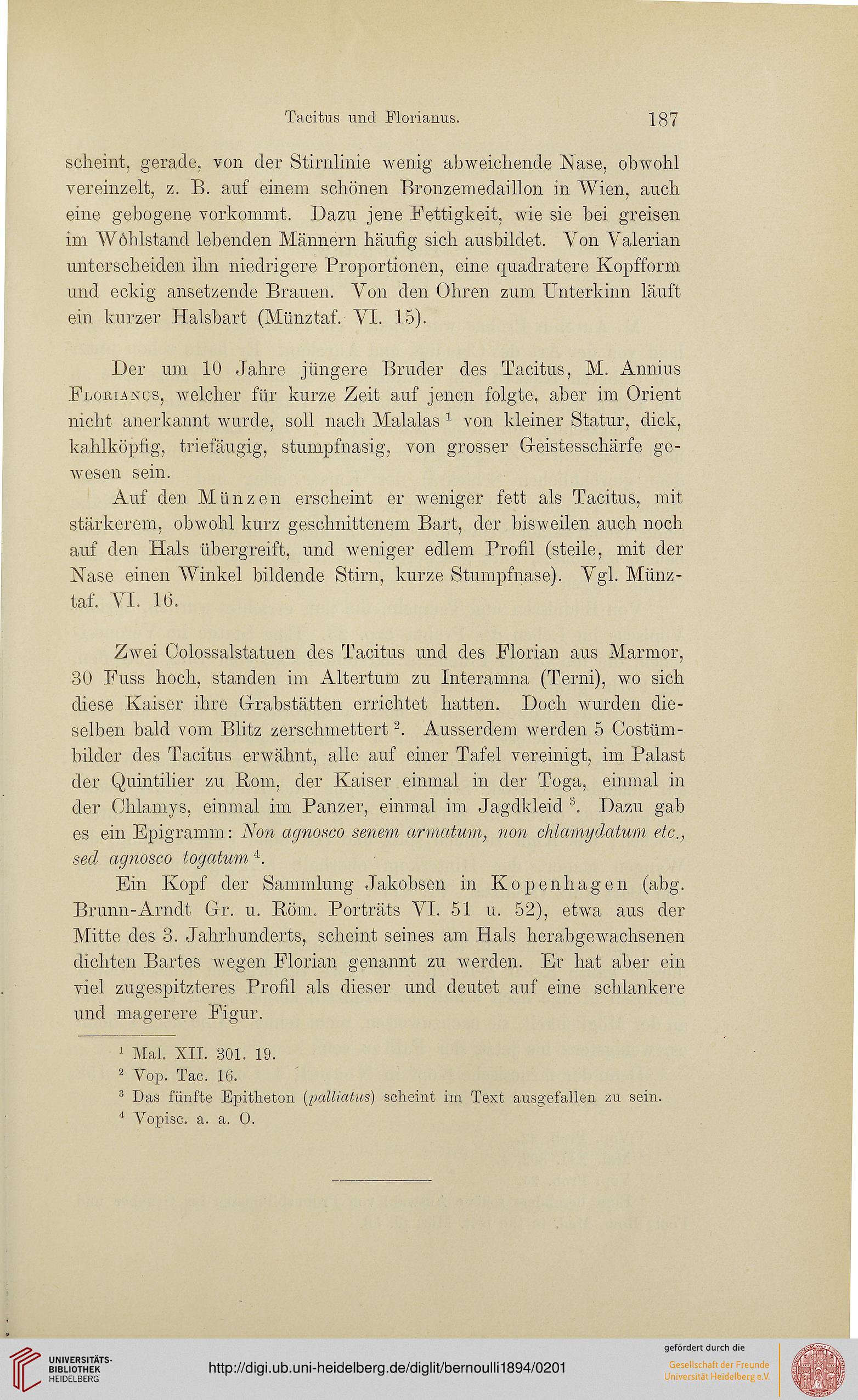Tacitus und Florianus.
187
scheint, gerade, von der Stirnlinie wenig abweichende Nase, obwohl
vereinzelt, z. B. auf einem schönen Bronzemedaillon in Wien, auch
eine gebogene vorkommt. Dazu jene Fettigkeit, wie sie bei greisen
im Wohlstand lebenden Männern häufig sich ausbildet. Von Valerian
unterscheiden ihn niedrigere Proportionen, eine quadratere Kopfform
und eckig ansetzende Brauen. Von den Ohren zum Unterkinn läuft
ein kurzer Halsbart (Münztaf. VI. 15).
Der um 10 Jahre jüngere Bruder des Tacitus, M. Annius
Florianus, welcher für kurze Zeit auf jenen folgte, aber im Orient
nicht anerkannt wurde, soll nach Malalas 1 von kleiner Statur, dick,
kahlköpfig, triefäugig, stumpfnasig, von grosser Geistesschärfe ge-
wesen sein.
Auf den Münzen erscheint er weniger fett als Tacitus, mit
stärkerem, obwohl kurz geschnittenem Bart, der bisweilen auch noch
auf den Hals übergreift, und weniger edlem Profil (steile, mit der
Nase einen Winkel bildende Stirn, kurze Stumpfnase). Vgl. Münz-
taf. VI. 16.
Zwei Colossalstatuen des Tacitus und des Florian aus Marmor,
30 Fuss hoch, standen im Altertum zu Interamna (Terni), wo sich
diese Kaiser ihre Grabstätten errichtet hatten. Doch wurden die-
selben bald vom Blitz zerschmettert2. Ausserdem werden 5 Costüm-
bilder des Tacitus erwähnt, alle auf einer Tafel vereinigt, im Palast
der Quintilier zu Born, der Kaiser einmal in der Toga, einmal in
der Chlamys, einmal im Panzer, einmal im Jagdkleid 3. Dazu gab
es ein Epigramm: Non agnosco senem armatum, non chlamydatum etc.,
secl agnosco togatum 4.
Ein Kopf der Sammlung Jakobsen in Kopenhagen (abg.
Brunn-Arndt Gr. u. Rom. Porträts VI. 51 u. 52), etwa aus der
Mitte des 3. Jahrhunderts, scheint seines am Hals herabgewachsenen
dichten Bartes wegen Florian genannt zu werden. Er hat aber ein
viel zugespitzteres Profil als dieser und deutet auf eine schlankere
und magerere Figur.
1 Mal. XII. 301. 19.
2 Vop. Tac. 16.
3 Das fünfte Epitheton (palliatus) scheint im Text ausgefallen zu sein.
4 Vopisc. a. a. 0.
187
scheint, gerade, von der Stirnlinie wenig abweichende Nase, obwohl
vereinzelt, z. B. auf einem schönen Bronzemedaillon in Wien, auch
eine gebogene vorkommt. Dazu jene Fettigkeit, wie sie bei greisen
im Wohlstand lebenden Männern häufig sich ausbildet. Von Valerian
unterscheiden ihn niedrigere Proportionen, eine quadratere Kopfform
und eckig ansetzende Brauen. Von den Ohren zum Unterkinn läuft
ein kurzer Halsbart (Münztaf. VI. 15).
Der um 10 Jahre jüngere Bruder des Tacitus, M. Annius
Florianus, welcher für kurze Zeit auf jenen folgte, aber im Orient
nicht anerkannt wurde, soll nach Malalas 1 von kleiner Statur, dick,
kahlköpfig, triefäugig, stumpfnasig, von grosser Geistesschärfe ge-
wesen sein.
Auf den Münzen erscheint er weniger fett als Tacitus, mit
stärkerem, obwohl kurz geschnittenem Bart, der bisweilen auch noch
auf den Hals übergreift, und weniger edlem Profil (steile, mit der
Nase einen Winkel bildende Stirn, kurze Stumpfnase). Vgl. Münz-
taf. VI. 16.
Zwei Colossalstatuen des Tacitus und des Florian aus Marmor,
30 Fuss hoch, standen im Altertum zu Interamna (Terni), wo sich
diese Kaiser ihre Grabstätten errichtet hatten. Doch wurden die-
selben bald vom Blitz zerschmettert2. Ausserdem werden 5 Costüm-
bilder des Tacitus erwähnt, alle auf einer Tafel vereinigt, im Palast
der Quintilier zu Born, der Kaiser einmal in der Toga, einmal in
der Chlamys, einmal im Panzer, einmal im Jagdkleid 3. Dazu gab
es ein Epigramm: Non agnosco senem armatum, non chlamydatum etc.,
secl agnosco togatum 4.
Ein Kopf der Sammlung Jakobsen in Kopenhagen (abg.
Brunn-Arndt Gr. u. Rom. Porträts VI. 51 u. 52), etwa aus der
Mitte des 3. Jahrhunderts, scheint seines am Hals herabgewachsenen
dichten Bartes wegen Florian genannt zu werden. Er hat aber ein
viel zugespitzteres Profil als dieser und deutet auf eine schlankere
und magerere Figur.
1 Mal. XII. 301. 19.
2 Vop. Tac. 16.
3 Das fünfte Epitheton (palliatus) scheint im Text ausgefallen zu sein.
4 Vopisc. a. a. 0.