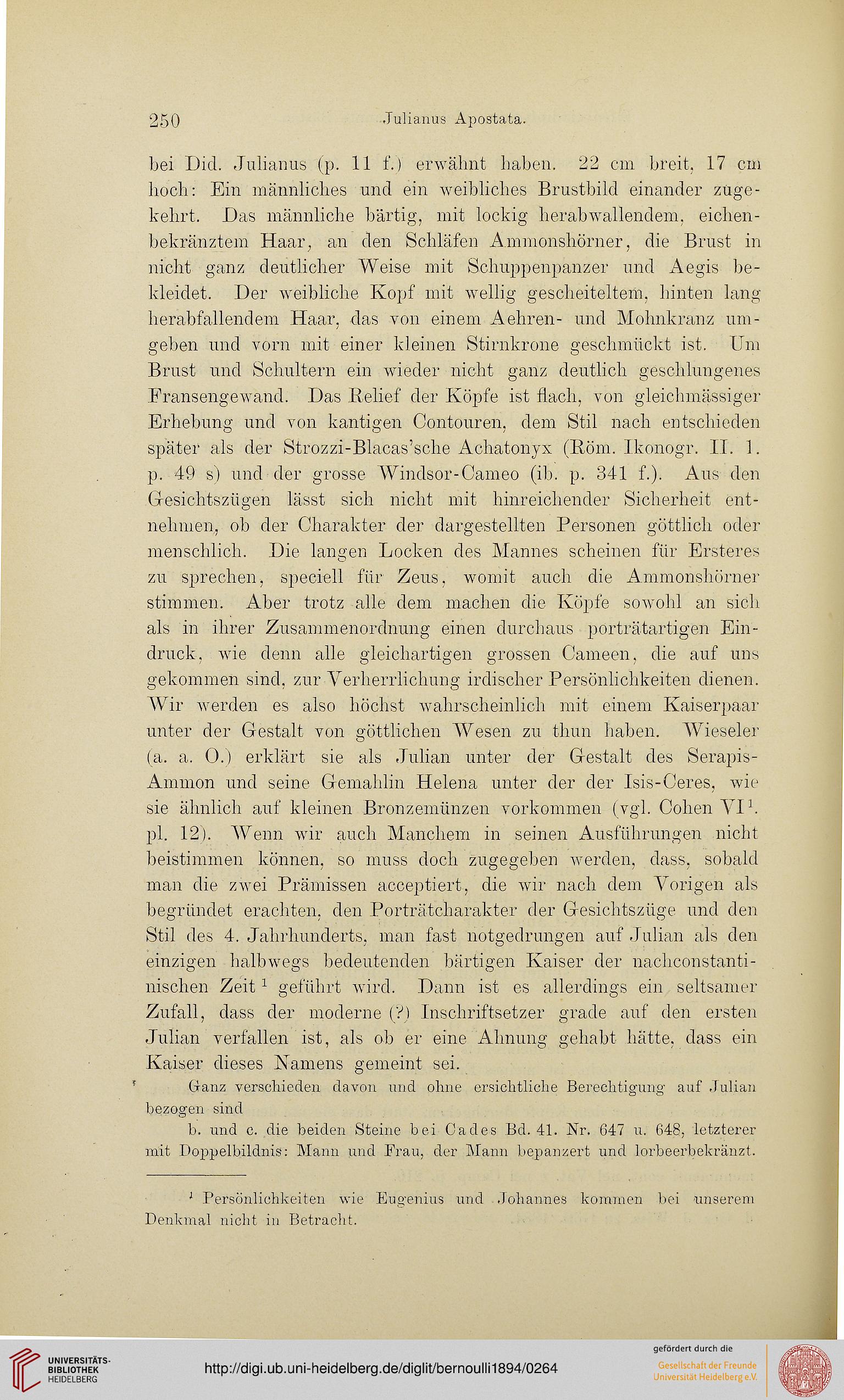250
Julianus Apostata.
bei Did. Julianus (p. 11 f.) erwähnt haben. 22 cm breit. 17 cm
hoch: Ein männliches und ein weibliches Brustbild einander züge-
kehrt. Das männliche bärtig, mit lockig herab wallendem, eichen-
bekränztem Haar, an den Schläfen Ammonshörner, die Brust in
nicht ganz deutlicher Weise mit Schuppenpanzer und Aegis be-
kleidet. Der weibliche Kopf mit wellig gescheiteltem, hinten lang
herabfallendem Haar, das von einem Aehren- und Mohnkranz um-
geben und vorn mit einer kleinen Stirnkrone geschmückt ist. Um
Brust und Schultern ein wieder nicht ganz deutlich geschlungenes
Eransengewand. Das Belief der Köpfe ist flach, von gleichmässiger
Erhebung und von kantigen Contouren, dem Stil nach entschieden
später als der Strozzi-Blacas’sche Achatonyx (Böm. Ikonogr. II. 1.
p. 49 s) und der grosse Windsor-Cameo (ib. p. 341 f.). Aus den
Gesichtszügen lässt sich nicht mit hinreichender Sicherheit ent-
nehmen, ob der Charakter de]’ dargestellten Personen göttlich oder
menschlich. Die langen Locken des Mannes scheinen für Ersteres
zu sprechen, speciell für Zeus, womit auch die Ammonshörner
stimmen. Aber trotz alle dem machen die Köpfe sowohl an sich
als in ihrer Zusammenordnung einen durchaus porträtartigen Ein-
druck, wie denn alle gleichartigen grossen Cameen, die auf uns
gekommen sind, zur Verherrlichung irdischer Persönlichkeiten dienen.
Wir werden es also höchst wahrscheinlich mit einem Kaiserpaar
unter der Gestalt von göttlichen Wesen zu thun haben. Wieseler
(a. a. 0.) erklärt sie als Julian unter der Gestalt des Serapis-
Aminon und seine Gemahlin Helena unter der der Isis-Ceres, wie
sie ähnlich auf kleinen Bronzemünzen Vorkommen (vgl. Cohen VI b
pl. 12). Wenn wir auch Manchem in seinen Ausführungen nicht
beistimmen können, so muss doch zugegeben werden, dass, sobald
man die zwei Prämissen acceptiert, die wir nach dem Vorigen als
begründet erachten, den Porträtcharakter der Gesichtszüge und den
Stil des 4. Jahrhunderts, man fast notgedrungen auf Julian als den
einzigen halbwegs bedeutenden bärtigen Kaiser der nachconstanti-
nischen Zeit1 geführt wird. Dann ist es allerdings ein seltsamer
Zufall, dass der moderne (?) Inschriftsetzer grade auf den ersten
Julian verfallen ist, als ob er eine Ahnung gehabt hätte, dass ein
Kaiser dieses Hamens gemeint sei.
Ganz verschieden davon und ohne ersichtliche Berechtigung auf Julian
bezogen sind
b. und c. die beiden Steine bei Cades Bd. 41. Nr. 647 u. 648, letzterer
mit E>oppelbildnis: Mann und Frau, der Mann bepanzert und lorbeerbekränzt.
1 Persönlichkeiten wie Eugenius und Johannes kommen bei unserem
Denkmal nicht in Betracht.
Julianus Apostata.
bei Did. Julianus (p. 11 f.) erwähnt haben. 22 cm breit. 17 cm
hoch: Ein männliches und ein weibliches Brustbild einander züge-
kehrt. Das männliche bärtig, mit lockig herab wallendem, eichen-
bekränztem Haar, an den Schläfen Ammonshörner, die Brust in
nicht ganz deutlicher Weise mit Schuppenpanzer und Aegis be-
kleidet. Der weibliche Kopf mit wellig gescheiteltem, hinten lang
herabfallendem Haar, das von einem Aehren- und Mohnkranz um-
geben und vorn mit einer kleinen Stirnkrone geschmückt ist. Um
Brust und Schultern ein wieder nicht ganz deutlich geschlungenes
Eransengewand. Das Belief der Köpfe ist flach, von gleichmässiger
Erhebung und von kantigen Contouren, dem Stil nach entschieden
später als der Strozzi-Blacas’sche Achatonyx (Böm. Ikonogr. II. 1.
p. 49 s) und der grosse Windsor-Cameo (ib. p. 341 f.). Aus den
Gesichtszügen lässt sich nicht mit hinreichender Sicherheit ent-
nehmen, ob der Charakter de]’ dargestellten Personen göttlich oder
menschlich. Die langen Locken des Mannes scheinen für Ersteres
zu sprechen, speciell für Zeus, womit auch die Ammonshörner
stimmen. Aber trotz alle dem machen die Köpfe sowohl an sich
als in ihrer Zusammenordnung einen durchaus porträtartigen Ein-
druck, wie denn alle gleichartigen grossen Cameen, die auf uns
gekommen sind, zur Verherrlichung irdischer Persönlichkeiten dienen.
Wir werden es also höchst wahrscheinlich mit einem Kaiserpaar
unter der Gestalt von göttlichen Wesen zu thun haben. Wieseler
(a. a. 0.) erklärt sie als Julian unter der Gestalt des Serapis-
Aminon und seine Gemahlin Helena unter der der Isis-Ceres, wie
sie ähnlich auf kleinen Bronzemünzen Vorkommen (vgl. Cohen VI b
pl. 12). Wenn wir auch Manchem in seinen Ausführungen nicht
beistimmen können, so muss doch zugegeben werden, dass, sobald
man die zwei Prämissen acceptiert, die wir nach dem Vorigen als
begründet erachten, den Porträtcharakter der Gesichtszüge und den
Stil des 4. Jahrhunderts, man fast notgedrungen auf Julian als den
einzigen halbwegs bedeutenden bärtigen Kaiser der nachconstanti-
nischen Zeit1 geführt wird. Dann ist es allerdings ein seltsamer
Zufall, dass der moderne (?) Inschriftsetzer grade auf den ersten
Julian verfallen ist, als ob er eine Ahnung gehabt hätte, dass ein
Kaiser dieses Hamens gemeint sei.
Ganz verschieden davon und ohne ersichtliche Berechtigung auf Julian
bezogen sind
b. und c. die beiden Steine bei Cades Bd. 41. Nr. 647 u. 648, letzterer
mit E>oppelbildnis: Mann und Frau, der Mann bepanzert und lorbeerbekränzt.
1 Persönlichkeiten wie Eugenius und Johannes kommen bei unserem
Denkmal nicht in Betracht.