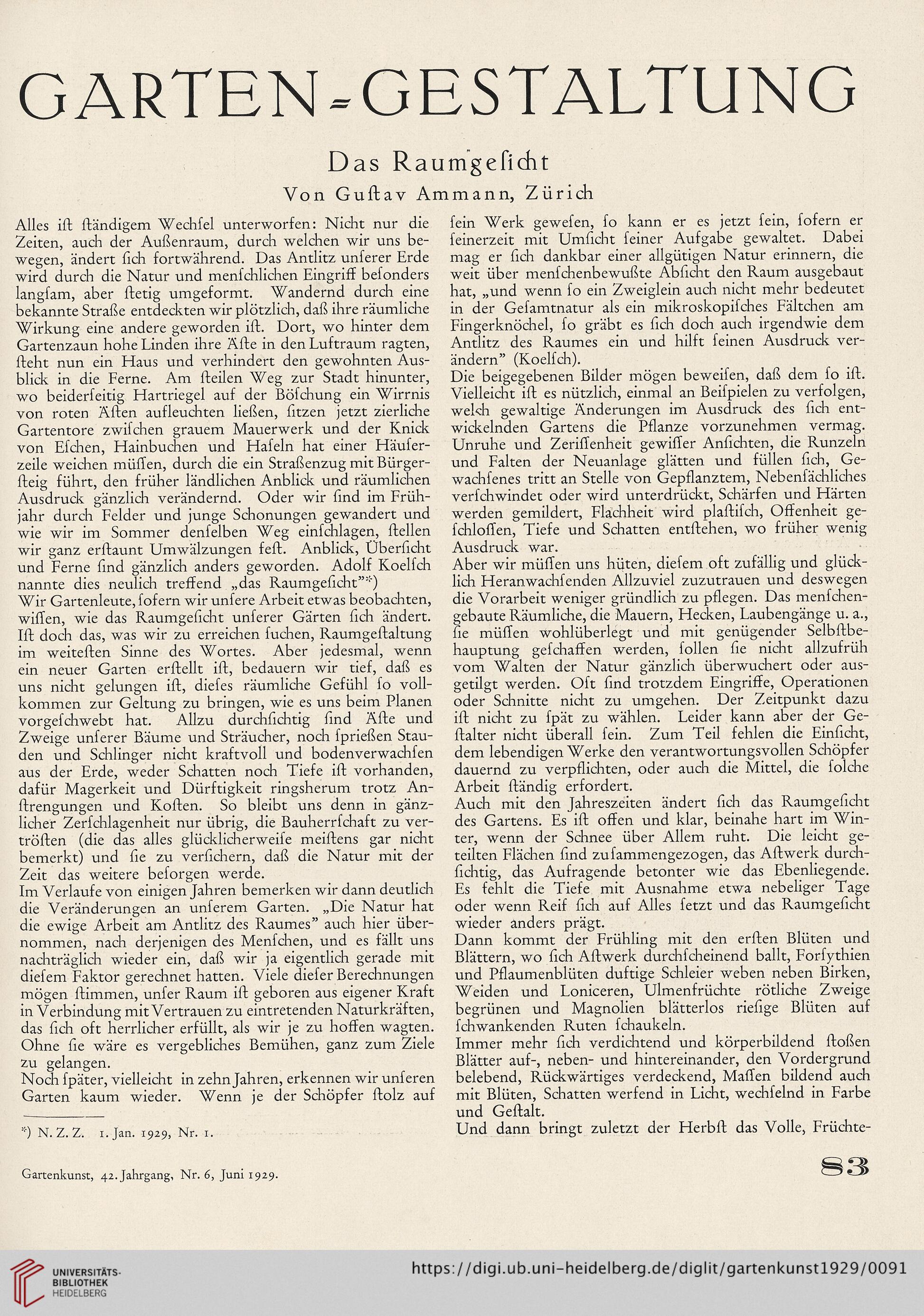GARTEN-GESTALTUNG
Das Raumgesicht
Von Gustav Ammann, Zürich
Alles ist ständigem Wechsel unterworfen: Nicht nur die
Zeiten, auch der Außenraum, durch welchen wir uns be-
wegen, ändert sich fortwährend. Das Antlitz unserer Erde
wird durch die Natur und menschlichen Eingriff besonders
langsam, aber stetig umgeformt. Wandernd durch eine
bekannte Straße entdeckten wir plötzlich, daß ihre räumliche
Wirkung eine andere geworden ist. Dort, wo hinter dem
Gartenzaun hohe Linden ihre Äste in den Luftraum ragten,
steht nun ein Haus und verhindert den gewohnten Aus-
blick in die Ferne. Am steilen Weg zur Stadt hinunter,
wo beiderseitig Hartriegel auf der Böschung ein Wirrnis
von roten Ästen aufleuchten ließen, sitzen jetzt zierliche
Gartentore zwischen grauem Mauerwerk und der Knick
von Eschen, Hainbuchen und Haseln hat einer Häuser-
zeile weichen müssen, durch die ein Straßenzug mit Bürger-
steig führt, den früher ländlichen Anblick und räumlichen
Ausdruck gänzlich verändernd. Oder wir sind im Früh-
jahr durch Felder und junge Schonungen gewandert und
wie wir im Sommer denselben Weg einschlagen, steilen
wir ganz erstaunt Umwälzungen fest. Anblick, Übersicht
und Ferne sind gänzlich anders geworden. Adolf Koelsch
nannte dies neulich treffend „das Raumgesicht”*)
Wir Gartenleute, sofern wir unsere Arbeit etwas beobachten,
willen, wie das Raumgesicht unserer Gärten sich ändert.
Ist doch das, was wir zu erreichen suchen, Raumgestaltung
im weitesten Sinne des Wortes. Aber jedesmal, wenn
ein neuer Garten erstellt ist, bedauern wir tief, daß es
uns nicht gelungen ist, dieses räumliche Gefühl so voll-
kommen zur Geltung zu bringen, wie es uns beim Planen
vorgeschwebt hat. Allzu durchsichtig sind Äste und
Zweige unserer Bäume und Sträucher, noch sprießen Stau-
den und Schlinger nicht kraftvoll und bodenverwachsen
aus der Erde, weder Schatten noch Tiefe ist vorhanden,
dafür Magerkeit und Dürftigkeit ringsherum trotz An-
strengungen und Kosten. So bleibt uns denn in gänz-
licher Zerschlagenheit nur übrig, die Bauherrschaft zu ver-
trösten (die das alles glücklicherweise meistens gar nicht
bemerkt) und sie zu versichern, daß die Natur mit der
Zeit das weitere besorgen werde.
Im Verlaufe von einigen Jahren bemerken wir dann deutlich
die Veränderungen an unserem Garten. „Die Natur hat
die ewige Arbeit am Antlitz des Raumes” auch hier über-
nommen, nach derjenigen des Menschen, und es fällt uns
nachträglich wieder ein, daß wir ja eigentlich gerade mit
diesem Faktor gerechnet hatten. Viele dieser Berechnungen
mögen stimmen, unser Raum ist geboren aus eigener Kraft
in Verbindung mit Vertrauen zu eintretenden Naturkräften,
das sich oft herrlicher erfüllt, als wir je zu hoffen wagten.
Ohne sie wäre es vergebliches Bemühen, ganz zum Ziele
zu gelangen.
Noch später, vielleicht in zehn Jahren, erkennen wir unseren
Garten kaum wieder. Wenn je der Schöpfer stolz auf
*) N. Z. Z. i.Jan. 1929, Nr. 1.
sein Werk gewesen, so kann er es jetzt sein, sofern er
seinerzeit mit Umsicht seiner Aufgabe gewaltet. Dabei
mag er sich dankbar einer allgütigen Natur erinnern, die
weit über menschenbewußte Absicht den Raum ausgebaut
hat, „und wenn so ein Zweiglein auch nicht mehr bedeutet
in der Gesamtnatur als ein mikroskopisches Fältchen am
Fingerknöchel, so gräbt es sich doch auch irgendwie dem
Antlitz des Raumes ein und hilft seinen Ausdruck ver-
ändern” (Koelsch).
Die beigegebenen Bilder mögen beweisen, daß dem so ist.
Vielleicht ist es nützlich, einmal an Beispielen zu verfolgen,
wekh gewaltige Änderungen im Ausdruck des sich ent-
wickelnden Gartens die Pflanze vorzunehmen vermag.
Unruhe und Zerissenheit gewisser Ansichten, die Runzeln
und Falten der Neuanlage glätten und füllen sich, Ge-
wachsenes tritt an Stelle von Gepflanztem, Nebensächliches
verschwindet oder wird unterdrückt, Schärfen und Härten
werden gemildert, Flachheit wird plastisch, Offenheit ge-
schlossen, Tiefe und Schatten entliehen, wo früher wenig
Ausdruck war.
Aber wir müssen uns hüten, diesem oft zufällig und glück-
lich Heranwachsenden Allzuviel zuzutrauen und deswegen
die Vorarbeit weniger gründlich zu pflegen. Das menschen-
gebaute Räumliche, die Mauern, Hecken, Laubengänge u. a.,
sie müssen wohlüberlegt und mit genügender Selbstbe-
hauptung geschaffen werden, sollen sie nicht allzufrüh
vom Walten der Natur gänzlich überwuchert oder aus-
getilgt werden. Ost sind trotzdem Eingriffe, Operationen
oder Schnitte nicht zu umgehen. Der Zeitpunkt dazu
ist nicht zu spät zu wählen. Leider kann aber der Ge-
stalter nicht überall sein. Zum Teil fehlen die Einsicht,
dem lebendigen Werke den verantwortungsvollen Schöpfer
dauernd zu verpflichten, oder auch die Mittel, die solche
Arbeit ständig erfordert.
Auch mit den Jahreszeiten ändert sich das Raumgesicht
des Gartens. Es ist offen und klar, beinahe hart im Win-
ter, wenn der Schnee über Allem ruht. Die leicht ge-
teilten Flächen sind zusammengezogen, das Astwerk durch-
sichtig, das Aufragende betonter wie das Ebenliegende.
Es fehlt die Tiefe mit Ausnahme etwa nebeliger Tage
oder wenn Reif sich auf Alles setzt und das Raumgesicht
wieder anders prägt.
Dann kommt der Frühling mit den ersten Blüten und
Blättern, wo sich Astwerk durchscheinend ballt, Forsythien
und Pflaumenblüten duftige Schleier weben neben Birken,
Weiden und Loniceren, Ulmenfrüchte rötliche Zweige
begrünen und Magnolien blätterlos riesige Blüten auf
schwankenden Ruten schaukeln.
Immer mehr sich verdichtend und körperbildend slößen
Blätter auf-, neben- und hintereinander, den Vordergrund
belebend, Rückwärtiges verdeckend, Masien bildend auch
mit Blüten, Schatten werfend in Licht, wechselnd in Farbe
und Gestalt.
Und dann bringt zuletzt der Herbst das Volle, Früchte-
Gartenkunst, 42. Jahrgang, Nr. 6, Juni 1929.
Das Raumgesicht
Von Gustav Ammann, Zürich
Alles ist ständigem Wechsel unterworfen: Nicht nur die
Zeiten, auch der Außenraum, durch welchen wir uns be-
wegen, ändert sich fortwährend. Das Antlitz unserer Erde
wird durch die Natur und menschlichen Eingriff besonders
langsam, aber stetig umgeformt. Wandernd durch eine
bekannte Straße entdeckten wir plötzlich, daß ihre räumliche
Wirkung eine andere geworden ist. Dort, wo hinter dem
Gartenzaun hohe Linden ihre Äste in den Luftraum ragten,
steht nun ein Haus und verhindert den gewohnten Aus-
blick in die Ferne. Am steilen Weg zur Stadt hinunter,
wo beiderseitig Hartriegel auf der Böschung ein Wirrnis
von roten Ästen aufleuchten ließen, sitzen jetzt zierliche
Gartentore zwischen grauem Mauerwerk und der Knick
von Eschen, Hainbuchen und Haseln hat einer Häuser-
zeile weichen müssen, durch die ein Straßenzug mit Bürger-
steig führt, den früher ländlichen Anblick und räumlichen
Ausdruck gänzlich verändernd. Oder wir sind im Früh-
jahr durch Felder und junge Schonungen gewandert und
wie wir im Sommer denselben Weg einschlagen, steilen
wir ganz erstaunt Umwälzungen fest. Anblick, Übersicht
und Ferne sind gänzlich anders geworden. Adolf Koelsch
nannte dies neulich treffend „das Raumgesicht”*)
Wir Gartenleute, sofern wir unsere Arbeit etwas beobachten,
willen, wie das Raumgesicht unserer Gärten sich ändert.
Ist doch das, was wir zu erreichen suchen, Raumgestaltung
im weitesten Sinne des Wortes. Aber jedesmal, wenn
ein neuer Garten erstellt ist, bedauern wir tief, daß es
uns nicht gelungen ist, dieses räumliche Gefühl so voll-
kommen zur Geltung zu bringen, wie es uns beim Planen
vorgeschwebt hat. Allzu durchsichtig sind Äste und
Zweige unserer Bäume und Sträucher, noch sprießen Stau-
den und Schlinger nicht kraftvoll und bodenverwachsen
aus der Erde, weder Schatten noch Tiefe ist vorhanden,
dafür Magerkeit und Dürftigkeit ringsherum trotz An-
strengungen und Kosten. So bleibt uns denn in gänz-
licher Zerschlagenheit nur übrig, die Bauherrschaft zu ver-
trösten (die das alles glücklicherweise meistens gar nicht
bemerkt) und sie zu versichern, daß die Natur mit der
Zeit das weitere besorgen werde.
Im Verlaufe von einigen Jahren bemerken wir dann deutlich
die Veränderungen an unserem Garten. „Die Natur hat
die ewige Arbeit am Antlitz des Raumes” auch hier über-
nommen, nach derjenigen des Menschen, und es fällt uns
nachträglich wieder ein, daß wir ja eigentlich gerade mit
diesem Faktor gerechnet hatten. Viele dieser Berechnungen
mögen stimmen, unser Raum ist geboren aus eigener Kraft
in Verbindung mit Vertrauen zu eintretenden Naturkräften,
das sich oft herrlicher erfüllt, als wir je zu hoffen wagten.
Ohne sie wäre es vergebliches Bemühen, ganz zum Ziele
zu gelangen.
Noch später, vielleicht in zehn Jahren, erkennen wir unseren
Garten kaum wieder. Wenn je der Schöpfer stolz auf
*) N. Z. Z. i.Jan. 1929, Nr. 1.
sein Werk gewesen, so kann er es jetzt sein, sofern er
seinerzeit mit Umsicht seiner Aufgabe gewaltet. Dabei
mag er sich dankbar einer allgütigen Natur erinnern, die
weit über menschenbewußte Absicht den Raum ausgebaut
hat, „und wenn so ein Zweiglein auch nicht mehr bedeutet
in der Gesamtnatur als ein mikroskopisches Fältchen am
Fingerknöchel, so gräbt es sich doch auch irgendwie dem
Antlitz des Raumes ein und hilft seinen Ausdruck ver-
ändern” (Koelsch).
Die beigegebenen Bilder mögen beweisen, daß dem so ist.
Vielleicht ist es nützlich, einmal an Beispielen zu verfolgen,
wekh gewaltige Änderungen im Ausdruck des sich ent-
wickelnden Gartens die Pflanze vorzunehmen vermag.
Unruhe und Zerissenheit gewisser Ansichten, die Runzeln
und Falten der Neuanlage glätten und füllen sich, Ge-
wachsenes tritt an Stelle von Gepflanztem, Nebensächliches
verschwindet oder wird unterdrückt, Schärfen und Härten
werden gemildert, Flachheit wird plastisch, Offenheit ge-
schlossen, Tiefe und Schatten entliehen, wo früher wenig
Ausdruck war.
Aber wir müssen uns hüten, diesem oft zufällig und glück-
lich Heranwachsenden Allzuviel zuzutrauen und deswegen
die Vorarbeit weniger gründlich zu pflegen. Das menschen-
gebaute Räumliche, die Mauern, Hecken, Laubengänge u. a.,
sie müssen wohlüberlegt und mit genügender Selbstbe-
hauptung geschaffen werden, sollen sie nicht allzufrüh
vom Walten der Natur gänzlich überwuchert oder aus-
getilgt werden. Ost sind trotzdem Eingriffe, Operationen
oder Schnitte nicht zu umgehen. Der Zeitpunkt dazu
ist nicht zu spät zu wählen. Leider kann aber der Ge-
stalter nicht überall sein. Zum Teil fehlen die Einsicht,
dem lebendigen Werke den verantwortungsvollen Schöpfer
dauernd zu verpflichten, oder auch die Mittel, die solche
Arbeit ständig erfordert.
Auch mit den Jahreszeiten ändert sich das Raumgesicht
des Gartens. Es ist offen und klar, beinahe hart im Win-
ter, wenn der Schnee über Allem ruht. Die leicht ge-
teilten Flächen sind zusammengezogen, das Astwerk durch-
sichtig, das Aufragende betonter wie das Ebenliegende.
Es fehlt die Tiefe mit Ausnahme etwa nebeliger Tage
oder wenn Reif sich auf Alles setzt und das Raumgesicht
wieder anders prägt.
Dann kommt der Frühling mit den ersten Blüten und
Blättern, wo sich Astwerk durchscheinend ballt, Forsythien
und Pflaumenblüten duftige Schleier weben neben Birken,
Weiden und Loniceren, Ulmenfrüchte rötliche Zweige
begrünen und Magnolien blätterlos riesige Blüten auf
schwankenden Ruten schaukeln.
Immer mehr sich verdichtend und körperbildend slößen
Blätter auf-, neben- und hintereinander, den Vordergrund
belebend, Rückwärtiges verdeckend, Masien bildend auch
mit Blüten, Schatten werfend in Licht, wechselnd in Farbe
und Gestalt.
Und dann bringt zuletzt der Herbst das Volle, Früchte-
Gartenkunst, 42. Jahrgang, Nr. 6, Juni 1929.