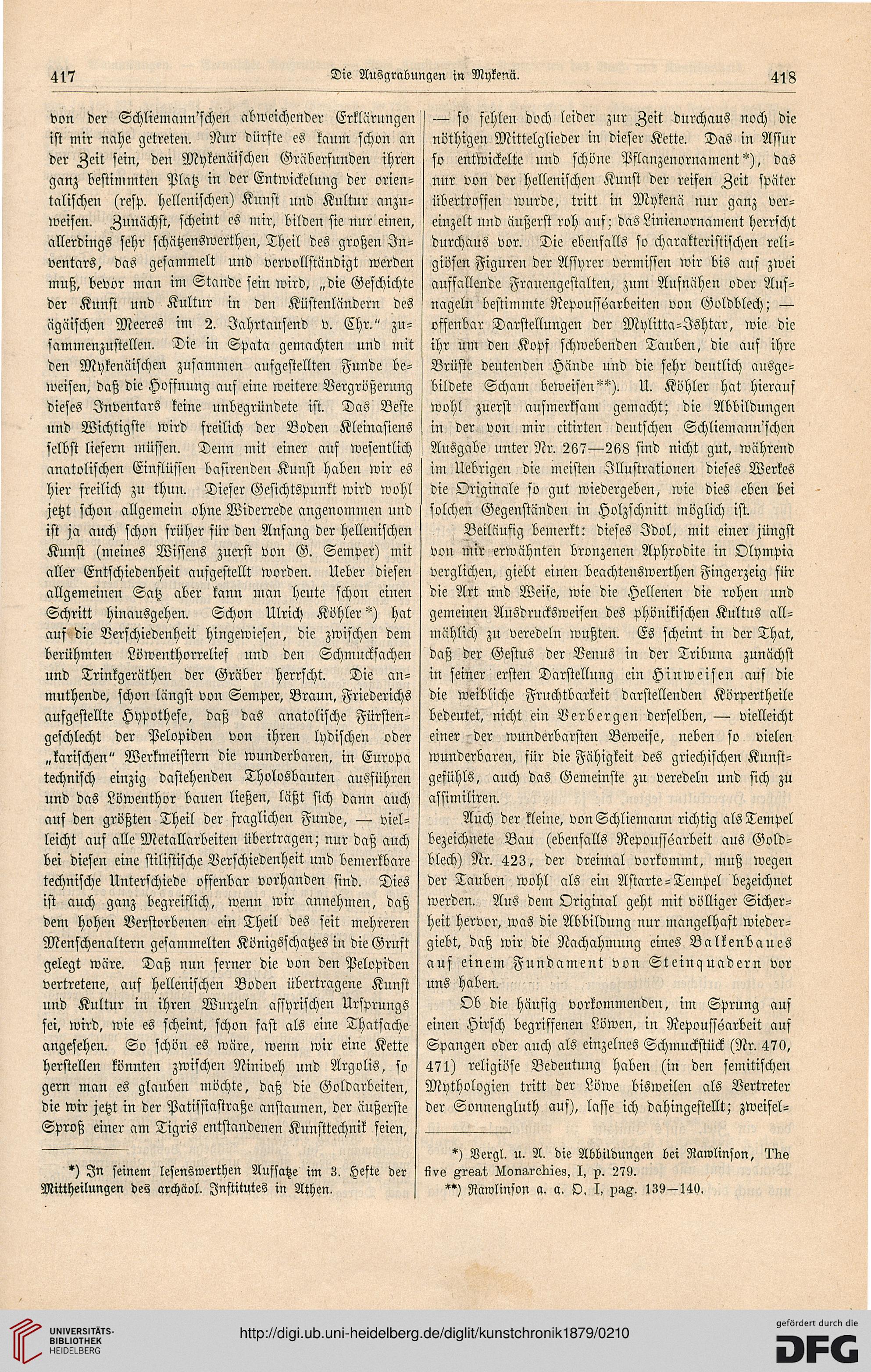417
Die AuSgrabungen in Mykenä.
418
bon der Schliemaim'schen abwcichender Erklärungen
ist niir nahe getreten. Nur dürfte es kaum schon an
dcr Zeit sein, den Mykenäischen Gräberfunden ihren
ganz bestimmten Platz in der Entwickelung der orien-
talischen (resp. hcllenischen) Kunst nnd Kultur anzu-
weiseiu Zunächst, scheint es mir, bilden sie nur einen,
allerdings sehr schätzenswerthen, Theil des großen Jn-
ventars, das gesammelt nnd vervollständigt werden
muß, bevor man im Stande sein wird, „die Geschichte
der Kunst und Kultur iu den Küstenländern des
ägäischen Meeres im 2. Jahrtausend v. Chr/' zu-
sammenzustellen. Die in Spata gemnchten und mit
den Mpkenäischen zusammen aufgestellten Funde be-
weisen, daß die Hoffnung auf eine weitere Vergrößerung
dieses Jnventars keine unbegrüudete ist. Das Beste
und Wichtigste wird freilich der Boden Kleinasiens
selbst liefern müssen. Denn mit einer auf wesentlich
anatolischen Einflüssen basirenden Kunst haben wir es
hier freilich zu thun. Dieser Gesichtspunkt wird wohl
jetzt schon allgemein ohne Widerrede angenommen und
ist ja auch schon früher für den Anfang der hellenischen
Kunst (meines Wissens zuerst von G. Semper) mit
aller Entschiedenheit aufgestellt worden. Ueber diesen
allgemeinen Satz aber kann man heute schon einen
Schritt hinausgehen. Schon Ulrich Köhler*) hat
auf die Verschiedenheit hingewiesen, die zwischen dem
berühmten Löwenthorrelief und den Schmucksachen
und Trinkgeräthen der Gräber herrscht. Die an-
mnthende, schon längst von Semper, Braun, Friederichs
aufgestellte Hypothese, daß das anatolische Fürsten-
geschlecht der Pelopiden von ihren lydischen oder
„karischen" Werkmeistern die wunderbaren, in Europa
technisch einzig dastehenden Tholosbauten auSführen
und das Löwenthor bauen ließen, läßt sich dann auch
auf den größten Theil der fraglichen Funde, — viel-
leicht auf alle Metallarbeiten übertragen; nur daß auch
bei diesen eine stilistische Verschiedenheit und bemerkbare
technische Unterschiede offenbar vorhanden sind. Dies
ist auch ganz begreislich, wenn wir annehmen, daß
dem hohen Verstorbenen ein Theil des seit mehreren
Menschenaltern gesammelten Königsschatzes in die Gruft
gelegt wäre. Daß nun ferner die von den Pelopiden
vertretene, auf Hellenischen Boden übertragene Kunst
und Kultur in ihren Wurzeln assyrischen Ursprungs
sei, wird, wie es scheint, schon fast als eine Thatsache
angesehen. So schön es wäre, wenn wir eine Kette
herstellen könnten zwischen Niniveh und Argolis, so
gern man es glaubeu möchte, daß die Goldarbeiten,
die wir jetzt in der Patissiastraße anstaunen, der äußerste
Sproß einer ani Tigris entstandenen Kunsttechnik seien,
*) Jn seinem lesensiverthen Aufsatze im 3. Hefts der
Mittheilungen des archäol. Institutes in Athen.
— so fehlen doch leider zur Zeit durchaus noch die
nöthigen Mittelglieder in dieser Kette. Das in Assur
so entwickelte und schöne Pflanzeuornament*), das
nur von der hellenischen Kunst der reifen Zeit später
übertroffen wurde, tritt in Mykenä nur ganz ver-
einzelt und äußerst roh aus; das Linienornamcut herrscht
durchaus vor. Die ebenfalls so charakteristischen reli-
giösen Figuren der Assyrer vermissen wir bis auf zwei
auffallende Frauengestalteu, zum Aufuähen oder Auf-
nageln bestimmte Repousssarbeiten von Goldblech; —
offenbar Darstellungen der Mylitta-Jshtar, wie dic
ihr um den Kopf schwebenden Tauben, dic auf ihre
Brüste deutenden Hände nnd die sehr deutlich ausgc-
bildete Scham beweisen**). II. Köhler hnt hierauf
wohl zuerst aufmerksam gemacht; die Abbildungen
in der von mir eitirten deutschen Schliemann'schen
Ausgabe unter Nr. 267—268 sind nicht gut, während
im Uebrigen die mcisten Jllustrationen dieses Werkes
die Originale so gut wiedergeben, wie dies eben bei
solchen Gegenständen in Holzschnitt möglich ist.
Beiläusig bemerkt: dieses Jdol, mit einer jüngst
von mir erwähnten bronzenen Aphrodite in Olympia
verglichen, giebt einen beachtenswerthen Fingerzeig für
die Art und Weise, wie die Hellenen die rohen und
gemeinen Ausdrucksweisen des phönikischen Kultus all-
mählich zu veredeln wußten. Es scheint in der That,
daß der Gestus der Venus in der Tribuna zunächst
in seiner ersten Darstellung ein Hinweiseu auf die
die weibliche Fruchtbarkeit darstellenden Körpertheile
bedeutet, nicht ein Verbergen derselben, — vielleicht
einer der wunderbarsten Beweise, neben so vielen
wunderbaren, für die Fähigkeit des griechischen Kunst-
gefühls, auch das Gemeinste zu veredeln und sich zu
assimiliren.
Auch der kleine, vonSchliemann richtig als Tempel
bezeichnete Bau (ebenfalls Repousssarbeit aus Gold-
blech) Nr. 423, der dreimal vorkommt, muß wegen
der Tauben wohl als ein Astarte - Tempel bezeichnet
werden. Aus dem Original geht mit völliger Sicher-
heit hervor, was die Abbildung nur mangelhaft wieder-
giebt, daß wir die Nachahmung eines Balkenbaues
auf einem Fundament von Steinguadern vor
uns haben.
Ob die häufig vorkommenden, im Sprung auf
einen Hirsch begriffenen Löwen, in Repousssarbeit auf
Spangen oder auch alS einzelnes Schmuckstück (Nr. 470,
471) religiöse Bedeutung haben (in den semitischen
Mythologien tritt der Löwe bisweilen als Vertreter
der Sonnengluth auf), lasie ich dahingestellt; zweifel-
*) Vergl. u. A. die Abbildungen bei Rawlinson, l'lig
üvs Arsat Uonaroliiss, I, p. 279.
**) Rawlinson g. g. O. I, xa-ss. 139—149.
Die AuSgrabungen in Mykenä.
418
bon der Schliemaim'schen abwcichender Erklärungen
ist niir nahe getreten. Nur dürfte es kaum schon an
dcr Zeit sein, den Mykenäischen Gräberfunden ihren
ganz bestimmten Platz in der Entwickelung der orien-
talischen (resp. hcllenischen) Kunst nnd Kultur anzu-
weiseiu Zunächst, scheint es mir, bilden sie nur einen,
allerdings sehr schätzenswerthen, Theil des großen Jn-
ventars, das gesammelt nnd vervollständigt werden
muß, bevor man im Stande sein wird, „die Geschichte
der Kunst und Kultur iu den Küstenländern des
ägäischen Meeres im 2. Jahrtausend v. Chr/' zu-
sammenzustellen. Die in Spata gemnchten und mit
den Mpkenäischen zusammen aufgestellten Funde be-
weisen, daß die Hoffnung auf eine weitere Vergrößerung
dieses Jnventars keine unbegrüudete ist. Das Beste
und Wichtigste wird freilich der Boden Kleinasiens
selbst liefern müssen. Denn mit einer auf wesentlich
anatolischen Einflüssen basirenden Kunst haben wir es
hier freilich zu thun. Dieser Gesichtspunkt wird wohl
jetzt schon allgemein ohne Widerrede angenommen und
ist ja auch schon früher für den Anfang der hellenischen
Kunst (meines Wissens zuerst von G. Semper) mit
aller Entschiedenheit aufgestellt worden. Ueber diesen
allgemeinen Satz aber kann man heute schon einen
Schritt hinausgehen. Schon Ulrich Köhler*) hat
auf die Verschiedenheit hingewiesen, die zwischen dem
berühmten Löwenthorrelief und den Schmucksachen
und Trinkgeräthen der Gräber herrscht. Die an-
mnthende, schon längst von Semper, Braun, Friederichs
aufgestellte Hypothese, daß das anatolische Fürsten-
geschlecht der Pelopiden von ihren lydischen oder
„karischen" Werkmeistern die wunderbaren, in Europa
technisch einzig dastehenden Tholosbauten auSführen
und das Löwenthor bauen ließen, läßt sich dann auch
auf den größten Theil der fraglichen Funde, — viel-
leicht auf alle Metallarbeiten übertragen; nur daß auch
bei diesen eine stilistische Verschiedenheit und bemerkbare
technische Unterschiede offenbar vorhanden sind. Dies
ist auch ganz begreislich, wenn wir annehmen, daß
dem hohen Verstorbenen ein Theil des seit mehreren
Menschenaltern gesammelten Königsschatzes in die Gruft
gelegt wäre. Daß nun ferner die von den Pelopiden
vertretene, auf Hellenischen Boden übertragene Kunst
und Kultur in ihren Wurzeln assyrischen Ursprungs
sei, wird, wie es scheint, schon fast als eine Thatsache
angesehen. So schön es wäre, wenn wir eine Kette
herstellen könnten zwischen Niniveh und Argolis, so
gern man es glaubeu möchte, daß die Goldarbeiten,
die wir jetzt in der Patissiastraße anstaunen, der äußerste
Sproß einer ani Tigris entstandenen Kunsttechnik seien,
*) Jn seinem lesensiverthen Aufsatze im 3. Hefts der
Mittheilungen des archäol. Institutes in Athen.
— so fehlen doch leider zur Zeit durchaus noch die
nöthigen Mittelglieder in dieser Kette. Das in Assur
so entwickelte und schöne Pflanzeuornament*), das
nur von der hellenischen Kunst der reifen Zeit später
übertroffen wurde, tritt in Mykenä nur ganz ver-
einzelt und äußerst roh aus; das Linienornamcut herrscht
durchaus vor. Die ebenfalls so charakteristischen reli-
giösen Figuren der Assyrer vermissen wir bis auf zwei
auffallende Frauengestalteu, zum Aufuähen oder Auf-
nageln bestimmte Repousssarbeiten von Goldblech; —
offenbar Darstellungen der Mylitta-Jshtar, wie dic
ihr um den Kopf schwebenden Tauben, dic auf ihre
Brüste deutenden Hände nnd die sehr deutlich ausgc-
bildete Scham beweisen**). II. Köhler hnt hierauf
wohl zuerst aufmerksam gemacht; die Abbildungen
in der von mir eitirten deutschen Schliemann'schen
Ausgabe unter Nr. 267—268 sind nicht gut, während
im Uebrigen die mcisten Jllustrationen dieses Werkes
die Originale so gut wiedergeben, wie dies eben bei
solchen Gegenständen in Holzschnitt möglich ist.
Beiläusig bemerkt: dieses Jdol, mit einer jüngst
von mir erwähnten bronzenen Aphrodite in Olympia
verglichen, giebt einen beachtenswerthen Fingerzeig für
die Art und Weise, wie die Hellenen die rohen und
gemeinen Ausdrucksweisen des phönikischen Kultus all-
mählich zu veredeln wußten. Es scheint in der That,
daß der Gestus der Venus in der Tribuna zunächst
in seiner ersten Darstellung ein Hinweiseu auf die
die weibliche Fruchtbarkeit darstellenden Körpertheile
bedeutet, nicht ein Verbergen derselben, — vielleicht
einer der wunderbarsten Beweise, neben so vielen
wunderbaren, für die Fähigkeit des griechischen Kunst-
gefühls, auch das Gemeinste zu veredeln und sich zu
assimiliren.
Auch der kleine, vonSchliemann richtig als Tempel
bezeichnete Bau (ebenfalls Repousssarbeit aus Gold-
blech) Nr. 423, der dreimal vorkommt, muß wegen
der Tauben wohl als ein Astarte - Tempel bezeichnet
werden. Aus dem Original geht mit völliger Sicher-
heit hervor, was die Abbildung nur mangelhaft wieder-
giebt, daß wir die Nachahmung eines Balkenbaues
auf einem Fundament von Steinguadern vor
uns haben.
Ob die häufig vorkommenden, im Sprung auf
einen Hirsch begriffenen Löwen, in Repousssarbeit auf
Spangen oder auch alS einzelnes Schmuckstück (Nr. 470,
471) religiöse Bedeutung haben (in den semitischen
Mythologien tritt der Löwe bisweilen als Vertreter
der Sonnengluth auf), lasie ich dahingestellt; zweifel-
*) Vergl. u. A. die Abbildungen bei Rawlinson, l'lig
üvs Arsat Uonaroliiss, I, p. 279.
**) Rawlinson g. g. O. I, xa-ss. 139—149.