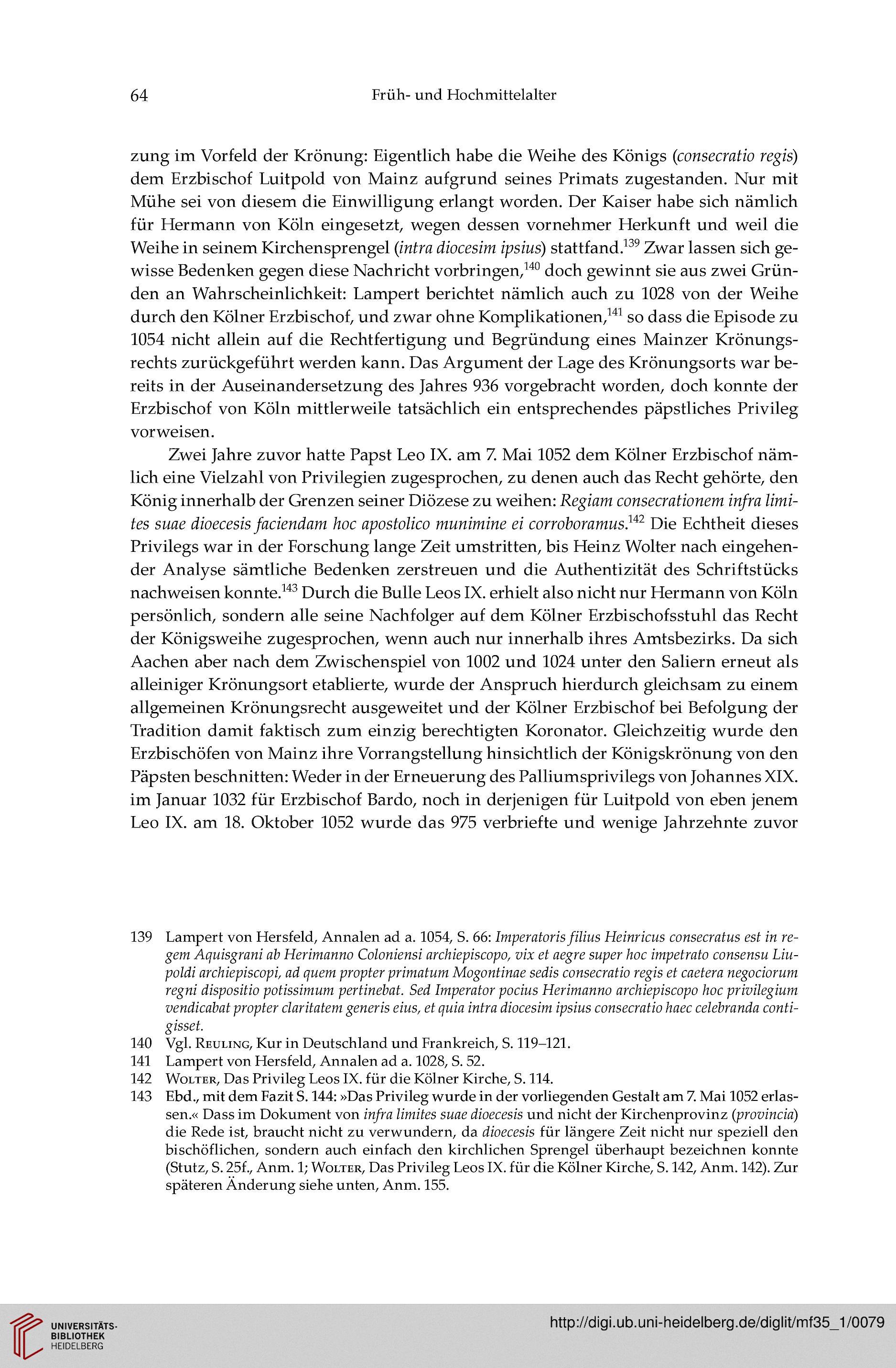64
Früh- und Hochmittelalter
zung im Vorfeld der Krönung: Eigentlich habe die Weihe des Königs (consecraho regzs)
dem Erzbischof Luitpold von Mainz aufgrund seines Primats zugestanden. Nur mit
Mühe sei von diesem die Einwilligung erlangt worden. Der Kaiser habe sich nämlich
für Hermann von Köln eingesetzt, wegen dessen vornehmer Herkunft und weil die
Weihe in seinem Kirchensprengel (znfnt dzoceszm zpsztts) stattfand/^ Zwar lassen sich ge-
wisse Bedenken gegen diese Nachricht Vorbringen/^ doch gewinnt sie aus zwei Grün-
den an Wahrscheinlichkeit: Lampert berichtet nämlich auch zu 1028 von der Weihe
durch den Kölner Erzbischof, und zwar ohne Komplikationen/^ so dass die Episode zu
1054 nicht allein auf die Rechtfertigung und Begründung eines Mainzer Krönungs-
rechts zurückgeführt werden kann. Das Argument der Lage des Krönungsorts war be-
reits in der Auseinandersetzung des Jahres 936 vorgebracht worden, doch konnte der
Erzbischof von Köln mittlerweile tatsächlich ein entsprechendes päpstliches Privileg
vorweisen.
Zwei Jahre zuvor hatte Papst Leo IX. am 7. Mai 1052 dem Kölner Erzbischof näm-
lich eine Vielzahl von Privilegien zugesprochen, zu denen auch das Recht gehörte, den
König innerhalb der Grenzen seiner Diözese zu weihen: Reyzam consecnthonem ztt/ra Izzwz-
fes szzzzc ziz'occcsz's /zzcz'czzdzzzzz Jzoc aposfohco zzzzzzzz'zzzz'zzc cz rozToAzm/zzzzs.'^ Die Echtheit dieses
Privilegs war in der Forschung lange Zeit umstritten, bis Heinz Wolter nach eingehen-
der Analyse sämtliche Bedenken zerstreuen und die Authentizität des Schriftstücks
nachweisen konnte.' ^ Durch die Bulle Leos IX. erhielt also nicht nur Hermann von Köln
persönlich, sondern alle seine Nachfolger auf dem Kölner Erzbischofsstuhl das Recht
der Königsweihe zugesprochen, wenn auch nur innerhalb ihres Amtsbezirks. Da sich
Aachen aber nach dem Zwischenspiel von 1002 und 1024 unter den Saliern erneut als
alleiniger Krönungsort etablierte, wurde der Anspruch hierdurch gleichsam zu einem
allgemeinen Krönungsrecht ausgeweitet und der Kölner Erzbischof bei Befolgung der
Tradition damit faktisch zum einzig berechtigten Koronator. Gleichzeitig wurde den
Erzbischöfen von Mainz ihre Vorrangstellung hinsichtlich der Königskrönung von den
Päpsten beschnitten: Weder in der Erneuerung des Palliumsprivilegs von Johannes XIX.
im Januar 1032 für Erzbischof Bardo, noch in derjenigen für Luitpold von eben jenem
Leo IX. am 18. Oktober 1052 wurde das 975 verbriefte und wenige Jahrzehnte zuvor
139 Lampert von Hersfeld, Annalen ad a. 1054, S. 66: bzzperafon's/zlzMS Hez'zzrz'cMS cowsecrafMS est zu re-
gem ÄtyMz'sgrazzz' aF Lfen'zzMMZzo Cotozzz'ezzsz arc/zz'epz'scopo, m'x et aegre super /zoc z'zzzpetrato cozzsezzsu Lz'u-
potdz arc/zz'epz'scopz, ad t?uem propter prz'zzzatuzz: Mogozztz'zzae sedz's cozzsecratz'o regz's et caetera zzegocz'oruzz:
regzzz dz'sposz'tz'o potz'ssz'mum pertz'zzeFat. Sed Imperator pocz'us Lferzmazzzzo arc/zz'epz'scopo /zoc przüzlegzüzzz
zzezzdz'caFat propter ctarz'tatezzz gezzerz's ez'us, et t?uz'a z'zztra dz'ocesz'zzz z'psz'us cozzsecratz'o /zaec ceteFrazzda cozztz-
gz'sset.
140 Vgl. REunNG, Kur in Deutschland und Frankreich, S. 119-121.
141 Lampert von Hersfeld, Annalen ad a. 1028, S. 52.
142 WoLTER, Das Privileg Leos IX. für die Kölner Kirche, S. 114.
143 Ebd., mit dem Fazit S. 144: »Das Privileg wurde in der vorliegenden Gestalt am 7. Mai 1052 erlas-
sen.« Dass im Dokument von z'zz/ra Iz'mz'fes suae dz'oecesz's und nicht der Kirchenprovinz (prom'zzcz'a)
die Rede ist, braucht nicht zu verwundern, da dzoeceszs für längere Zeit nicht nur speziell den
bischöflichen, sondern auch einfach den kirchlichen Sprengel überhaupt bezeichnen konnte
(Stutz, S. 25f., Anm. 1; WoLTER, Das Privileg Leos IX. für die Kölner Kirche, S. 142, Anm. 142). Zur
späteren Änderung siehe unten, Anm. 155.
Früh- und Hochmittelalter
zung im Vorfeld der Krönung: Eigentlich habe die Weihe des Königs (consecraho regzs)
dem Erzbischof Luitpold von Mainz aufgrund seines Primats zugestanden. Nur mit
Mühe sei von diesem die Einwilligung erlangt worden. Der Kaiser habe sich nämlich
für Hermann von Köln eingesetzt, wegen dessen vornehmer Herkunft und weil die
Weihe in seinem Kirchensprengel (znfnt dzoceszm zpsztts) stattfand/^ Zwar lassen sich ge-
wisse Bedenken gegen diese Nachricht Vorbringen/^ doch gewinnt sie aus zwei Grün-
den an Wahrscheinlichkeit: Lampert berichtet nämlich auch zu 1028 von der Weihe
durch den Kölner Erzbischof, und zwar ohne Komplikationen/^ so dass die Episode zu
1054 nicht allein auf die Rechtfertigung und Begründung eines Mainzer Krönungs-
rechts zurückgeführt werden kann. Das Argument der Lage des Krönungsorts war be-
reits in der Auseinandersetzung des Jahres 936 vorgebracht worden, doch konnte der
Erzbischof von Köln mittlerweile tatsächlich ein entsprechendes päpstliches Privileg
vorweisen.
Zwei Jahre zuvor hatte Papst Leo IX. am 7. Mai 1052 dem Kölner Erzbischof näm-
lich eine Vielzahl von Privilegien zugesprochen, zu denen auch das Recht gehörte, den
König innerhalb der Grenzen seiner Diözese zu weihen: Reyzam consecnthonem ztt/ra Izzwz-
fes szzzzc ziz'occcsz's /zzcz'czzdzzzzz Jzoc aposfohco zzzzzzzz'zzzz'zzc cz rozToAzm/zzzzs.'^ Die Echtheit dieses
Privilegs war in der Forschung lange Zeit umstritten, bis Heinz Wolter nach eingehen-
der Analyse sämtliche Bedenken zerstreuen und die Authentizität des Schriftstücks
nachweisen konnte.' ^ Durch die Bulle Leos IX. erhielt also nicht nur Hermann von Köln
persönlich, sondern alle seine Nachfolger auf dem Kölner Erzbischofsstuhl das Recht
der Königsweihe zugesprochen, wenn auch nur innerhalb ihres Amtsbezirks. Da sich
Aachen aber nach dem Zwischenspiel von 1002 und 1024 unter den Saliern erneut als
alleiniger Krönungsort etablierte, wurde der Anspruch hierdurch gleichsam zu einem
allgemeinen Krönungsrecht ausgeweitet und der Kölner Erzbischof bei Befolgung der
Tradition damit faktisch zum einzig berechtigten Koronator. Gleichzeitig wurde den
Erzbischöfen von Mainz ihre Vorrangstellung hinsichtlich der Königskrönung von den
Päpsten beschnitten: Weder in der Erneuerung des Palliumsprivilegs von Johannes XIX.
im Januar 1032 für Erzbischof Bardo, noch in derjenigen für Luitpold von eben jenem
Leo IX. am 18. Oktober 1052 wurde das 975 verbriefte und wenige Jahrzehnte zuvor
139 Lampert von Hersfeld, Annalen ad a. 1054, S. 66: bzzperafon's/zlzMS Hez'zzrz'cMS cowsecrafMS est zu re-
gem ÄtyMz'sgrazzz' aF Lfen'zzMMZzo Cotozzz'ezzsz arc/zz'epz'scopo, m'x et aegre super /zoc z'zzzpetrato cozzsezzsu Lz'u-
potdz arc/zz'epz'scopz, ad t?uem propter prz'zzzatuzz: Mogozztz'zzae sedz's cozzsecratz'o regz's et caetera zzegocz'oruzz:
regzzz dz'sposz'tz'o potz'ssz'mum pertz'zzeFat. Sed Imperator pocz'us Lferzmazzzzo arc/zz'epz'scopo /zoc przüzlegzüzzz
zzezzdz'caFat propter ctarz'tatezzz gezzerz's ez'us, et t?uz'a z'zztra dz'ocesz'zzz z'psz'us cozzsecratz'o /zaec ceteFrazzda cozztz-
gz'sset.
140 Vgl. REunNG, Kur in Deutschland und Frankreich, S. 119-121.
141 Lampert von Hersfeld, Annalen ad a. 1028, S. 52.
142 WoLTER, Das Privileg Leos IX. für die Kölner Kirche, S. 114.
143 Ebd., mit dem Fazit S. 144: »Das Privileg wurde in der vorliegenden Gestalt am 7. Mai 1052 erlas-
sen.« Dass im Dokument von z'zz/ra Iz'mz'fes suae dz'oecesz's und nicht der Kirchenprovinz (prom'zzcz'a)
die Rede ist, braucht nicht zu verwundern, da dzoeceszs für längere Zeit nicht nur speziell den
bischöflichen, sondern auch einfach den kirchlichen Sprengel überhaupt bezeichnen konnte
(Stutz, S. 25f., Anm. 1; WoLTER, Das Privileg Leos IX. für die Kölner Kirche, S. 142, Anm. 142). Zur
späteren Änderung siehe unten, Anm. 155.