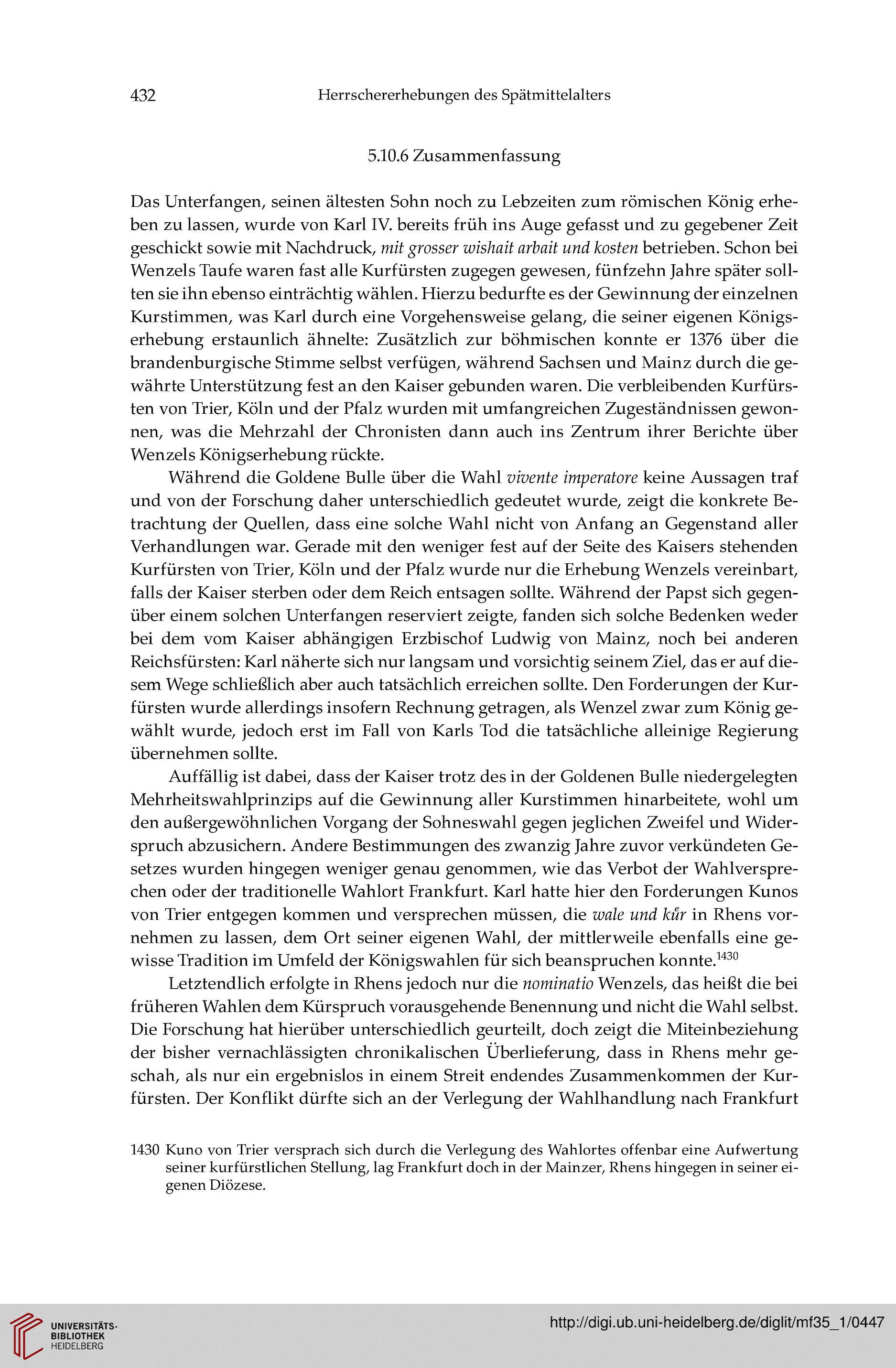432
Herrschererhebungen des Spätmittelalters
5.10.6 Zusammenfassung
Das Unterfangen, seinen ältesten Sohn noch zu Lebzeiten zum römischen König erhe-
ben zu lassen, wurde von Karl IV. bereits früh ins Auge gefasst und zu gegebener Zeit
geschickt sowie mit Nachdruck, mit grosser arhazf Mud /cosfen betrieben. Schon bei
Wenzels Taufe waren fast alle Kurfürsten zugegen gewesen, fünfzehn Jahre später soll-
ten sie ihn ebenso einträchtig wählen. Hierzu bedurfte es der Gewinnung der einzelnen
Kurstimmen, was Karl durch eine Vorgehensweise gelang, die seiner eigenen Königs-
erhebung erstaunlich ähnelte: Zusätzlich zur böhmischen konnte er 1376 über die
brandenburgische Stimme selbst verfügen, während Sachsen und Mainz durch die ge-
währte Unterstützung fest an den Kaiser gebunden waren. Die verbleibenden Kurfürs-
ten von Trier, Köln und der Pfalz wurden mit umfangreichen Zugeständnissen gewon-
nen, was die Mehrzahl der Chronisten dann auch ins Zentrum ihrer Berichte über
Wenzels Königserhebung rückte.
Während die Goldene Bulle über die Wahl uzuenfe impendore keine Aussagen traf
und von der Forschung daher unterschiedlich gedeutet wurde, zeigt die konkrete Be-
trachtung der Quellen, dass eine solche Wahl nicht von Anfang an Gegenstand aller
Verhandlungen war. Gerade mit den weniger fest auf der Seite des Kaisers stehenden
Kurfürsten von Trier, Köln und der Pfalz wurde nur die Erhebung Wenzels vereinbart,
falls der Kaiser sterben oder dem Reich entsagen sollte. Während der Papst sich gegen-
über einem solchen Unterfangen reserviert zeigte, fanden sich solche Bedenken weder
bei dem vom Kaiser abhängigen Erzbischof Ludwig von Mainz, noch bei anderen
Reichsfürsten: Karl näherte sich nur langsam und vorsichtig seinem Ziel, das er auf die-
sem Wege schließlich aber auch tatsächlich erreichen sollte. Den Forderungen der Kur-
fürsten wurde allerdings insofern Rechnung getragen, als Wenzel zwar zum König ge-
wählt wurde, jedoch erst im Fall von Karls Tod die tatsächliche alleinige Regierung
übernehmen sollte.
Auffällig ist dabei, dass der Kaiser trotz des in der Goldenen Bulle niedergelegten
Mehrheitswahlprinzips auf die Gewinnung aller Kurstimmen hinarbeitete, wohl um
den außergewöhnlichen Vorgang der Sohneswahl gegen jeglichen Zweifel und Wider-
spruch abzusichern. Andere Bestimmungen des zwanzig Jahre zuvor verkündeten Ge-
setzes wurden hingegen weniger genau genommen, wie das Verbot der Wahlverspre-
chen oder der traditionelle Wahlort Frankfurt. Karl hatte hier den Forderungen Kunos
von Trier entgegen kommen und versprechen müssen, die wale Mud /aü in Rhens vor-
nehmen zu lassen, dem Ort seiner eigenen Wahl, der mittlerweile ebenfalls eine ge-
wisse Tradition im Umfeld der Königswahlen für sich beanspruchen konnte.'^"
Letztendlich erfolgte in Rhens jedoch nur die nonn'nah'o Wenzels, das heißt die bei
früheren Wahlen dem Kürspruch vorausgehende Benennung und nicht die Wahl selbst.
Die Forschung hat hierüber unterschiedlich geurteilt, doch zeigt die Miteinbeziehung
der bisher vernachlässigten chronikalischen Überlieferung, dass in Rhens mehr ge-
schah, als nur ein ergebnislos in einem Streit endendes Zusammenkommen der Kur-
fürsten. Der Konflikt dürfte sich an der Verlegung der Wahlhandlung nach Frankfurt
1430 Kuno von Trier versprach sich durch die Verlegung des Wahlortes offenbar eine Aufwertung
seiner kurfürstlichen Stellung, lag Frankfurt doch in der Mainzer, Rhens hingegen in seiner ei-
genen Diözese.
Herrschererhebungen des Spätmittelalters
5.10.6 Zusammenfassung
Das Unterfangen, seinen ältesten Sohn noch zu Lebzeiten zum römischen König erhe-
ben zu lassen, wurde von Karl IV. bereits früh ins Auge gefasst und zu gegebener Zeit
geschickt sowie mit Nachdruck, mit grosser arhazf Mud /cosfen betrieben. Schon bei
Wenzels Taufe waren fast alle Kurfürsten zugegen gewesen, fünfzehn Jahre später soll-
ten sie ihn ebenso einträchtig wählen. Hierzu bedurfte es der Gewinnung der einzelnen
Kurstimmen, was Karl durch eine Vorgehensweise gelang, die seiner eigenen Königs-
erhebung erstaunlich ähnelte: Zusätzlich zur böhmischen konnte er 1376 über die
brandenburgische Stimme selbst verfügen, während Sachsen und Mainz durch die ge-
währte Unterstützung fest an den Kaiser gebunden waren. Die verbleibenden Kurfürs-
ten von Trier, Köln und der Pfalz wurden mit umfangreichen Zugeständnissen gewon-
nen, was die Mehrzahl der Chronisten dann auch ins Zentrum ihrer Berichte über
Wenzels Königserhebung rückte.
Während die Goldene Bulle über die Wahl uzuenfe impendore keine Aussagen traf
und von der Forschung daher unterschiedlich gedeutet wurde, zeigt die konkrete Be-
trachtung der Quellen, dass eine solche Wahl nicht von Anfang an Gegenstand aller
Verhandlungen war. Gerade mit den weniger fest auf der Seite des Kaisers stehenden
Kurfürsten von Trier, Köln und der Pfalz wurde nur die Erhebung Wenzels vereinbart,
falls der Kaiser sterben oder dem Reich entsagen sollte. Während der Papst sich gegen-
über einem solchen Unterfangen reserviert zeigte, fanden sich solche Bedenken weder
bei dem vom Kaiser abhängigen Erzbischof Ludwig von Mainz, noch bei anderen
Reichsfürsten: Karl näherte sich nur langsam und vorsichtig seinem Ziel, das er auf die-
sem Wege schließlich aber auch tatsächlich erreichen sollte. Den Forderungen der Kur-
fürsten wurde allerdings insofern Rechnung getragen, als Wenzel zwar zum König ge-
wählt wurde, jedoch erst im Fall von Karls Tod die tatsächliche alleinige Regierung
übernehmen sollte.
Auffällig ist dabei, dass der Kaiser trotz des in der Goldenen Bulle niedergelegten
Mehrheitswahlprinzips auf die Gewinnung aller Kurstimmen hinarbeitete, wohl um
den außergewöhnlichen Vorgang der Sohneswahl gegen jeglichen Zweifel und Wider-
spruch abzusichern. Andere Bestimmungen des zwanzig Jahre zuvor verkündeten Ge-
setzes wurden hingegen weniger genau genommen, wie das Verbot der Wahlverspre-
chen oder der traditionelle Wahlort Frankfurt. Karl hatte hier den Forderungen Kunos
von Trier entgegen kommen und versprechen müssen, die wale Mud /aü in Rhens vor-
nehmen zu lassen, dem Ort seiner eigenen Wahl, der mittlerweile ebenfalls eine ge-
wisse Tradition im Umfeld der Königswahlen für sich beanspruchen konnte.'^"
Letztendlich erfolgte in Rhens jedoch nur die nonn'nah'o Wenzels, das heißt die bei
früheren Wahlen dem Kürspruch vorausgehende Benennung und nicht die Wahl selbst.
Die Forschung hat hierüber unterschiedlich geurteilt, doch zeigt die Miteinbeziehung
der bisher vernachlässigten chronikalischen Überlieferung, dass in Rhens mehr ge-
schah, als nur ein ergebnislos in einem Streit endendes Zusammenkommen der Kur-
fürsten. Der Konflikt dürfte sich an der Verlegung der Wahlhandlung nach Frankfurt
1430 Kuno von Trier versprach sich durch die Verlegung des Wahlortes offenbar eine Aufwertung
seiner kurfürstlichen Stellung, lag Frankfurt doch in der Mainzer, Rhens hingegen in seiner ei-
genen Diözese.