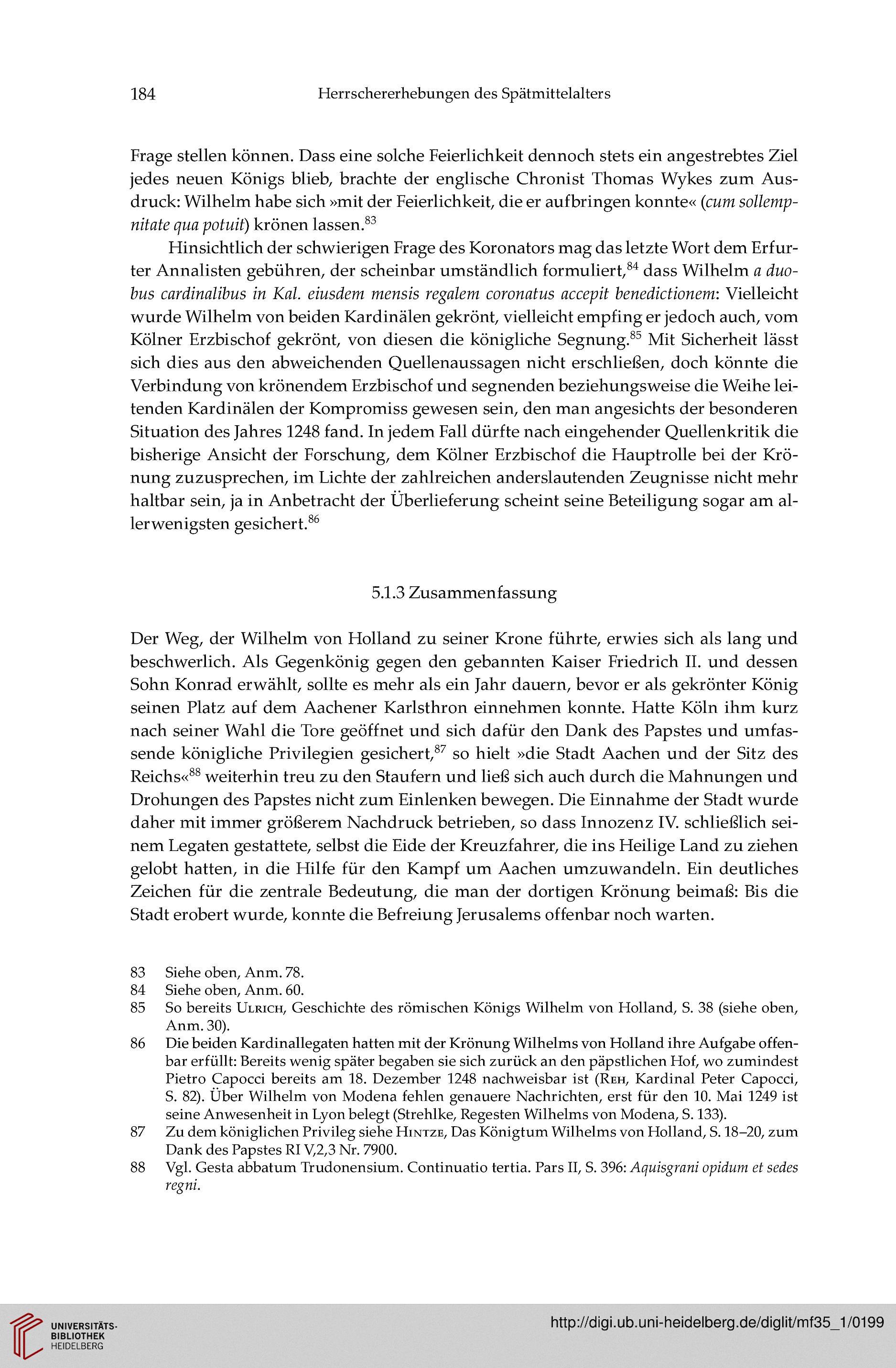184
Herrschererhebungen des Spätmittelalters
Frage stellen können. Dass eine solche Feierlichkeit dennoch stets ein angestrebtes Ziel
jedes neuen Königs blieb, brachte der englische Chronist Thomas Wykes zum Aus-
druck: Wilhelm habe sich »mit der Feierlichkeit, die er aufbringen konnte« (ctuw soHemp-
nzhife pua pofnzf) krönen lassen.^
Hinsichtlich der schwierigen Frage des Koronators mag das letzte Wort dem Erfur-
ter Annalisten gebühren, der scheinbar umständlich formuliert,^ dass Wilhelm a d Mo-
hns cardztMÜhns zu Kal. ezMsdew wenszs regalem coronalrzs accepll henedzchonew: Vielleicht
wurde Wilhelm von beiden Kardinalen gekrönt, vielleicht empfing er jedoch auch, vom
Kölner Erzbischof gekrönt, von diesen die königliche Segnung.^ Mit Sicherheit lässt
sich dies aus den abweichenden Quellenaussagen nicht erschließen, doch könnte die
Verbindung von krönendem Erzbischof und segnenden beziehungsweise die Weihe lei-
tenden Kardinälen der Kompromiss gewesen sein, den man angesichts der besonderen
Situation des Jahres 1248 fand. In jedem Fall dürfte nach eingehender Quellenkritik die
bisherige Ansicht der Forschung, dem Kölner Erzbischof die Hauptrolle bei der Krö-
nung zuzusprechen, im Lichte der zahlreichen anderslautenden Zeugnisse nicht mehr
haltbar sein, ja in Anbetracht der Überlieferung scheint seine Beteiligung sogar am al-
lerwenigsten gesichert.^
5.1.3 Zusammenfassung
Der Weg, der Wilhelm von Holland zu seiner Krone führte, erwies sich als lang und
beschwerlich. Als Gegenkönig gegen den gebannten Kaiser Friedrich II. und dessen
Sohn Konrad erwählt, sollte es mehr als ein Jahr dauern, bevor er als gekrönter König
seinen Platz auf dem Aachener Karlsthron einnehmen konnte. Hatte Köln ihm kurz
nach seiner Wahl die Tore geöffnet und sich dafür den Dank des Papstes und umfas-
sende königliche Privilegien gesichert,^ so hielt »die Stadt Aachen und der Sitz des
Reichs«^ weiterhin treu zu den Staufern und ließ sich auch durch die Mahnungen und
Drohungen des Papstes nicht zum Einlenken bewegen. Die Einnahme der Stadt wurde
daher mit immer größerem Nachdruck betrieben, so dass Innozenz IV. schließlich sei-
nem Legaten gestattete, selbst die Eide der Kreuzfahrer, die ins Heilige Land zu ziehen
gelobt hatten, in die Hilfe für den Kampf um Aachen umzuwandeln. Ein deutliches
Zeichen für die zentrale Bedeutung, die man der dortigen Krönung beimaß: Bis die
Stadt erobert wurde, konnte die Befreiung Jerusalems offenbar noch warten.
83 Siehe oben, Anm. 78.
84 Siehe oben, Anm. 60.
85 So bereits UnucH, Geschichte des römischen Königs Wilhelm von Holland, S. 38 (siehe oben,
Anm. 30).
86 Die beiden Kardinallegaten hatten mit der Krönung Wilhelms von Holland ihre Aufgabe offen-
bar erfüllt: Bereits wenig später begaben sie sich zurück an den päpstlichen Hof, wo zumindest
Pietro Capocci bereits am 18. Dezember 1248 nachweisbar ist (REH, Kardinal Peter Capocci,
S. 82). Über Wilhelm von Modena fehlen genauere Nachrichten, erst für den 10. Mai 1249 ist
seine Anwesenheit in Lyon belegt (Strehlke, Regesten Wilhelms von Modena, S. 133).
87 Zu dem königlichen Privileg siehe HiNTZE, Das Königtum Wilhelms von Holland, S. 18-20, zum
Dank des Papstes RI V,2,3 Nr. 7900.
88 Vgl. Gesta abbatum Trudonensium. Continuatio tertia. Pars II, S. 396: Atpzz'sgrazzz opz'dzzzz: cf sedes
reg uz.
Herrschererhebungen des Spätmittelalters
Frage stellen können. Dass eine solche Feierlichkeit dennoch stets ein angestrebtes Ziel
jedes neuen Königs blieb, brachte der englische Chronist Thomas Wykes zum Aus-
druck: Wilhelm habe sich »mit der Feierlichkeit, die er aufbringen konnte« (ctuw soHemp-
nzhife pua pofnzf) krönen lassen.^
Hinsichtlich der schwierigen Frage des Koronators mag das letzte Wort dem Erfur-
ter Annalisten gebühren, der scheinbar umständlich formuliert,^ dass Wilhelm a d Mo-
hns cardztMÜhns zu Kal. ezMsdew wenszs regalem coronalrzs accepll henedzchonew: Vielleicht
wurde Wilhelm von beiden Kardinalen gekrönt, vielleicht empfing er jedoch auch, vom
Kölner Erzbischof gekrönt, von diesen die königliche Segnung.^ Mit Sicherheit lässt
sich dies aus den abweichenden Quellenaussagen nicht erschließen, doch könnte die
Verbindung von krönendem Erzbischof und segnenden beziehungsweise die Weihe lei-
tenden Kardinälen der Kompromiss gewesen sein, den man angesichts der besonderen
Situation des Jahres 1248 fand. In jedem Fall dürfte nach eingehender Quellenkritik die
bisherige Ansicht der Forschung, dem Kölner Erzbischof die Hauptrolle bei der Krö-
nung zuzusprechen, im Lichte der zahlreichen anderslautenden Zeugnisse nicht mehr
haltbar sein, ja in Anbetracht der Überlieferung scheint seine Beteiligung sogar am al-
lerwenigsten gesichert.^
5.1.3 Zusammenfassung
Der Weg, der Wilhelm von Holland zu seiner Krone führte, erwies sich als lang und
beschwerlich. Als Gegenkönig gegen den gebannten Kaiser Friedrich II. und dessen
Sohn Konrad erwählt, sollte es mehr als ein Jahr dauern, bevor er als gekrönter König
seinen Platz auf dem Aachener Karlsthron einnehmen konnte. Hatte Köln ihm kurz
nach seiner Wahl die Tore geöffnet und sich dafür den Dank des Papstes und umfas-
sende königliche Privilegien gesichert,^ so hielt »die Stadt Aachen und der Sitz des
Reichs«^ weiterhin treu zu den Staufern und ließ sich auch durch die Mahnungen und
Drohungen des Papstes nicht zum Einlenken bewegen. Die Einnahme der Stadt wurde
daher mit immer größerem Nachdruck betrieben, so dass Innozenz IV. schließlich sei-
nem Legaten gestattete, selbst die Eide der Kreuzfahrer, die ins Heilige Land zu ziehen
gelobt hatten, in die Hilfe für den Kampf um Aachen umzuwandeln. Ein deutliches
Zeichen für die zentrale Bedeutung, die man der dortigen Krönung beimaß: Bis die
Stadt erobert wurde, konnte die Befreiung Jerusalems offenbar noch warten.
83 Siehe oben, Anm. 78.
84 Siehe oben, Anm. 60.
85 So bereits UnucH, Geschichte des römischen Königs Wilhelm von Holland, S. 38 (siehe oben,
Anm. 30).
86 Die beiden Kardinallegaten hatten mit der Krönung Wilhelms von Holland ihre Aufgabe offen-
bar erfüllt: Bereits wenig später begaben sie sich zurück an den päpstlichen Hof, wo zumindest
Pietro Capocci bereits am 18. Dezember 1248 nachweisbar ist (REH, Kardinal Peter Capocci,
S. 82). Über Wilhelm von Modena fehlen genauere Nachrichten, erst für den 10. Mai 1249 ist
seine Anwesenheit in Lyon belegt (Strehlke, Regesten Wilhelms von Modena, S. 133).
87 Zu dem königlichen Privileg siehe HiNTZE, Das Königtum Wilhelms von Holland, S. 18-20, zum
Dank des Papstes RI V,2,3 Nr. 7900.
88 Vgl. Gesta abbatum Trudonensium. Continuatio tertia. Pars II, S. 396: Atpzz'sgrazzz opz'dzzzz: cf sedes
reg uz.