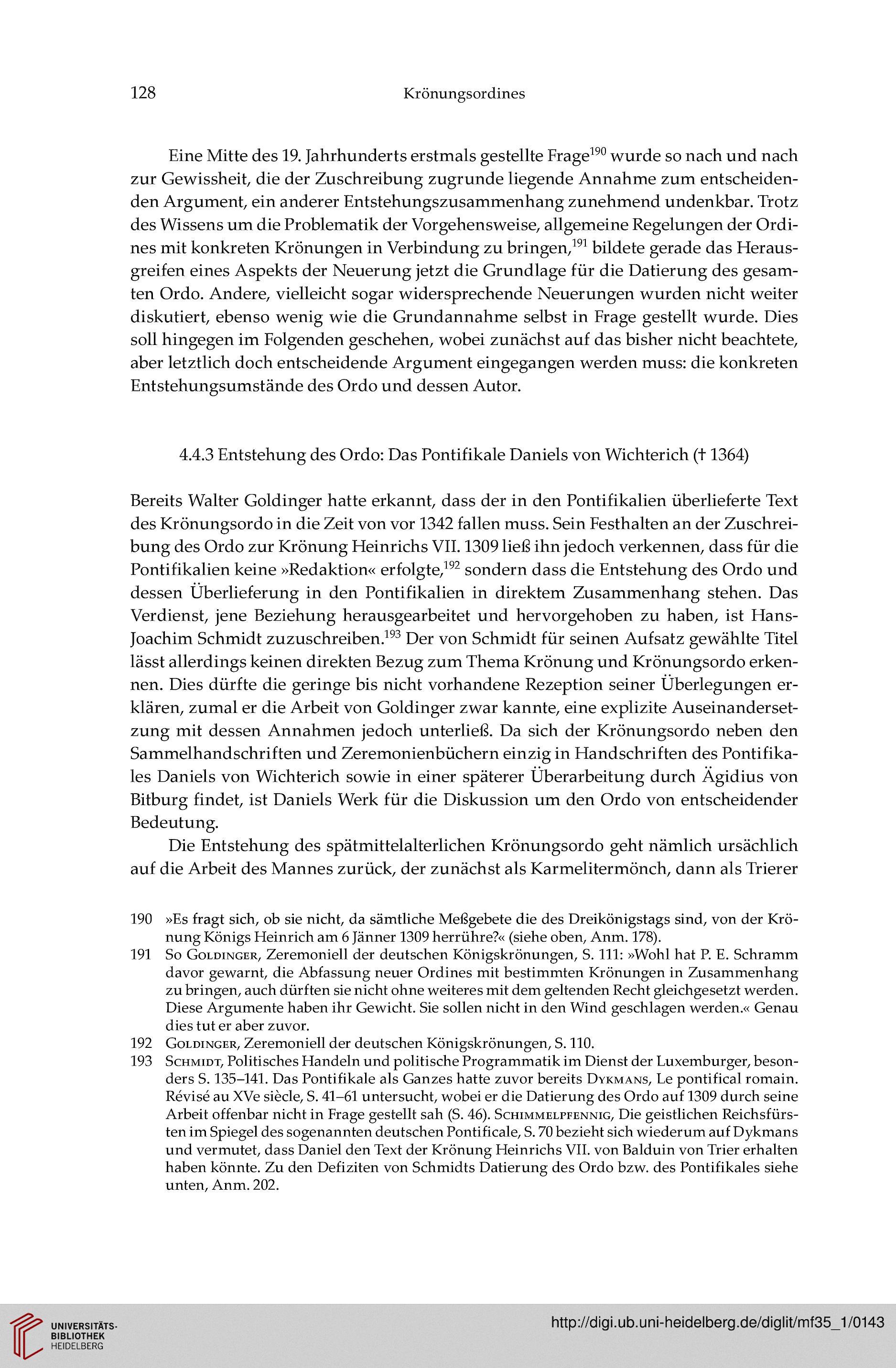128
Krönungsordines
Eine Mitte des 19. Jahrhunderts erstmals gestellte Frage''"' wurde so nach und nach
zur Gewissheit, die der Zuschreibung zugrunde liegende Annahme zum entscheiden-
den Argument, ein anderer Entstehungszusammenhang zunehmend undenkbar. Trotz
des Wissens um die Problematik der Vorgehensweise, allgemeine Regelungen der Ordi-
nes mit konkreten Krönungen in Verbindung zu bringen,'" bildete gerade das Heraus-
greifen eines Aspekts der Neuerung jetzt die Grundlage für die Datierung des gesam-
ten Ordo. Andere, vielleicht sogar widersprechende Neuerungen wurden nicht weiter
diskutiert, ebenso wenig wie die Grundannahme selbst in Frage gestellt wurde. Dies
soll hingegen im Folgenden geschehen, wobei zunächst auf das bisher nicht beachtete,
aber letztlich doch entscheidende Argument eingegangen werden muss: die konkreten
Entstehungsumstände des Ordo und dessen Autor.
4.4.3 Entstehung des Ordo: Das Pontifikale Daniels von Wichterich (t 1364)
Bereits Walter Goldinger hatte erkannt, dass der in den Pontifikalien überlieferte Text
des Krönungsordo in die Zeit von vor 1342 fallen muss. Sein Festhalten an der Zuschrei-
bung des Ordo zur Krönung Heinrichs VIF 1309 ließ ihn jedoch verkennen, dass für die
Pontifikalien keine »Redaktion« erfolgte,' " sondern dass die Entstehung des Ordo und
dessen Überlieferung in den Pontifikalien in direktem Zusammenhang stehen. Das
Verdienst, jene Beziehung herausgearbeitet und hervorgehoben zu haben, ist Hans-
Joachim Schmidt zuzuschreiben.''" Der von Schmidt für seinen Aufsatz gewählte Titel
lässt allerdings keinen direkten Bezug zum Thema Krönung und Krönungsordo erken-
nen. Dies dürfte die geringe bis nicht vorhandene Rezeption seiner Überlegungen er-
klären, zumal er die Arbeit von Goldinger zwar kannte, eine explizite Auseinanderset-
zung mit dessen Annahmen jedoch unterließ. Da sich der Krönungsordo neben den
Sammelhandschriften und Zeremonienbüchern einzig in Handschriften des Pontifika-
les Daniels von Wichterich sowie in einer späterer Überarbeitung durch Agidius von
Bitburg findet, ist Daniels Werk für die Diskussion um den Ordo von entscheidender
Bedeutung.
Die Entstehung des spätmittelalterlichen Krönungsordo geht nämlich ursächlich
auf die Arbeit des Mannes zurück, der zunächst als Karmelitermönch, dann als Trierer
190 »Es fragt sich, ob sie nicht, da sämtliche Meßgebete die des Dreikönigstags sind, von der Krö-
nung Königs Heinrich am 6 Jänner 1309 herrühre?« (siehe oben, Anm. 178).
191 So GoLDiNGER, Zeremoniell der deutschen Königskrönungen, S. 111: »Wohl hat P. E. Schramm
davor gewarnt, die Abfassung neuer Ordines mit bestimmten Krönungen in Zusammenhang
zu bringen, auch dürften sie nicht ohne weiteres mit dem geltenden Recht gleichgesetzt werden.
Diese Argumente haben ihr Gewicht. Sie sollen nicht in den Wind geschlagen werden.« Genau
dies tut er aber zuvor.
192 GoLDiNGER, Zeremoniell der deutschen Königskrönungen, S. 110.
193 ScHMiDT, Politisches Handeln und politische Programmatik im Dienst der Luxemburger, beson-
ders S. 135-141. Das Pontifikale als Ganzes hatte zuvor bereits DvKM ANS, Le pontifical romain.
Revise au XVe siede, S. 41-61 untersucht, wobei er die Datierung des Ordo auf 1309 durch seine
Arbeit offenbar nicht in Frage gestellt sah (S. 46). ScHiMMELPFENNiG, Die geistlichen Reichsfürs-
ten im Spiegel des sogenannten deutschen Pontificale, S. 70 bezieht sich wiederum auf Dykmans
und vermutet, dass Daniel den Text der Krönung Heinrichs VII. von Balduin von Trier erhalten
haben könnte. Zu den Defiziten von Schmidts Datierung des Ordo bzw. des Pontifikales siehe
unten, Anm. 202.
Krönungsordines
Eine Mitte des 19. Jahrhunderts erstmals gestellte Frage''"' wurde so nach und nach
zur Gewissheit, die der Zuschreibung zugrunde liegende Annahme zum entscheiden-
den Argument, ein anderer Entstehungszusammenhang zunehmend undenkbar. Trotz
des Wissens um die Problematik der Vorgehensweise, allgemeine Regelungen der Ordi-
nes mit konkreten Krönungen in Verbindung zu bringen,'" bildete gerade das Heraus-
greifen eines Aspekts der Neuerung jetzt die Grundlage für die Datierung des gesam-
ten Ordo. Andere, vielleicht sogar widersprechende Neuerungen wurden nicht weiter
diskutiert, ebenso wenig wie die Grundannahme selbst in Frage gestellt wurde. Dies
soll hingegen im Folgenden geschehen, wobei zunächst auf das bisher nicht beachtete,
aber letztlich doch entscheidende Argument eingegangen werden muss: die konkreten
Entstehungsumstände des Ordo und dessen Autor.
4.4.3 Entstehung des Ordo: Das Pontifikale Daniels von Wichterich (t 1364)
Bereits Walter Goldinger hatte erkannt, dass der in den Pontifikalien überlieferte Text
des Krönungsordo in die Zeit von vor 1342 fallen muss. Sein Festhalten an der Zuschrei-
bung des Ordo zur Krönung Heinrichs VIF 1309 ließ ihn jedoch verkennen, dass für die
Pontifikalien keine »Redaktion« erfolgte,' " sondern dass die Entstehung des Ordo und
dessen Überlieferung in den Pontifikalien in direktem Zusammenhang stehen. Das
Verdienst, jene Beziehung herausgearbeitet und hervorgehoben zu haben, ist Hans-
Joachim Schmidt zuzuschreiben.''" Der von Schmidt für seinen Aufsatz gewählte Titel
lässt allerdings keinen direkten Bezug zum Thema Krönung und Krönungsordo erken-
nen. Dies dürfte die geringe bis nicht vorhandene Rezeption seiner Überlegungen er-
klären, zumal er die Arbeit von Goldinger zwar kannte, eine explizite Auseinanderset-
zung mit dessen Annahmen jedoch unterließ. Da sich der Krönungsordo neben den
Sammelhandschriften und Zeremonienbüchern einzig in Handschriften des Pontifika-
les Daniels von Wichterich sowie in einer späterer Überarbeitung durch Agidius von
Bitburg findet, ist Daniels Werk für die Diskussion um den Ordo von entscheidender
Bedeutung.
Die Entstehung des spätmittelalterlichen Krönungsordo geht nämlich ursächlich
auf die Arbeit des Mannes zurück, der zunächst als Karmelitermönch, dann als Trierer
190 »Es fragt sich, ob sie nicht, da sämtliche Meßgebete die des Dreikönigstags sind, von der Krö-
nung Königs Heinrich am 6 Jänner 1309 herrühre?« (siehe oben, Anm. 178).
191 So GoLDiNGER, Zeremoniell der deutschen Königskrönungen, S. 111: »Wohl hat P. E. Schramm
davor gewarnt, die Abfassung neuer Ordines mit bestimmten Krönungen in Zusammenhang
zu bringen, auch dürften sie nicht ohne weiteres mit dem geltenden Recht gleichgesetzt werden.
Diese Argumente haben ihr Gewicht. Sie sollen nicht in den Wind geschlagen werden.« Genau
dies tut er aber zuvor.
192 GoLDiNGER, Zeremoniell der deutschen Königskrönungen, S. 110.
193 ScHMiDT, Politisches Handeln und politische Programmatik im Dienst der Luxemburger, beson-
ders S. 135-141. Das Pontifikale als Ganzes hatte zuvor bereits DvKM ANS, Le pontifical romain.
Revise au XVe siede, S. 41-61 untersucht, wobei er die Datierung des Ordo auf 1309 durch seine
Arbeit offenbar nicht in Frage gestellt sah (S. 46). ScHiMMELPFENNiG, Die geistlichen Reichsfürs-
ten im Spiegel des sogenannten deutschen Pontificale, S. 70 bezieht sich wiederum auf Dykmans
und vermutet, dass Daniel den Text der Krönung Heinrichs VII. von Balduin von Trier erhalten
haben könnte. Zu den Defiziten von Schmidts Datierung des Ordo bzw. des Pontifikales siehe
unten, Anm. 202.