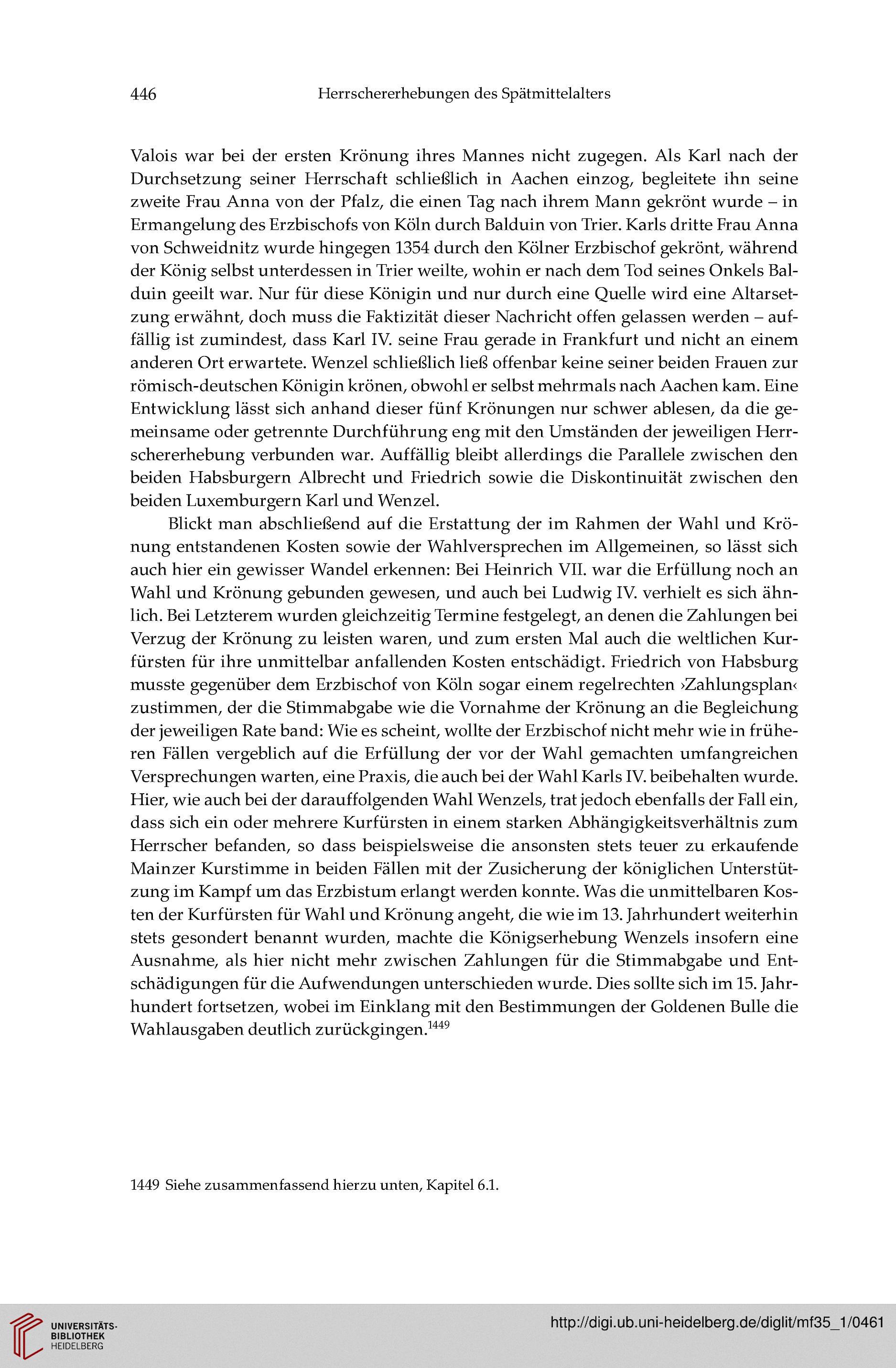446
Herrschererhebungen des Spätmittelalters
Valois war bei der ersten Krönung ihres Mannes nicht zugegen. Als Karl nach der
Durchsetzung seiner Herrschaft schließlich in Aachen einzog, begleitete ihn seine
zweite Frau Anna von der Pfalz, die einen Tag nach ihrem Mann gekrönt wurde - in
Ermangelung des Erzbischofs von Köln durch Balduin von Trier. Karls dritte Frau Anna
von Schweidnitz wurde hingegen 1354 durch den Kölner Erzbischof gekrönt, während
der König selbst unterdessen in Trier weilte, wohin er nach dem Tod seines Onkels Bal-
duin geeilt war. Nur für diese Königin und nur durch eine Quelle wird eine Altarset-
zung erwähnt, doch muss die Faktizität dieser Nachricht offen gelassen werden - auf-
fällig ist zumindest, dass Karl IV. seine Frau gerade in Frankfurt und nicht an einem
anderen Ort erwartete. Wenzel schließlich ließ offenbar keine seiner beiden Frauen zur
römisch-deutschen Königin krönen, obwohl er selbst mehrmals nach Aachen kam. Eine
Entwicklung lässt sich anhand dieser fünf Krönungen nur schwer ablesen, da die ge-
meinsame oder getrennte Durchführung eng mit den Umständen der jeweiligen Herr-
schererhebung verbunden war. Auffällig bleibt allerdings die Parallele zwischen den
beiden Habsburgern Albrecht und Friedrich sowie die Diskontinuität zwischen den
beiden Fuxemburgern Karl und Wenzel.
Blickt man abschließend auf die Erstattung der im Rahmen der Wahl und Krö-
nung entstandenen Kosten sowie der Wahlversprechen im Allgemeinen, so lässt sich
auch hier ein gewisser Wandel erkennen: Bei Heinrich VII. war die Erfüllung noch an
Wahl und Krönung gebunden gewesen, und auch bei Fudwig IV. verhielt es sich ähn-
lich. Bei Fetzterem wurden gleichzeitig Termine festgelegt, an denen die Zahlungen bei
Verzug der Krönung zu leisten waren, und zum ersten Mal auch die weltlichen Kur-
fürsten für ihre unmittelbar anfallenden Kosten entschädigt. Friedrich von Habsburg
musste gegenüber dem Erzbischof von Köln sogar einem regelrechten >Zahlungsplan<
zustimmen, der die Stimmabgabe wie die Vornahme der Krönung an die Begleichung
der jeweiligen Rate band: Wie es scheint, wollte der Erzbischof nicht mehr wie in frühe-
ren Fällen vergeblich auf die Erfüllung der vor der Wahl gemachten umfangreichen
Versprechungen warten, eine Praxis, die auch bei der Wahl Karls IV. beibehalten wurde.
Hier, wie auch bei der darauffolgenden Wahl Wenzels, trat jedoch ebenfalls der Fall ein,
dass sich ein oder mehrere Kurfürsten in einem starken Abhängigkeitsverhältnis zum
Herrscher befanden, so dass beispielsweise die ansonsten stets teuer zu erkaufende
Mainzer Kurstimme in beiden Fällen mit der Zusicherung der königlichen Unterstüt-
zung im Kampf um das Erzbistum erlangt werden konnte. Was die unmittelbaren Kos-
ten der Kurfürsten für Wahl und Krönung angeht, die wie im 13. Jahrhundert weiterhin
stets gesondert benannt wurden, machte die Königserhebung Wenzels insofern eine
Ausnahme, als hier nicht mehr zwischen Zahlungen für die Stimmabgabe und Ent-
schädigungen für die Aufwendungen unterschieden wurde. Dies sollte sich im 15. Jahr-
hundert fortsetzen, wobei im Einklang mit den Bestimmungen der Goldenen Bulle die
Wahlausgaben deutlich zurückgingen
1449 Siehe zusammenfassend hierzu unten, Kapitel 6.1.
Herrschererhebungen des Spätmittelalters
Valois war bei der ersten Krönung ihres Mannes nicht zugegen. Als Karl nach der
Durchsetzung seiner Herrschaft schließlich in Aachen einzog, begleitete ihn seine
zweite Frau Anna von der Pfalz, die einen Tag nach ihrem Mann gekrönt wurde - in
Ermangelung des Erzbischofs von Köln durch Balduin von Trier. Karls dritte Frau Anna
von Schweidnitz wurde hingegen 1354 durch den Kölner Erzbischof gekrönt, während
der König selbst unterdessen in Trier weilte, wohin er nach dem Tod seines Onkels Bal-
duin geeilt war. Nur für diese Königin und nur durch eine Quelle wird eine Altarset-
zung erwähnt, doch muss die Faktizität dieser Nachricht offen gelassen werden - auf-
fällig ist zumindest, dass Karl IV. seine Frau gerade in Frankfurt und nicht an einem
anderen Ort erwartete. Wenzel schließlich ließ offenbar keine seiner beiden Frauen zur
römisch-deutschen Königin krönen, obwohl er selbst mehrmals nach Aachen kam. Eine
Entwicklung lässt sich anhand dieser fünf Krönungen nur schwer ablesen, da die ge-
meinsame oder getrennte Durchführung eng mit den Umständen der jeweiligen Herr-
schererhebung verbunden war. Auffällig bleibt allerdings die Parallele zwischen den
beiden Habsburgern Albrecht und Friedrich sowie die Diskontinuität zwischen den
beiden Fuxemburgern Karl und Wenzel.
Blickt man abschließend auf die Erstattung der im Rahmen der Wahl und Krö-
nung entstandenen Kosten sowie der Wahlversprechen im Allgemeinen, so lässt sich
auch hier ein gewisser Wandel erkennen: Bei Heinrich VII. war die Erfüllung noch an
Wahl und Krönung gebunden gewesen, und auch bei Fudwig IV. verhielt es sich ähn-
lich. Bei Fetzterem wurden gleichzeitig Termine festgelegt, an denen die Zahlungen bei
Verzug der Krönung zu leisten waren, und zum ersten Mal auch die weltlichen Kur-
fürsten für ihre unmittelbar anfallenden Kosten entschädigt. Friedrich von Habsburg
musste gegenüber dem Erzbischof von Köln sogar einem regelrechten >Zahlungsplan<
zustimmen, der die Stimmabgabe wie die Vornahme der Krönung an die Begleichung
der jeweiligen Rate band: Wie es scheint, wollte der Erzbischof nicht mehr wie in frühe-
ren Fällen vergeblich auf die Erfüllung der vor der Wahl gemachten umfangreichen
Versprechungen warten, eine Praxis, die auch bei der Wahl Karls IV. beibehalten wurde.
Hier, wie auch bei der darauffolgenden Wahl Wenzels, trat jedoch ebenfalls der Fall ein,
dass sich ein oder mehrere Kurfürsten in einem starken Abhängigkeitsverhältnis zum
Herrscher befanden, so dass beispielsweise die ansonsten stets teuer zu erkaufende
Mainzer Kurstimme in beiden Fällen mit der Zusicherung der königlichen Unterstüt-
zung im Kampf um das Erzbistum erlangt werden konnte. Was die unmittelbaren Kos-
ten der Kurfürsten für Wahl und Krönung angeht, die wie im 13. Jahrhundert weiterhin
stets gesondert benannt wurden, machte die Königserhebung Wenzels insofern eine
Ausnahme, als hier nicht mehr zwischen Zahlungen für die Stimmabgabe und Ent-
schädigungen für die Aufwendungen unterschieden wurde. Dies sollte sich im 15. Jahr-
hundert fortsetzen, wobei im Einklang mit den Bestimmungen der Goldenen Bulle die
Wahlausgaben deutlich zurückgingen
1449 Siehe zusammenfassend hierzu unten, Kapitel 6.1.