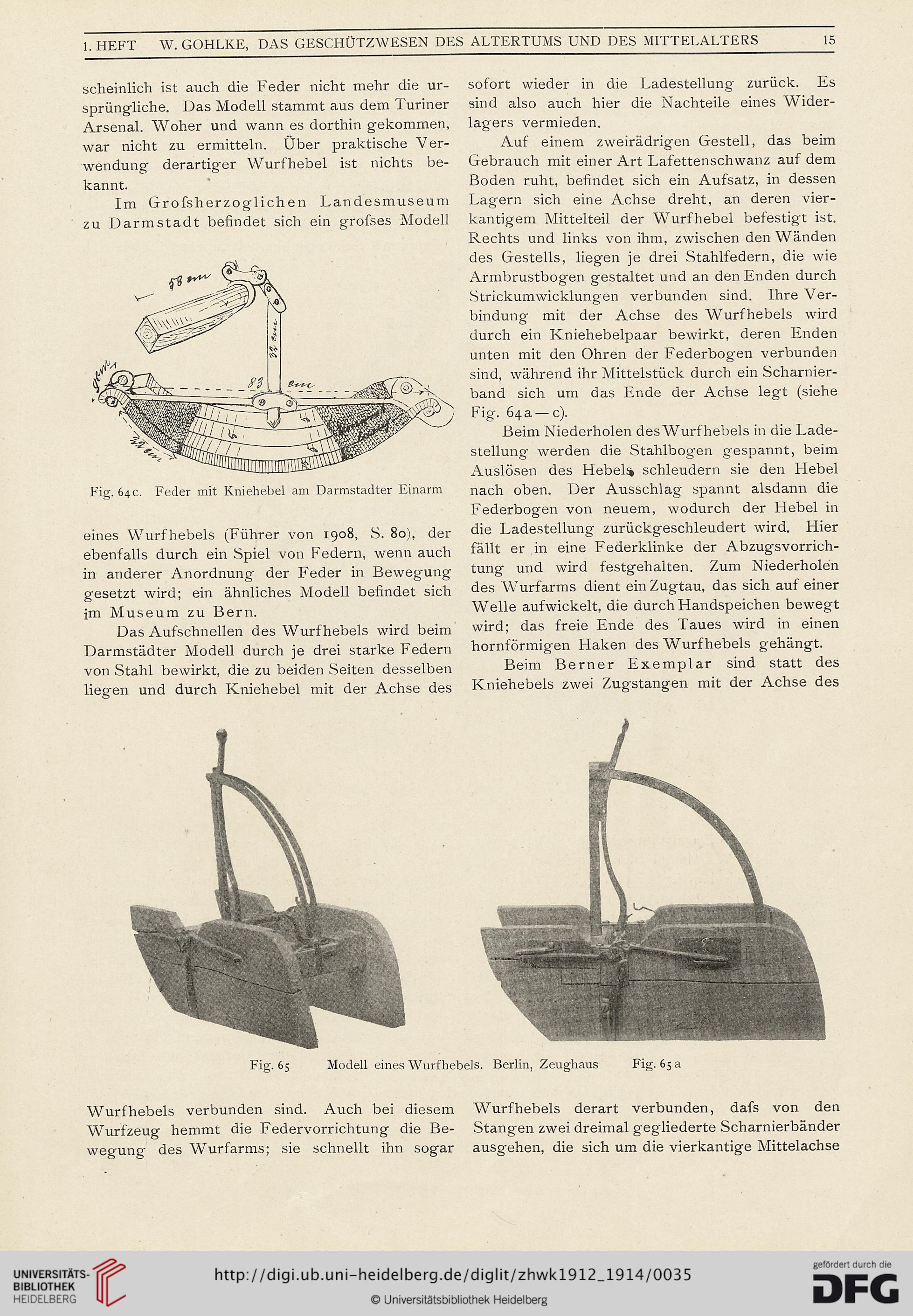1. HEFT W. GOHLKE, DAS GESCHÜTZWESEN DES ALTERTUMS UND DES MITTELALTERS
15
scheinlich ist auch die Feder nicht mehr die ur-
sprüngliche. Das Modell stammt aus dem Turiner
Arsenal. Woher und wann es dorthin gekommen,
war nicht zu ermitteln. Über praktische Ver-
wendung derartiger Wurfhebel ist nichts be-
kannt.
Im Grofsherzoglichen Landesmuseum
zu Darmstadt befindet sich ein grofses Modell
Fig. 64c. Feder mit Kniehebel am Darmstadter Einarm
eines Wurfhebels (Führer von 1908, S. 80), der
ebenfalls durch ein Spiel von Federn, wenn auch
in anderer Anordnung der Feder in Bewegung
gesetzt wird; ein ähnliches Modell befindet sich
im Museum zu Bern.
Das Aufschnellen des Wurfhebels wird beim
Darmstädter Modell durch je drei starke Federn
von Stahl bewirkt, die zu beiden Seiten desselben
liegen und durch Kniehebel mit der Achse des
sofort wieder in die Ladestellung- zurück. Es
sind also auch hier die Nachteile eines Wider-
lagers vermieden.
Auf einem zweirädrigen Gestell, das beim
Gebrauch mit einer Art Lafettenschwanz auf dem
Boden ruht, befindet sich ein Aufsatz, in dessen
Lagern sich eine Achse dreht, an deren vier-
kantigem Mittelteil der Wurfhebel befestigt ist.
Rechts und links von ihm, zwischen den Wänden
des Gestells, liegen je drei Stahlfedern, die wie
Armbrustbogen gestaltet und an den Enden durch
Strickumwicklungen verbunden sind. Ihre Ver-
bindung mit der Achse des Wurfhebels wird
durch ein Kniehebelpaar bewirkt, deren Enden
unten mit den Ohren der Federbogen verbunden
sind, während ihr Mittelstück durch ein Scharnier-
band sich um das Ende der Achse legt (siehe
Fig. 64 a — c).
Beim Niederholen des Wurf hebels in die Lade-
stellung werden die Stahlbogen gespannt, beim
Auslösen des Hebels» schleudern sie den Hebel
nach oben. Der Ausschlag spannt alsdann die
Federbogen von neuem, wodurch der Hebel in
die Ladestellung zurückgeschleudert wird. Hier
fällt er in eine Federklinke der Abzugsvorrich-
tung und wird festgehalten. Zum Niederholen
des Wurfarms dient ein Zugtau, das sich auf einer
Welle aufwickelt, die durch Handspeichen bewegt
wird; das freie Ende des Taues wird in einen
hornförmigen Haken des Wurfhebels gehängt.
Beim Berner Exemplar sind statt des
Kniehebels zwei Zugstangen mit der Achse des
Fig. 65 Modell eines Wurfhebels. Berlin, Zeughaus Fig. 65 a
Wurfhebels verbunden sind. Auch bei diesem Wurfhebels derart verbunden, dafs von den
Wurfzeug hemmt die Federvorrichtung die Be- Stangen zwei dreimal gegliederte Scharnierbänder
wegung des Wurfarms; sie schnellt ihn sogar ausgehen, die sich um die vierkantige Mittelachse
15
scheinlich ist auch die Feder nicht mehr die ur-
sprüngliche. Das Modell stammt aus dem Turiner
Arsenal. Woher und wann es dorthin gekommen,
war nicht zu ermitteln. Über praktische Ver-
wendung derartiger Wurfhebel ist nichts be-
kannt.
Im Grofsherzoglichen Landesmuseum
zu Darmstadt befindet sich ein grofses Modell
Fig. 64c. Feder mit Kniehebel am Darmstadter Einarm
eines Wurfhebels (Führer von 1908, S. 80), der
ebenfalls durch ein Spiel von Federn, wenn auch
in anderer Anordnung der Feder in Bewegung
gesetzt wird; ein ähnliches Modell befindet sich
im Museum zu Bern.
Das Aufschnellen des Wurfhebels wird beim
Darmstädter Modell durch je drei starke Federn
von Stahl bewirkt, die zu beiden Seiten desselben
liegen und durch Kniehebel mit der Achse des
sofort wieder in die Ladestellung- zurück. Es
sind also auch hier die Nachteile eines Wider-
lagers vermieden.
Auf einem zweirädrigen Gestell, das beim
Gebrauch mit einer Art Lafettenschwanz auf dem
Boden ruht, befindet sich ein Aufsatz, in dessen
Lagern sich eine Achse dreht, an deren vier-
kantigem Mittelteil der Wurfhebel befestigt ist.
Rechts und links von ihm, zwischen den Wänden
des Gestells, liegen je drei Stahlfedern, die wie
Armbrustbogen gestaltet und an den Enden durch
Strickumwicklungen verbunden sind. Ihre Ver-
bindung mit der Achse des Wurfhebels wird
durch ein Kniehebelpaar bewirkt, deren Enden
unten mit den Ohren der Federbogen verbunden
sind, während ihr Mittelstück durch ein Scharnier-
band sich um das Ende der Achse legt (siehe
Fig. 64 a — c).
Beim Niederholen des Wurf hebels in die Lade-
stellung werden die Stahlbogen gespannt, beim
Auslösen des Hebels» schleudern sie den Hebel
nach oben. Der Ausschlag spannt alsdann die
Federbogen von neuem, wodurch der Hebel in
die Ladestellung zurückgeschleudert wird. Hier
fällt er in eine Federklinke der Abzugsvorrich-
tung und wird festgehalten. Zum Niederholen
des Wurfarms dient ein Zugtau, das sich auf einer
Welle aufwickelt, die durch Handspeichen bewegt
wird; das freie Ende des Taues wird in einen
hornförmigen Haken des Wurfhebels gehängt.
Beim Berner Exemplar sind statt des
Kniehebels zwei Zugstangen mit der Achse des
Fig. 65 Modell eines Wurfhebels. Berlin, Zeughaus Fig. 65 a
Wurfhebels verbunden sind. Auch bei diesem Wurfhebels derart verbunden, dafs von den
Wurfzeug hemmt die Federvorrichtung die Be- Stangen zwei dreimal gegliederte Scharnierbänder
wegung des Wurfarms; sie schnellt ihn sogar ausgehen, die sich um die vierkantige Mittelachse