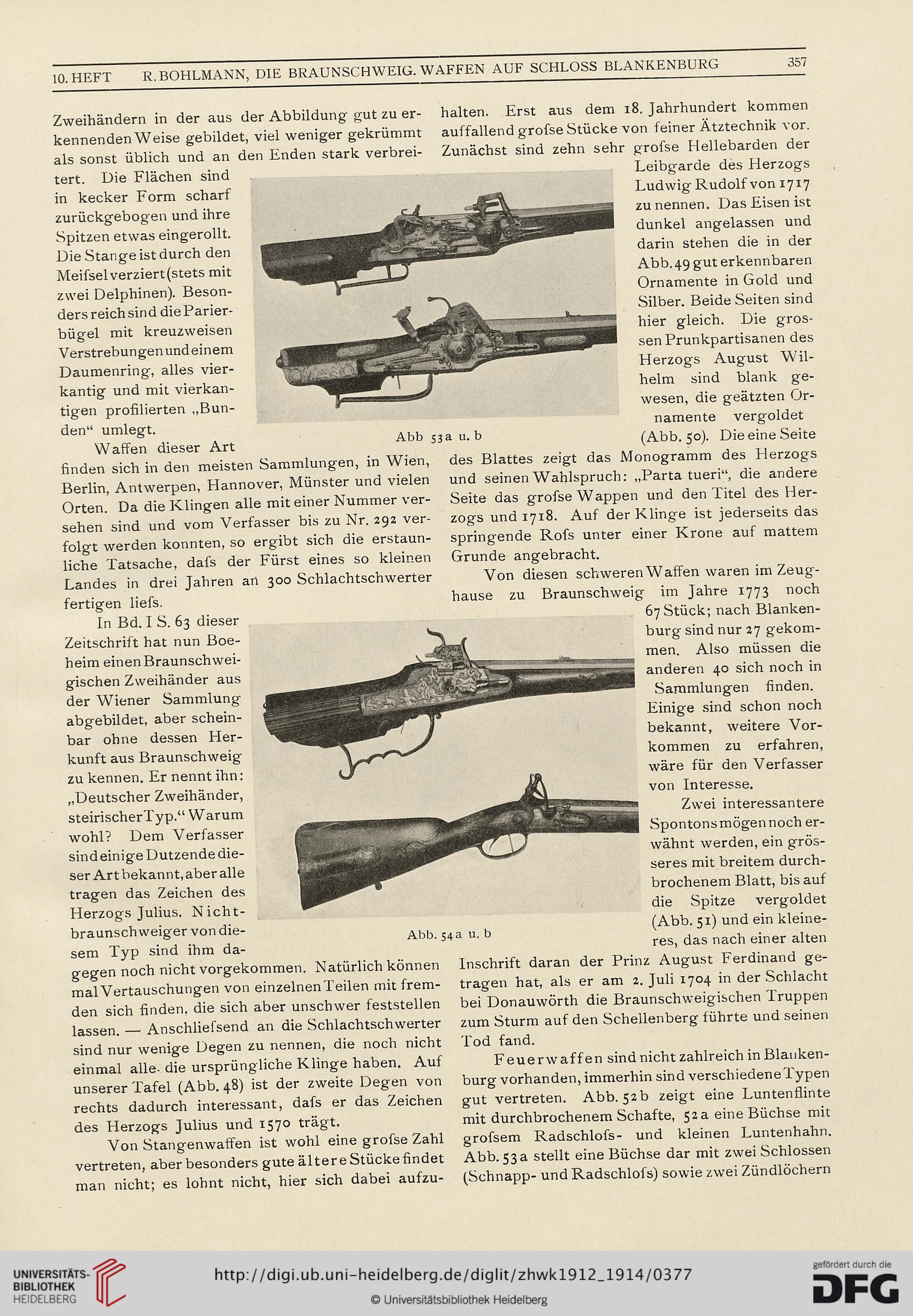10. HEFT
R. BOHLMANN, DIE BRAUNSCHWEIG. WAFFEN AUF SCHLOSS BLANKENBURG
357
Zweihändern in der aus der Abbildung gut zu er-
kennenden Weise gebildet, viel weniger gekrümmt
als sonst üblich und an den Enden stark verbrei-
tert. Die Flächen sind
in kecker Form scharf
zurückgebogen und ihre
Spitzen etwas eingerollt.
Die Stange ist durch den
Meifsel verziert (stets mit
zwei Delphinen). Beson-
ders reich sin d die Parier-
bügel mit kreuzweisen
Verstrebungen und einem
Daumenring, alles vier-
kantig und mit vierkan-
tigen profilierten „Bun-
den“ umlegt.
Waffen dieser Art
finden sich in den meisten Sammlungen, in Wien,
Berlin, Antwerpen, Hannover, Münster und vielen
Orten. Da die Klingen alle mit einer Nummer ver-
sehen sind und vom Verfasser bis zu Nr. 292 ver-
folgt werden konnten, so ergibt sich die erstaun-
liche Tatsache, dafs der Fürst eines so kleinen
Landes in drei Jahren an 300 Schlachtschwerter
fertigen liefs.
In Bd. I S. 63 dieser
Zeitschrift hat nun Boe-
heim einen Braunschwei-
gischen Zweihänder aus
der Wiener Sammlung
abgebildet, aber schein-
bar ohne dessen Her-
kunft aus Braunschweig
zu kennen. Er nennt ihn:
„Deutscher Zweihänder,
steirischerTyp.“ Warum
wohl? Dem Verfasser
sind einige Dutzende die-
ser Art bekannt, aber alle
tragen das Zeichen des
Herzogs Julius. Nicht-
braunschweiger von die-
sem Typ sind ihm da-
gegen noch nicht vorgekommen. Natürlich können
malVertauschungen von einzelnen Teilen mit frem-
den sich finden, die sich aber unschwer feststellen
lassen. — Anschliefsend an die Schlachtschwerter
sind nur wenige Degen zu nennen, die noch nicht
einmal alle- die ursprüngliche Klinge haben. Auf
unserer Tafel (Abb. 48) ist der zweite Degen von
rechts dadurch interessant, dafs er das Zeichen
des Herzogs Julius und 1570 trägt.
Von Stangenwaffen ist wohl eine grofse Zahl
vertreten, aber besonders gute ältere Stücke findet
man nicht; es lohnt nicht, hier sich dabei aufzu-
halten. Erst aus dem 18. Jahrhundert kommen
auffallend grofse Stücke von feiner Ätztechnik vor.
Zunächst sind zehn sehr grofse Hellebarden der
Leibgarde des Herzogs
Ludwig Rudolf von 1717
zu nennen. Das Eisen ist
dunkel angelassen und
darin stehen die in der
Abb. 49 gut erkennbaren
Ornamente in Gold und
Silber. Beide Seiten sind
hier gleich. Die gros-
sen Prunkpartisanen des
Herzogs August Wil-
helm sind blank ge-
wesen, die geätzten Or-
namente vergoldet
(Abb. 50). Die eine Seite
des Blattes zeigt das Monogramm des Herzogs
und seinen Wahlspruch: „Parta tueri“, die andere
Seite das grofse Wappen und den Titel des Her-
zogs und 1718. Auf der Klinge ist jederseits das
springende Rofs unter einer Krone auf mattem
Grunde angebracht.
Von diesen schweren Waffen waren im Zeug-
hause zu Braunschweig im Jahre 1773 noch
67 Stück; nach Blanken-
burg sind nur 27 gekom-
men. Also müssen die
anderen 40 sich noch in
Sammlungen finden.
Einige sind schon noch
bekannt, weitere Vor-
kommen zu erfahren,
wäre für den Verfasser
von Interesse.
Zwei interessantere
Spontons mögen noch er-
wähnt werden, ein grös-
seres mit breitem durch-
brochenem Blatt, bis auf
die Spitze vergoldet
(Abb. 51) und ein kleine-
res, das nach einer alten
Inschrift daran der Prinz August Ferdinand ge-
tragen hat, als er am 2. Juli 1704 in der Schlacht
bei Donauwörth die Braunschweigischen Truppen
zum Sturm auf den Schellenberg führte und seinen
Tod fand.
Feuerwaffen sind nicht zahlreich in Blanken-
burg vorhanden, immerhin sind verschiedeneTypen
gut vertreten. Abb. 52b zeigt eine Luntenflinte
mit durchbrochenem Schafte, 52 a eine Büchse mit
grofsem Radschlofs- und kleinen Luntenhahn.
Abb. 53 a stellt eine Büchse dar mit zwei Schlossen
(Schnapp- und Radschlofs) sowie zwei Zündlöchern
Abb 53 a u. b
Abb. 54a u. b
R. BOHLMANN, DIE BRAUNSCHWEIG. WAFFEN AUF SCHLOSS BLANKENBURG
357
Zweihändern in der aus der Abbildung gut zu er-
kennenden Weise gebildet, viel weniger gekrümmt
als sonst üblich und an den Enden stark verbrei-
tert. Die Flächen sind
in kecker Form scharf
zurückgebogen und ihre
Spitzen etwas eingerollt.
Die Stange ist durch den
Meifsel verziert (stets mit
zwei Delphinen). Beson-
ders reich sin d die Parier-
bügel mit kreuzweisen
Verstrebungen und einem
Daumenring, alles vier-
kantig und mit vierkan-
tigen profilierten „Bun-
den“ umlegt.
Waffen dieser Art
finden sich in den meisten Sammlungen, in Wien,
Berlin, Antwerpen, Hannover, Münster und vielen
Orten. Da die Klingen alle mit einer Nummer ver-
sehen sind und vom Verfasser bis zu Nr. 292 ver-
folgt werden konnten, so ergibt sich die erstaun-
liche Tatsache, dafs der Fürst eines so kleinen
Landes in drei Jahren an 300 Schlachtschwerter
fertigen liefs.
In Bd. I S. 63 dieser
Zeitschrift hat nun Boe-
heim einen Braunschwei-
gischen Zweihänder aus
der Wiener Sammlung
abgebildet, aber schein-
bar ohne dessen Her-
kunft aus Braunschweig
zu kennen. Er nennt ihn:
„Deutscher Zweihänder,
steirischerTyp.“ Warum
wohl? Dem Verfasser
sind einige Dutzende die-
ser Art bekannt, aber alle
tragen das Zeichen des
Herzogs Julius. Nicht-
braunschweiger von die-
sem Typ sind ihm da-
gegen noch nicht vorgekommen. Natürlich können
malVertauschungen von einzelnen Teilen mit frem-
den sich finden, die sich aber unschwer feststellen
lassen. — Anschliefsend an die Schlachtschwerter
sind nur wenige Degen zu nennen, die noch nicht
einmal alle- die ursprüngliche Klinge haben. Auf
unserer Tafel (Abb. 48) ist der zweite Degen von
rechts dadurch interessant, dafs er das Zeichen
des Herzogs Julius und 1570 trägt.
Von Stangenwaffen ist wohl eine grofse Zahl
vertreten, aber besonders gute ältere Stücke findet
man nicht; es lohnt nicht, hier sich dabei aufzu-
halten. Erst aus dem 18. Jahrhundert kommen
auffallend grofse Stücke von feiner Ätztechnik vor.
Zunächst sind zehn sehr grofse Hellebarden der
Leibgarde des Herzogs
Ludwig Rudolf von 1717
zu nennen. Das Eisen ist
dunkel angelassen und
darin stehen die in der
Abb. 49 gut erkennbaren
Ornamente in Gold und
Silber. Beide Seiten sind
hier gleich. Die gros-
sen Prunkpartisanen des
Herzogs August Wil-
helm sind blank ge-
wesen, die geätzten Or-
namente vergoldet
(Abb. 50). Die eine Seite
des Blattes zeigt das Monogramm des Herzogs
und seinen Wahlspruch: „Parta tueri“, die andere
Seite das grofse Wappen und den Titel des Her-
zogs und 1718. Auf der Klinge ist jederseits das
springende Rofs unter einer Krone auf mattem
Grunde angebracht.
Von diesen schweren Waffen waren im Zeug-
hause zu Braunschweig im Jahre 1773 noch
67 Stück; nach Blanken-
burg sind nur 27 gekom-
men. Also müssen die
anderen 40 sich noch in
Sammlungen finden.
Einige sind schon noch
bekannt, weitere Vor-
kommen zu erfahren,
wäre für den Verfasser
von Interesse.
Zwei interessantere
Spontons mögen noch er-
wähnt werden, ein grös-
seres mit breitem durch-
brochenem Blatt, bis auf
die Spitze vergoldet
(Abb. 51) und ein kleine-
res, das nach einer alten
Inschrift daran der Prinz August Ferdinand ge-
tragen hat, als er am 2. Juli 1704 in der Schlacht
bei Donauwörth die Braunschweigischen Truppen
zum Sturm auf den Schellenberg führte und seinen
Tod fand.
Feuerwaffen sind nicht zahlreich in Blanken-
burg vorhanden, immerhin sind verschiedeneTypen
gut vertreten. Abb. 52b zeigt eine Luntenflinte
mit durchbrochenem Schafte, 52 a eine Büchse mit
grofsem Radschlofs- und kleinen Luntenhahn.
Abb. 53 a stellt eine Büchse dar mit zwei Schlossen
(Schnapp- und Radschlofs) sowie zwei Zündlöchern
Abb 53 a u. b
Abb. 54a u. b