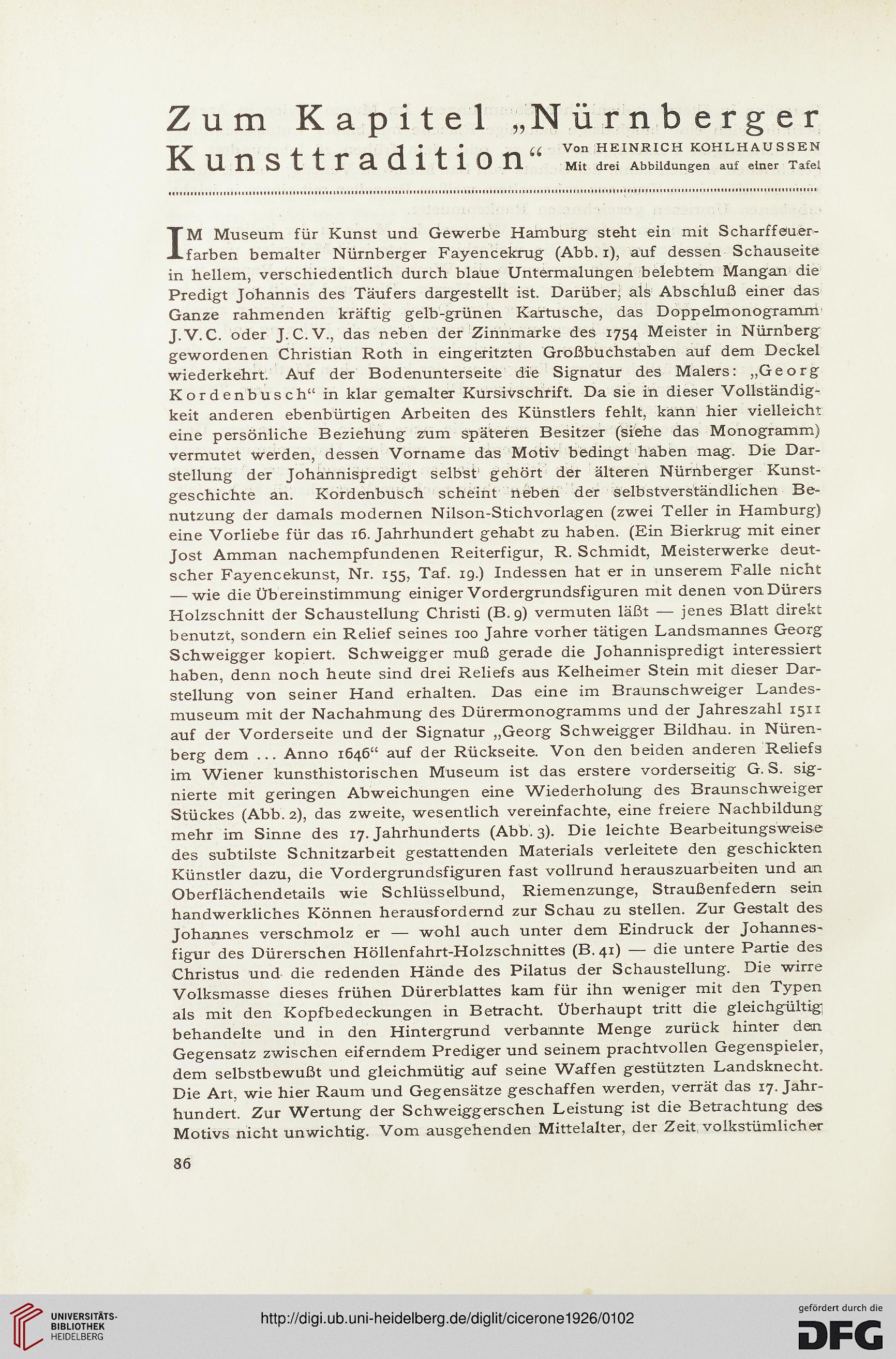z
K
um Kapitel „
unsttradition
Nür n b er g e r
U Von HEINRICH KOHLHAUSSEN
Mit drei Abbildungen auf einer Tafel
IM Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg steht ein mit Scharffeuer-
farben bemalter Nürnberger Fayencekrug (Abb. i), auf dessen Schauseite
in hellem, verschiedentlich durch blaue Untermalungen belebtem Mangan die
Predigt Johannis des Täufers dargestellt ist. Darüber; als Abschluß einer das
Ganze rahmenden kräftig gelb-grünen Kartusche, das Doppelmonogramm
J.V. C. oder J. C.V., das neben der Zinnmarke des 1754 Meister in Nürnberg
gewordenen Christian Roth in eingeritzten Großbuchstaben auf dem Deckel
wiederkehrt. Auf der Bodenunterseite die Signatur des Malers: „Georg
K ordenbusch“ in klar gemalter Kursivschrift. Da sie in dieser Vollständig-
keit anderen ebenbürtigen Arbeiten des Künstlers fehlt, kann hier vielleicht
eine persönliche Beziehung zum späteren Besitzer (siehe das Monogramm)
vermutet werden, dessen Vorname das Motiv bedingt haben mag. Die Dar-
stellung der Johannispredigt selbst’ gehört der älteren Nürnberger Kunst-
geschichte an. Kordenbusch scheint neben der Selbstverständlichen Be-
nutzung der damals modernen Nilson-Stichvorlagen (zwei Teller in Hamburg)
eine Vorliebe für das 16. Jahrhundert gehabt zu haben. (Ein Bierkrug mit einer
Jost Amman nachempfundenen Reiterfigur, R. Schmidt, Meisterwerke deut-
scher Fayencekunst, Nr. 155, Taf. 19.) Indessen hat er in unserem Falle nicht
— wie die Übereinstimmung einiger Vordergrundsfiguren mit denen von Dürers
Holzschnitt der Schaustellung Christi (B. g) vermuten läßt — jenes Blatt direkt
benutzt, sondern ein Relief seines 100 Jahre vorher tätigen Landsmannes Georg
Schweigger kopiert. Schweigger muß gerade die Johannispredigt interessiert
haben, denn noch heute sind drei Reliefs aus Kelheimer Stein mit dieser Dar-
stellung von seiner Hand erhalten. Das eine im Braunschweiger Landes-
museum mit der Nachahmung des Dürermonogramms und der Jahreszahl 1511
auf der Vorderseite und der Signatur „Georg Schweigger Bildhau. in Nüren-
berg dem ... Anno 1646“ auf der Rückseite. Von den beiden anderen Reliefs
im Wiener kunsthistorischen Museum ist das erstere vorderseitig G. S. sig-
nierte mit geringen Abweichungen eine Wiederholung des Braunschweiger
Stückes (Abb. 2), das zweite, wesentlich vereinfachte, eine freiere Nachbildung
mehr im Sinne des 17. Jahrhunderts (Abb. 3). Die leichte Bearbeitungsweise'
des subtilste Schnitzarbeit gestattenden Materials verleitete den geschickten
Künstler dazu, die Vordergrundsfiguren fast vollrund herauszuarbeiten und an
Oberflächendetails wie Schlüsselbund, Riemenzunge, Straußenfedern sein
handwerkliches Können herausfordernd zur Schau zu stellen. Zur Gestalt des
Johannes verschmolz er — wohl auch unter dem Eindruck der Johannes-
figur des Dürerschen Höllenfahrt-Holzschnittes (B. 41) — die untere Partie des
Christus Und die redenden Hände des Pilatus der Schaustellung. Die wirre
Volksmasse dieses frühen Dürerblattes kam für ihn weniger mit den Typen
als mit den Kopfbedeckungen in Betracht. Überhaupt tritt die gleichgültig
behandelte und in den Hintergrund verbannte Menge zurück hinter deoi
Gegensatz zwischen eiferndem Prediger und seinem prachtvollen Gegenspieler,
dem selbstbewußt und gleichmütig auf seine Waffen gestützten Landsknecht.
Die Art, wie hier Raum und Gegensätze geschaffen werden, verrät das 17. Jahr-
hundert. Zur Wertung der Schweiggerschen Leistung ist die Betrachtung des
Motivs nicht unwichtig. Vom ausgehenden Mittelalter, der Zeit, volkstümlicher
86
K
um Kapitel „
unsttradition
Nür n b er g e r
U Von HEINRICH KOHLHAUSSEN
Mit drei Abbildungen auf einer Tafel
IM Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg steht ein mit Scharffeuer-
farben bemalter Nürnberger Fayencekrug (Abb. i), auf dessen Schauseite
in hellem, verschiedentlich durch blaue Untermalungen belebtem Mangan die
Predigt Johannis des Täufers dargestellt ist. Darüber; als Abschluß einer das
Ganze rahmenden kräftig gelb-grünen Kartusche, das Doppelmonogramm
J.V. C. oder J. C.V., das neben der Zinnmarke des 1754 Meister in Nürnberg
gewordenen Christian Roth in eingeritzten Großbuchstaben auf dem Deckel
wiederkehrt. Auf der Bodenunterseite die Signatur des Malers: „Georg
K ordenbusch“ in klar gemalter Kursivschrift. Da sie in dieser Vollständig-
keit anderen ebenbürtigen Arbeiten des Künstlers fehlt, kann hier vielleicht
eine persönliche Beziehung zum späteren Besitzer (siehe das Monogramm)
vermutet werden, dessen Vorname das Motiv bedingt haben mag. Die Dar-
stellung der Johannispredigt selbst’ gehört der älteren Nürnberger Kunst-
geschichte an. Kordenbusch scheint neben der Selbstverständlichen Be-
nutzung der damals modernen Nilson-Stichvorlagen (zwei Teller in Hamburg)
eine Vorliebe für das 16. Jahrhundert gehabt zu haben. (Ein Bierkrug mit einer
Jost Amman nachempfundenen Reiterfigur, R. Schmidt, Meisterwerke deut-
scher Fayencekunst, Nr. 155, Taf. 19.) Indessen hat er in unserem Falle nicht
— wie die Übereinstimmung einiger Vordergrundsfiguren mit denen von Dürers
Holzschnitt der Schaustellung Christi (B. g) vermuten läßt — jenes Blatt direkt
benutzt, sondern ein Relief seines 100 Jahre vorher tätigen Landsmannes Georg
Schweigger kopiert. Schweigger muß gerade die Johannispredigt interessiert
haben, denn noch heute sind drei Reliefs aus Kelheimer Stein mit dieser Dar-
stellung von seiner Hand erhalten. Das eine im Braunschweiger Landes-
museum mit der Nachahmung des Dürermonogramms und der Jahreszahl 1511
auf der Vorderseite und der Signatur „Georg Schweigger Bildhau. in Nüren-
berg dem ... Anno 1646“ auf der Rückseite. Von den beiden anderen Reliefs
im Wiener kunsthistorischen Museum ist das erstere vorderseitig G. S. sig-
nierte mit geringen Abweichungen eine Wiederholung des Braunschweiger
Stückes (Abb. 2), das zweite, wesentlich vereinfachte, eine freiere Nachbildung
mehr im Sinne des 17. Jahrhunderts (Abb. 3). Die leichte Bearbeitungsweise'
des subtilste Schnitzarbeit gestattenden Materials verleitete den geschickten
Künstler dazu, die Vordergrundsfiguren fast vollrund herauszuarbeiten und an
Oberflächendetails wie Schlüsselbund, Riemenzunge, Straußenfedern sein
handwerkliches Können herausfordernd zur Schau zu stellen. Zur Gestalt des
Johannes verschmolz er — wohl auch unter dem Eindruck der Johannes-
figur des Dürerschen Höllenfahrt-Holzschnittes (B. 41) — die untere Partie des
Christus Und die redenden Hände des Pilatus der Schaustellung. Die wirre
Volksmasse dieses frühen Dürerblattes kam für ihn weniger mit den Typen
als mit den Kopfbedeckungen in Betracht. Überhaupt tritt die gleichgültig
behandelte und in den Hintergrund verbannte Menge zurück hinter deoi
Gegensatz zwischen eiferndem Prediger und seinem prachtvollen Gegenspieler,
dem selbstbewußt und gleichmütig auf seine Waffen gestützten Landsknecht.
Die Art, wie hier Raum und Gegensätze geschaffen werden, verrät das 17. Jahr-
hundert. Zur Wertung der Schweiggerschen Leistung ist die Betrachtung des
Motivs nicht unwichtig. Vom ausgehenden Mittelalter, der Zeit, volkstümlicher
86