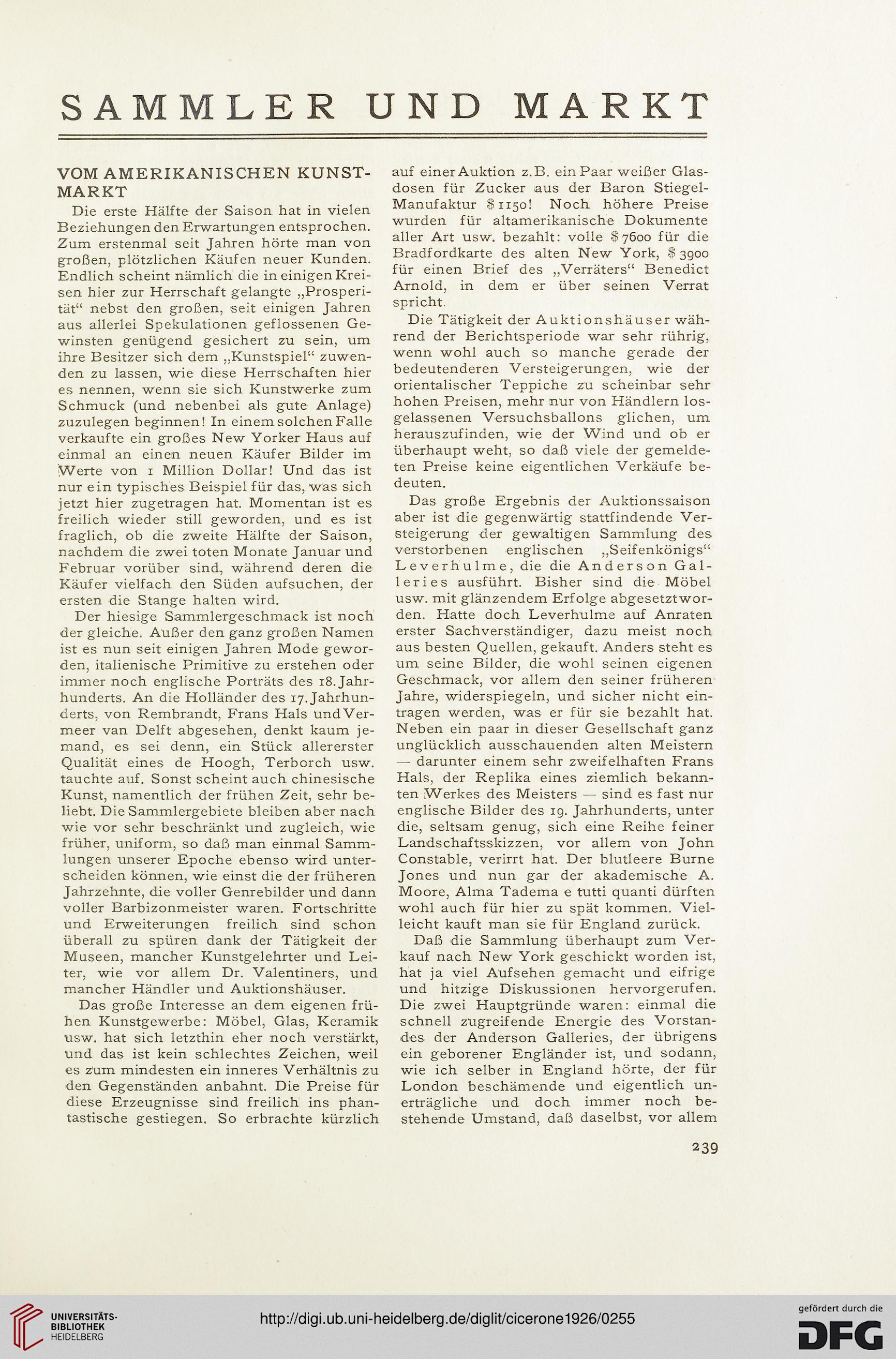SAMMLER UND MARKT
VOM AMERIKANISCHEN KUNST-
MARKT
Die erste Hälfte der Saison hat in vielen
Beziehungen den Erwartungen entsprochen.
Zum erstenmal seit Jahren hörte man von
großen, plötzlichen Käufen neuer Kunden.
Endlich scheint nämlich die in einigen Krei-
sen hier zur Herrschaft gelangte „Prosperi-
tät“ nebst den großen, seit einigen Jahren
aus allerlei Spekulationen geflossenen Ge-
winsten genügend gesichert zu sein, um
ihre Besitzer sich dem „Kunstspiel“ zuwen-
den zu lassen, wie diese Herrschaften hier
es nennen, wenn sie sich Kunstwerke zum
Schmuck (und nebenbei als gute Anlage)
zuzulegen beginnen! In einem solchen Falle
verkaufte ein großes New Yorker Haus auf
einmal an einen neuen Käufer Bilder im
Werte von i Million Dollar! Und das ist
nur ein typisches Beispiel für das, was sich
jetzt hier zugetragen hat. Momentan ist es
freilich wieder still geworden, und es ist
fraglich, ob die zweite Hälfte der Saison,
nachdem die zwei toten Monate Januar und
Februar vorüber sind, während deren die
Käufer vielfach den Süden aufsuchen, der
ersten die Stange halten wird.
Der hiesige Sammlergeschmack ist noch
der gleiche. Aüßer den ganz großen Namen
ist es nun seit einigen Jahren Mode gewor-
den, italienische Primitive zu erstehen oder
immer noch englische Porträts des 18. Jahr-
hunderts. An die Holländer des 17. Jahrhun-
derts, von Rembrandt, Frans Hals und Ver-
meer van Delft abgesehen, denkt kaum je-
mand, es sei denn, ein Stück allererster
Qualität eines de Hoogh, Terborch usw.
tauchte auf. Sonst scheint auch chinesische
Kunst, namentlich der frühen Zeit, sehr be-
liebt. Die Sammlergebiete bleiben aber nach
wie vor sehr beschränkt und zugleich, wie
früher, uniform, so daß man einmal Samm-
lungen unserer Epoche ebenso wird unter-
scheiden können, wie einst die der früheren
Jahrzehnte, die voller Genrebilder und dann
voller Barbizonmeister waren. Fortschritte
und Erweiterungen freilich sind schon
überall zu spüren dank der Tätigkeit der
Museen, mancher Kunstgelehrter und Lei-
ter, wie vor allem Dr. Valentiners, und
mancher Händler und Auktionshäuser.
Das große Interesse an dem eigenen frü-
hen Kunstgewerbe: Möbel, Glas, Keramik
usw. hat sich letzthin eher noch verstärkt,
und das ist kein schlechtes Zeichen, weil
es zum mindesten ein inneres Verhältnis zu
den Gegenständen anbahnt. Die Preise für
diese Erzeugnisse sind freilich ins phan-
tastische gestiegen. So erbrachte kürzlich
auf einer Auktion z.B. ein Paar weißer Glas-
dosen für Zucker aus der Baron Stiegel-
Manufaktur $1150! Noch höhere Preise
wurden für altamerikanische Dokumente
aller Art usw. bezahlt: volle $7600 für die
Bradfordkarte des alten New York, $3900
für einen Brief des „Verräters“ Benedict
Arnold, in dem er über seinen Verrat
spricht.
Die Tätigkeit der Auktionshäuser wäh-
rend der Berichtsperiode war sehr rührig,
wenn wohl auch so manche gerade der
bedeutenderen Versteigerungen, wie der
orientalischer Teppiche zu scheinbar sehr
hohen Preisen, mehr nur von Händlern los-
gelassenen Versuchsballons glichen, um
herauszufinden, wie der Wind und ob er
überhaupt weht, so daß viele der gemelde-
ten Preise keine eigentlichen Verkäufe be-
deuten.
Das große Ergebnis der Auktionssaison
aber ist die gegenwärtig stattfindende Ver-
steigerung der gewaltigen Sammlung des
verstorbenen englischen „Seifenkönigs“
Lever hui me, die die Anderson Gal-
leries ausführt. Bisher sind die Möbel
usw. mit glänzendem Erfolge abgesetztwor-
den. Hatte doch Leverhulme auf Anraten
erster Sachverständiger, dazu meist noch
aus besten Quellen, gekauft. Anders steht es
um seine Bilder, die wohl seinen eigenen
Geschmack, vor allem den seiner früheren-
Jahre, widerspiegeln, und sicher nicht ein-
tragen werden, was er für sie bezahlt hat.
Neben ein paar in dieser Gesellschaft ganz
unglücklich ausschauenden alten Meistern
— darunter einem sehr zweifelhaften Frans
Hals, der Replika eines ziemlich bekann-
ten Werkes des Meisters — sind es fast nur
englische Bilder des 19. Jahrhunderts, unter
die, seltsam genug, sich eine Reihe feiner
Landschaftsskizzen, vor allem von John
Constable, verirrt hat. Der blutleere Burne
Jones und nun gar der akademische A.
Moore, Alma Tadema e tutti quanti dürften
wohl auch für hier zu spät kommen. Viel-
leicht kauft man sie für England zurück.
Daß die Sammlung überhaupt zum Ver-
kauf nach New York geschickt worden ist,
hat ja viel Aüfsehen gemacht und eifrige
und hitzige Diskussionen hervorgerufen.
Die zwei Hauptgründe waren: einmal die
schnell zugreifende Energie des Vorstan-
des der Anderson Galleries, der übrigens
ein geborener Engländer ist, und sodann,
wie ich selber in England hörte, der für
London beschämende und eigentlich un-
erträgliche und doch immer noch be-
stehende Umstand, daß daselbst, vor allem
239
VOM AMERIKANISCHEN KUNST-
MARKT
Die erste Hälfte der Saison hat in vielen
Beziehungen den Erwartungen entsprochen.
Zum erstenmal seit Jahren hörte man von
großen, plötzlichen Käufen neuer Kunden.
Endlich scheint nämlich die in einigen Krei-
sen hier zur Herrschaft gelangte „Prosperi-
tät“ nebst den großen, seit einigen Jahren
aus allerlei Spekulationen geflossenen Ge-
winsten genügend gesichert zu sein, um
ihre Besitzer sich dem „Kunstspiel“ zuwen-
den zu lassen, wie diese Herrschaften hier
es nennen, wenn sie sich Kunstwerke zum
Schmuck (und nebenbei als gute Anlage)
zuzulegen beginnen! In einem solchen Falle
verkaufte ein großes New Yorker Haus auf
einmal an einen neuen Käufer Bilder im
Werte von i Million Dollar! Und das ist
nur ein typisches Beispiel für das, was sich
jetzt hier zugetragen hat. Momentan ist es
freilich wieder still geworden, und es ist
fraglich, ob die zweite Hälfte der Saison,
nachdem die zwei toten Monate Januar und
Februar vorüber sind, während deren die
Käufer vielfach den Süden aufsuchen, der
ersten die Stange halten wird.
Der hiesige Sammlergeschmack ist noch
der gleiche. Aüßer den ganz großen Namen
ist es nun seit einigen Jahren Mode gewor-
den, italienische Primitive zu erstehen oder
immer noch englische Porträts des 18. Jahr-
hunderts. An die Holländer des 17. Jahrhun-
derts, von Rembrandt, Frans Hals und Ver-
meer van Delft abgesehen, denkt kaum je-
mand, es sei denn, ein Stück allererster
Qualität eines de Hoogh, Terborch usw.
tauchte auf. Sonst scheint auch chinesische
Kunst, namentlich der frühen Zeit, sehr be-
liebt. Die Sammlergebiete bleiben aber nach
wie vor sehr beschränkt und zugleich, wie
früher, uniform, so daß man einmal Samm-
lungen unserer Epoche ebenso wird unter-
scheiden können, wie einst die der früheren
Jahrzehnte, die voller Genrebilder und dann
voller Barbizonmeister waren. Fortschritte
und Erweiterungen freilich sind schon
überall zu spüren dank der Tätigkeit der
Museen, mancher Kunstgelehrter und Lei-
ter, wie vor allem Dr. Valentiners, und
mancher Händler und Auktionshäuser.
Das große Interesse an dem eigenen frü-
hen Kunstgewerbe: Möbel, Glas, Keramik
usw. hat sich letzthin eher noch verstärkt,
und das ist kein schlechtes Zeichen, weil
es zum mindesten ein inneres Verhältnis zu
den Gegenständen anbahnt. Die Preise für
diese Erzeugnisse sind freilich ins phan-
tastische gestiegen. So erbrachte kürzlich
auf einer Auktion z.B. ein Paar weißer Glas-
dosen für Zucker aus der Baron Stiegel-
Manufaktur $1150! Noch höhere Preise
wurden für altamerikanische Dokumente
aller Art usw. bezahlt: volle $7600 für die
Bradfordkarte des alten New York, $3900
für einen Brief des „Verräters“ Benedict
Arnold, in dem er über seinen Verrat
spricht.
Die Tätigkeit der Auktionshäuser wäh-
rend der Berichtsperiode war sehr rührig,
wenn wohl auch so manche gerade der
bedeutenderen Versteigerungen, wie der
orientalischer Teppiche zu scheinbar sehr
hohen Preisen, mehr nur von Händlern los-
gelassenen Versuchsballons glichen, um
herauszufinden, wie der Wind und ob er
überhaupt weht, so daß viele der gemelde-
ten Preise keine eigentlichen Verkäufe be-
deuten.
Das große Ergebnis der Auktionssaison
aber ist die gegenwärtig stattfindende Ver-
steigerung der gewaltigen Sammlung des
verstorbenen englischen „Seifenkönigs“
Lever hui me, die die Anderson Gal-
leries ausführt. Bisher sind die Möbel
usw. mit glänzendem Erfolge abgesetztwor-
den. Hatte doch Leverhulme auf Anraten
erster Sachverständiger, dazu meist noch
aus besten Quellen, gekauft. Anders steht es
um seine Bilder, die wohl seinen eigenen
Geschmack, vor allem den seiner früheren-
Jahre, widerspiegeln, und sicher nicht ein-
tragen werden, was er für sie bezahlt hat.
Neben ein paar in dieser Gesellschaft ganz
unglücklich ausschauenden alten Meistern
— darunter einem sehr zweifelhaften Frans
Hals, der Replika eines ziemlich bekann-
ten Werkes des Meisters — sind es fast nur
englische Bilder des 19. Jahrhunderts, unter
die, seltsam genug, sich eine Reihe feiner
Landschaftsskizzen, vor allem von John
Constable, verirrt hat. Der blutleere Burne
Jones und nun gar der akademische A.
Moore, Alma Tadema e tutti quanti dürften
wohl auch für hier zu spät kommen. Viel-
leicht kauft man sie für England zurück.
Daß die Sammlung überhaupt zum Ver-
kauf nach New York geschickt worden ist,
hat ja viel Aüfsehen gemacht und eifrige
und hitzige Diskussionen hervorgerufen.
Die zwei Hauptgründe waren: einmal die
schnell zugreifende Energie des Vorstan-
des der Anderson Galleries, der übrigens
ein geborener Engländer ist, und sodann,
wie ich selber in England hörte, der für
London beschämende und eigentlich un-
erträgliche und doch immer noch be-
stehende Umstand, daß daselbst, vor allem
239