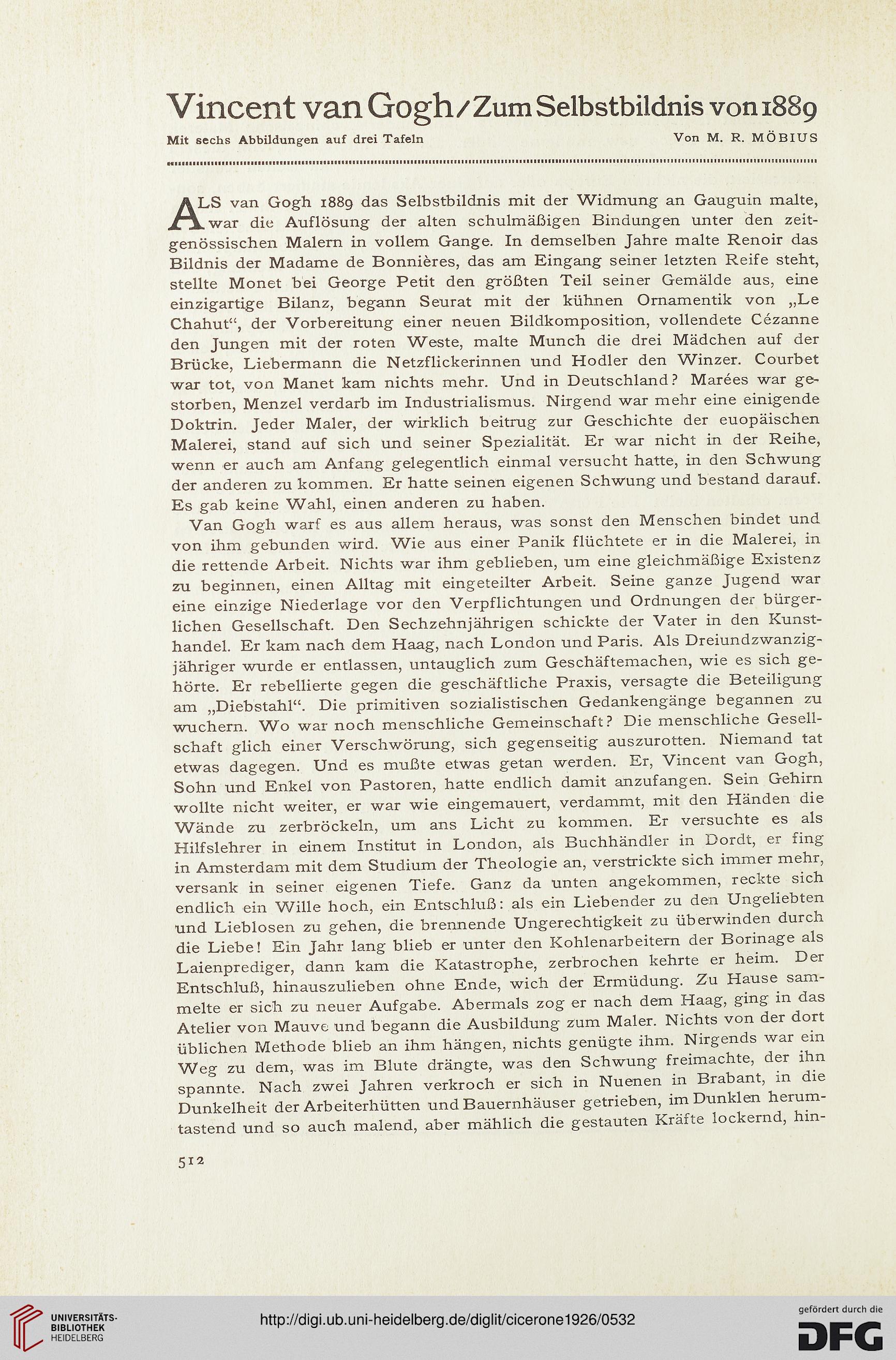Vincent van Gogh/Zum Selbstbildnis von 1889
Mit sechs Abbildungen auf drei Tafeln Von M. R. MÖBIUS
ALS van Gogh 1889 das Selbstbildnis mit der Widmung an Gauguin malte,
Awar die Auflösung der alten schulmäßigen Bindungen Unter den zeit-
genössischen Malern in vollem Gange. In demselben Jahre malte Renoir das
Bildnis der Madame de Bonnieres, das am Eingang seiner letzten Reife steht,
stellte Monet bei George Petit den größten Teil seiner Gemälde aus, eine
einzigartige Bilanz, begann Seurat mit der kühnen Ornamentik von „Le
Chahut“, der Vorbereitung einer neuen Bildkomposition, vollendete Cezanne
den Jungen mit der roten Weste, malte Munch die drei Mädchen auf der
Brücke, Liebermann die Netzflickerinnen und Hodler den Winzer. Courbet
war tot, von Manet kam nichts mehr. Und in Deutschland? Marees war ge-
storben, Menzel verdarb im Industrialismus. Nirgend war mehr eine einigende
Doktrin. Jeder Maler, der wirklich beitrug zur Geschichte der euopäischen
Malerei, stand auf sich und seiner Spezialität. Er war nicht in der Reihe,
wenn er auch am Anfang gelegentlich einmal versucht hatte, in den Schwung
der anderen zu kommen. Er hatte seinen eigenen Schwung und bestand darauf.
Es gab keine Wahl, einen anderen zu haben.
Van Gogh warf es aus allem heraus, was sonst den Menschen bindet und
von ihm gebunden wird. Wie aus einer Panik flüchtete er in die Malerei, in
die rettende Arbeit. Nichts war ihm geblieben, um eine gleichmäßige Existenz
zu beginnen, einen Alltag mit eingeteilter Arbeit. Seine ganze Jugend war
eine einzige Niederlage vor den Verpflichtungen und Ordnungen der bürger-
lichen Gesellschaft. Den Sechzehnjährigen schickte der Vater in den Kunst-
handel. Er kam nach dem Haag, nach London und Paris. Als Dreiundzwanzig-
jähriger wurde er entlassen, untauglich zum Geschäftemachen, wie es sich ge-
hörte. Er rebellierte gegen die geschäftliche Praxis, versagte die Beteiligung
am „Diebstahl“. Die primitiven sozialistischen Gedankengänge begannen zu
wuchern. Wo war noch menschliche Gemeinschaft? Die menschliche Gesell-
schaft glich einer Verschwörung, sich gegenseitig auszurotten. Niemand tat
etwas dagegen. Und es mußte etwas getan werden. Er, Vincent van Gogh,
Sohn und Enkel von Pastoren, hatte endlich damit anzufangen. Sein Gehirn
wollte nicht weiter, er war wie eingemauert, verdammt, mit den Händen die
Wände zu zerbröckeln, um ans Licht zu kommen. Er versuchte es als
Hilfslehrer in einem Institut in London, als Buchhändler in Dordt, er fing
in Amsterdam mit dem Studium der Theologie an, verstrickte sich immer mehr,
versank in seiner eigenen Tiefe. Ganz da unten angekommen, reckte sich
endlich ein Wille hoch, ein Entschluß: als ein Liebender zu den Ungeliebten
und Lieblosen zu gehen, die brennende Ungerechtigkeit zu überwinden durch
die Liebe! Ein Jahr lang blieb er unter den Kohlenarbeitern der Borinage als
Laienprediger, dann kam die Katastrophe, zerbrochen kehrte er heim. Der
Entschluß, hinauszulieben ohne Ende, wich der Ermüdung. Zu Hause sam-
melte er sich zu neuer Aufgabe. Abermals zog er nach dem Haag, ging in das
Atelier von Mauve und begann die Ausbildung zum Maler. Nichts von der dort
üblichen Methode blieb an ihm hängen, nichts genügte ihm. Nirgends war ein
Weg zu dem, was im Blute drängte, was den Schwung freimachte, der ihn
spannte. Nach zwei Jahren verkroch er sich in Nuenen in Brabant, in die
Dunkelheit der Arbeiterhütten und Bauernhäuser getrieben, im Dunklen herum-
tastend und so auch malend, aber mählich die gestauten Kräfte lockernd, hin-
512
Mit sechs Abbildungen auf drei Tafeln Von M. R. MÖBIUS
ALS van Gogh 1889 das Selbstbildnis mit der Widmung an Gauguin malte,
Awar die Auflösung der alten schulmäßigen Bindungen Unter den zeit-
genössischen Malern in vollem Gange. In demselben Jahre malte Renoir das
Bildnis der Madame de Bonnieres, das am Eingang seiner letzten Reife steht,
stellte Monet bei George Petit den größten Teil seiner Gemälde aus, eine
einzigartige Bilanz, begann Seurat mit der kühnen Ornamentik von „Le
Chahut“, der Vorbereitung einer neuen Bildkomposition, vollendete Cezanne
den Jungen mit der roten Weste, malte Munch die drei Mädchen auf der
Brücke, Liebermann die Netzflickerinnen und Hodler den Winzer. Courbet
war tot, von Manet kam nichts mehr. Und in Deutschland? Marees war ge-
storben, Menzel verdarb im Industrialismus. Nirgend war mehr eine einigende
Doktrin. Jeder Maler, der wirklich beitrug zur Geschichte der euopäischen
Malerei, stand auf sich und seiner Spezialität. Er war nicht in der Reihe,
wenn er auch am Anfang gelegentlich einmal versucht hatte, in den Schwung
der anderen zu kommen. Er hatte seinen eigenen Schwung und bestand darauf.
Es gab keine Wahl, einen anderen zu haben.
Van Gogh warf es aus allem heraus, was sonst den Menschen bindet und
von ihm gebunden wird. Wie aus einer Panik flüchtete er in die Malerei, in
die rettende Arbeit. Nichts war ihm geblieben, um eine gleichmäßige Existenz
zu beginnen, einen Alltag mit eingeteilter Arbeit. Seine ganze Jugend war
eine einzige Niederlage vor den Verpflichtungen und Ordnungen der bürger-
lichen Gesellschaft. Den Sechzehnjährigen schickte der Vater in den Kunst-
handel. Er kam nach dem Haag, nach London und Paris. Als Dreiundzwanzig-
jähriger wurde er entlassen, untauglich zum Geschäftemachen, wie es sich ge-
hörte. Er rebellierte gegen die geschäftliche Praxis, versagte die Beteiligung
am „Diebstahl“. Die primitiven sozialistischen Gedankengänge begannen zu
wuchern. Wo war noch menschliche Gemeinschaft? Die menschliche Gesell-
schaft glich einer Verschwörung, sich gegenseitig auszurotten. Niemand tat
etwas dagegen. Und es mußte etwas getan werden. Er, Vincent van Gogh,
Sohn und Enkel von Pastoren, hatte endlich damit anzufangen. Sein Gehirn
wollte nicht weiter, er war wie eingemauert, verdammt, mit den Händen die
Wände zu zerbröckeln, um ans Licht zu kommen. Er versuchte es als
Hilfslehrer in einem Institut in London, als Buchhändler in Dordt, er fing
in Amsterdam mit dem Studium der Theologie an, verstrickte sich immer mehr,
versank in seiner eigenen Tiefe. Ganz da unten angekommen, reckte sich
endlich ein Wille hoch, ein Entschluß: als ein Liebender zu den Ungeliebten
und Lieblosen zu gehen, die brennende Ungerechtigkeit zu überwinden durch
die Liebe! Ein Jahr lang blieb er unter den Kohlenarbeitern der Borinage als
Laienprediger, dann kam die Katastrophe, zerbrochen kehrte er heim. Der
Entschluß, hinauszulieben ohne Ende, wich der Ermüdung. Zu Hause sam-
melte er sich zu neuer Aufgabe. Abermals zog er nach dem Haag, ging in das
Atelier von Mauve und begann die Ausbildung zum Maler. Nichts von der dort
üblichen Methode blieb an ihm hängen, nichts genügte ihm. Nirgends war ein
Weg zu dem, was im Blute drängte, was den Schwung freimachte, der ihn
spannte. Nach zwei Jahren verkroch er sich in Nuenen in Brabant, in die
Dunkelheit der Arbeiterhütten und Bauernhäuser getrieben, im Dunklen herum-
tastend und so auch malend, aber mählich die gestauten Kräfte lockernd, hin-
512