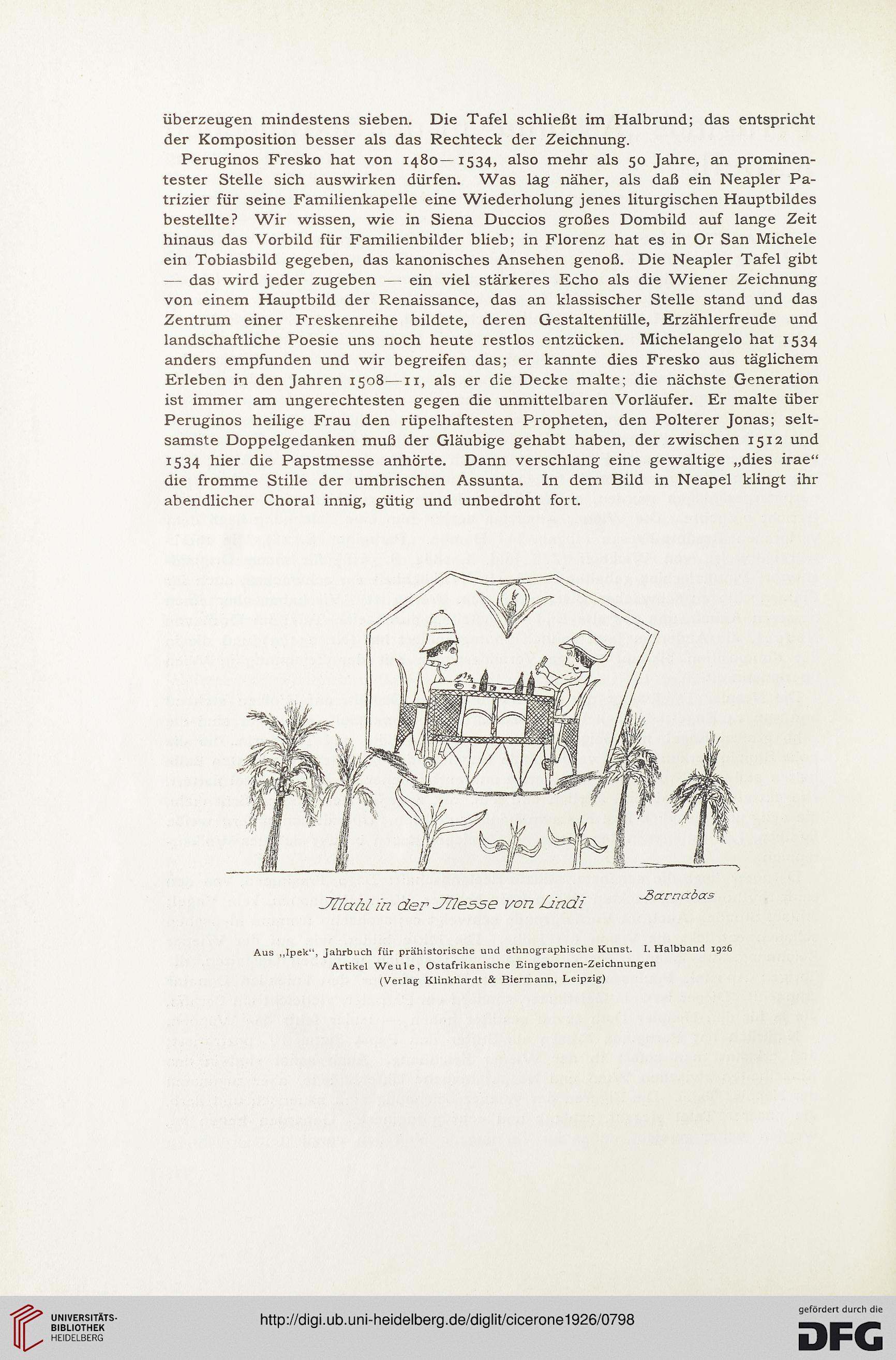Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 18.1926
Cite this page
Please cite this page by using the following URL/DOI:
https://doi.org/10.11588/diglit.41317#0798
DOI issue:
Heft 23
DOI article:Schubring, Paul: Peruginos "Assunta" in der Sixtinischen Kapelle
DOI Page / Citation link:https://doi.org/10.11588/diglit.41317#0798
überzeugen mindestens sieben. Die Tafel schließt im Halbrund; das entspricht
der Komposition besser als das Rechteck der Zeichnung.
Peruginos Fresko hat von 1480—1534, also mehr als 50 Jahre, an prominen-
tester Stelle sich auswirken dürfen. Was lag näher, als daß ein Neapler Pa-
trizier für seine Familienkapelle eine Wiederholung jenes liturgischen Hauptbildes
bestellte? Wir wissen, wie in Siena Duccios großes Dombild auf lange Zeit
hinaus das Vorbild für Familienbilder blieb; in Florenz hat es in Or San Michele
ein Tobiasbild gegeben, das kanonisches Ansehen genoß. Die Neapler Tafel gibt
— das wird jeder zugeben — ein viel stärkeres Echo als die Wiener Zeichnung
von einem Hauptbild der Renaissance, das an klassischer Stelle stand und das
Zentrum einer Freskenreihe bildete, deren Gestaltenlülle, Erzählerfreude und
landschaftliche Poesie uns noch heute restlos entzücken. Michelangelo hat 1534
anders empfunden und wir begreifen das; er kannte dies Fresko aus täglichem
Erleben in den Jahren 1508—11, als er die Decke malte; die nächste Generation
ist immer am ungerechtesten gegen die unmittelbaren Vorläufer. Er malte über
Peruginos heilige Frau den rüpelhaftesten Propheten, den Polterer Jonas; selt-
samste Doppelgedanken muß der Gläubige gehabt haben, der zwischen 1512 und
1534 hier die Papstmesse anhörte. Dann verschlang eine gewaltige „dies irae“
die fromme Stille der umbrischen Assunta. In dem Bild in Neapel klingt ihr
abendlicher Choral innig, gütig und unbedroht fort.
Aus „Ipek“, Jahrbuch für prähistorische und ethnographische Kunst. I. Halbband 1926
Artikel Weule, Ostafrikanische Eingebornen-Zeichnungen
(Verlag Klinkhardt & Biermann, Leipzig)
der Komposition besser als das Rechteck der Zeichnung.
Peruginos Fresko hat von 1480—1534, also mehr als 50 Jahre, an prominen-
tester Stelle sich auswirken dürfen. Was lag näher, als daß ein Neapler Pa-
trizier für seine Familienkapelle eine Wiederholung jenes liturgischen Hauptbildes
bestellte? Wir wissen, wie in Siena Duccios großes Dombild auf lange Zeit
hinaus das Vorbild für Familienbilder blieb; in Florenz hat es in Or San Michele
ein Tobiasbild gegeben, das kanonisches Ansehen genoß. Die Neapler Tafel gibt
— das wird jeder zugeben — ein viel stärkeres Echo als die Wiener Zeichnung
von einem Hauptbild der Renaissance, das an klassischer Stelle stand und das
Zentrum einer Freskenreihe bildete, deren Gestaltenlülle, Erzählerfreude und
landschaftliche Poesie uns noch heute restlos entzücken. Michelangelo hat 1534
anders empfunden und wir begreifen das; er kannte dies Fresko aus täglichem
Erleben in den Jahren 1508—11, als er die Decke malte; die nächste Generation
ist immer am ungerechtesten gegen die unmittelbaren Vorläufer. Er malte über
Peruginos heilige Frau den rüpelhaftesten Propheten, den Polterer Jonas; selt-
samste Doppelgedanken muß der Gläubige gehabt haben, der zwischen 1512 und
1534 hier die Papstmesse anhörte. Dann verschlang eine gewaltige „dies irae“
die fromme Stille der umbrischen Assunta. In dem Bild in Neapel klingt ihr
abendlicher Choral innig, gütig und unbedroht fort.
Aus „Ipek“, Jahrbuch für prähistorische und ethnographische Kunst. I. Halbband 1926
Artikel Weule, Ostafrikanische Eingebornen-Zeichnungen
(Verlag Klinkhardt & Biermann, Leipzig)