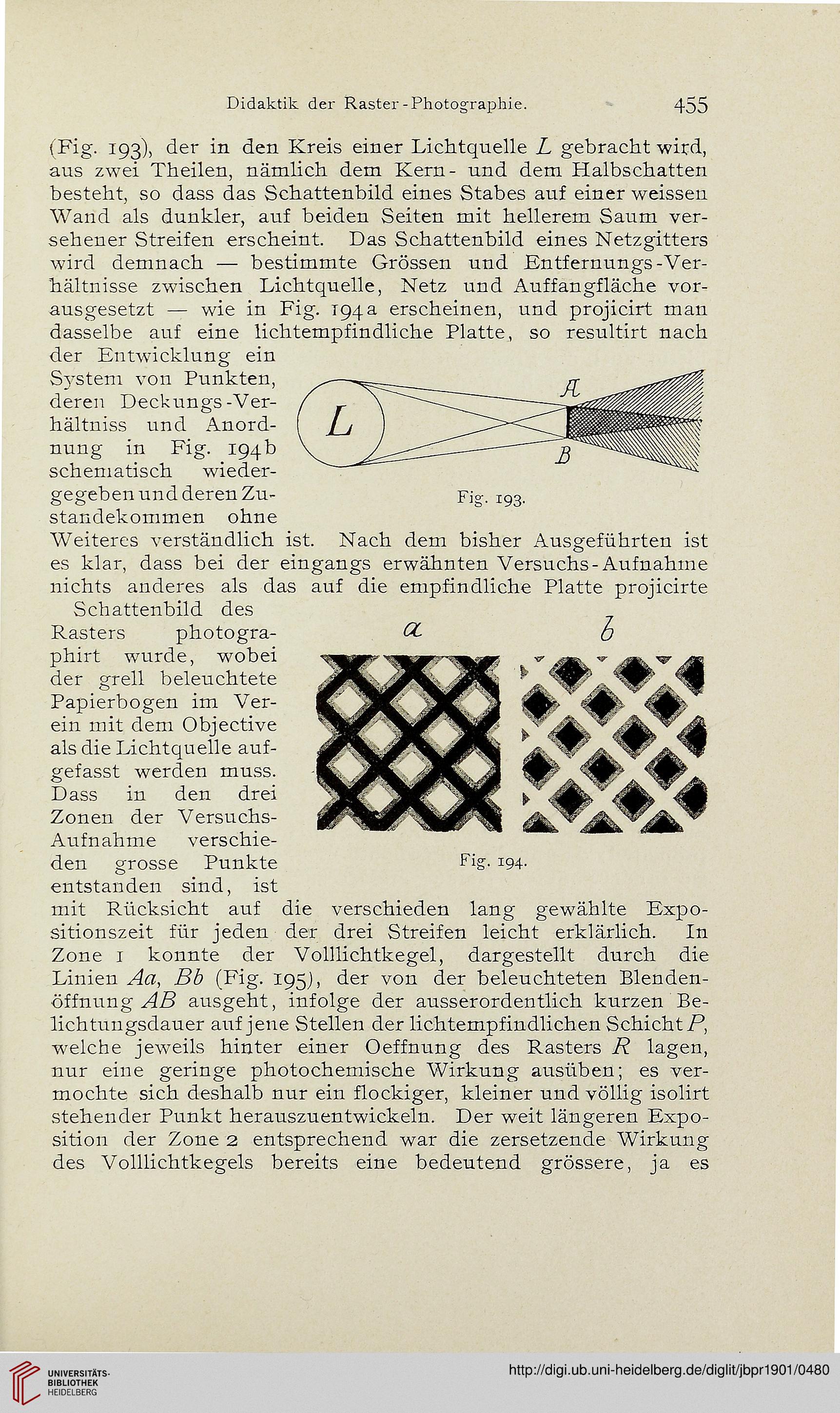Didaktik der Raster-Photographie.
455
(Fig. 193), der in den Kreis einer Lichtquelle L gebracht wird,
aus zwei Theilen, nämlich dem Kern- und dem Halbschatten
besteht, so dass das Schattenbild eines Stabes auf einer weissen
Wand als dunkler, auf beiden Seiten mit hellerem Saum ver-
sehener Streifen erscheint. Das Schattenbild eines Netzgitters
wird demnach — bestimmte Grössen und JBntfernungs-Ver-
hältnisse zwischen Lichtquelle, Netz und Auffangfläche vor-
ausgesetzt — wie in Fig. 194a erscheinen, und projicirt man
dasselbe auf eine lichtempfindliche Platte, so resultirt nach
der Entwicklung ein
System von Punkten,
deren Deckungs-Ver-
hältniss und Anord-
nung in Fig. 194 b
schematisch wieder-
gegebenundderenZu- Fig. 193.
standekommen ohne
Weiteres verständlich ist. Nach dem bisher Ausgeführten ist
es klar, dass bei der eingangs erwähnten Versuchs-Aufnahme
nichts anderes als das auf die empfindliche Platte projicirte
Schattenbild des
Rasters photogra- OL o
phirt wurde, wobei
der grell beleuchtete
Papierbogen im Ver-
ein mit dem Objective
als die Lichtquelle auf-
gefasst werden muss.
Dass in den drei
Zonen der Versuchs-
Aufnahme verschie-
den grosse Punkte Fig- 194-
entstanden sind, ist
mit Riicksicht auf die verschieden lang gewählte Expo-
sitionszeit für jeden der drei Streifen leicht erklärlich. In
Zone 1 konnte der Volllichtkegel, dargestellt durch die
Linien Aa, Bb (Fig. 195), der von der beleuchteten Blenden-
öffnung AB ausgeht, infolge der ausserordentlich kurzen Be-
lichtuugsclauer auf jene Stellen der lichtempfindlichen SchichtP,
welche jeweils hinter einer Oeffnung des Rasters R lagen,
nur eine geringe photochemische Wirkung ausüben; es ver-
mochte sich deshalb nur ein flockiger, kleiner und völlig isolirt
stehender Punkt herauszuentwickeln. Der weit längeren Expo-
sition der Zone 2 entsprechend war die zersetzende Wirkung
des Volllichtkegels bereits eine bedeutend grössere, ja es
455
(Fig. 193), der in den Kreis einer Lichtquelle L gebracht wird,
aus zwei Theilen, nämlich dem Kern- und dem Halbschatten
besteht, so dass das Schattenbild eines Stabes auf einer weissen
Wand als dunkler, auf beiden Seiten mit hellerem Saum ver-
sehener Streifen erscheint. Das Schattenbild eines Netzgitters
wird demnach — bestimmte Grössen und JBntfernungs-Ver-
hältnisse zwischen Lichtquelle, Netz und Auffangfläche vor-
ausgesetzt — wie in Fig. 194a erscheinen, und projicirt man
dasselbe auf eine lichtempfindliche Platte, so resultirt nach
der Entwicklung ein
System von Punkten,
deren Deckungs-Ver-
hältniss und Anord-
nung in Fig. 194 b
schematisch wieder-
gegebenundderenZu- Fig. 193.
standekommen ohne
Weiteres verständlich ist. Nach dem bisher Ausgeführten ist
es klar, dass bei der eingangs erwähnten Versuchs-Aufnahme
nichts anderes als das auf die empfindliche Platte projicirte
Schattenbild des
Rasters photogra- OL o
phirt wurde, wobei
der grell beleuchtete
Papierbogen im Ver-
ein mit dem Objective
als die Lichtquelle auf-
gefasst werden muss.
Dass in den drei
Zonen der Versuchs-
Aufnahme verschie-
den grosse Punkte Fig- 194-
entstanden sind, ist
mit Riicksicht auf die verschieden lang gewählte Expo-
sitionszeit für jeden der drei Streifen leicht erklärlich. In
Zone 1 konnte der Volllichtkegel, dargestellt durch die
Linien Aa, Bb (Fig. 195), der von der beleuchteten Blenden-
öffnung AB ausgeht, infolge der ausserordentlich kurzen Be-
lichtuugsclauer auf jene Stellen der lichtempfindlichen SchichtP,
welche jeweils hinter einer Oeffnung des Rasters R lagen,
nur eine geringe photochemische Wirkung ausüben; es ver-
mochte sich deshalb nur ein flockiger, kleiner und völlig isolirt
stehender Punkt herauszuentwickeln. Der weit längeren Expo-
sition der Zone 2 entsprechend war die zersetzende Wirkung
des Volllichtkegels bereits eine bedeutend grössere, ja es