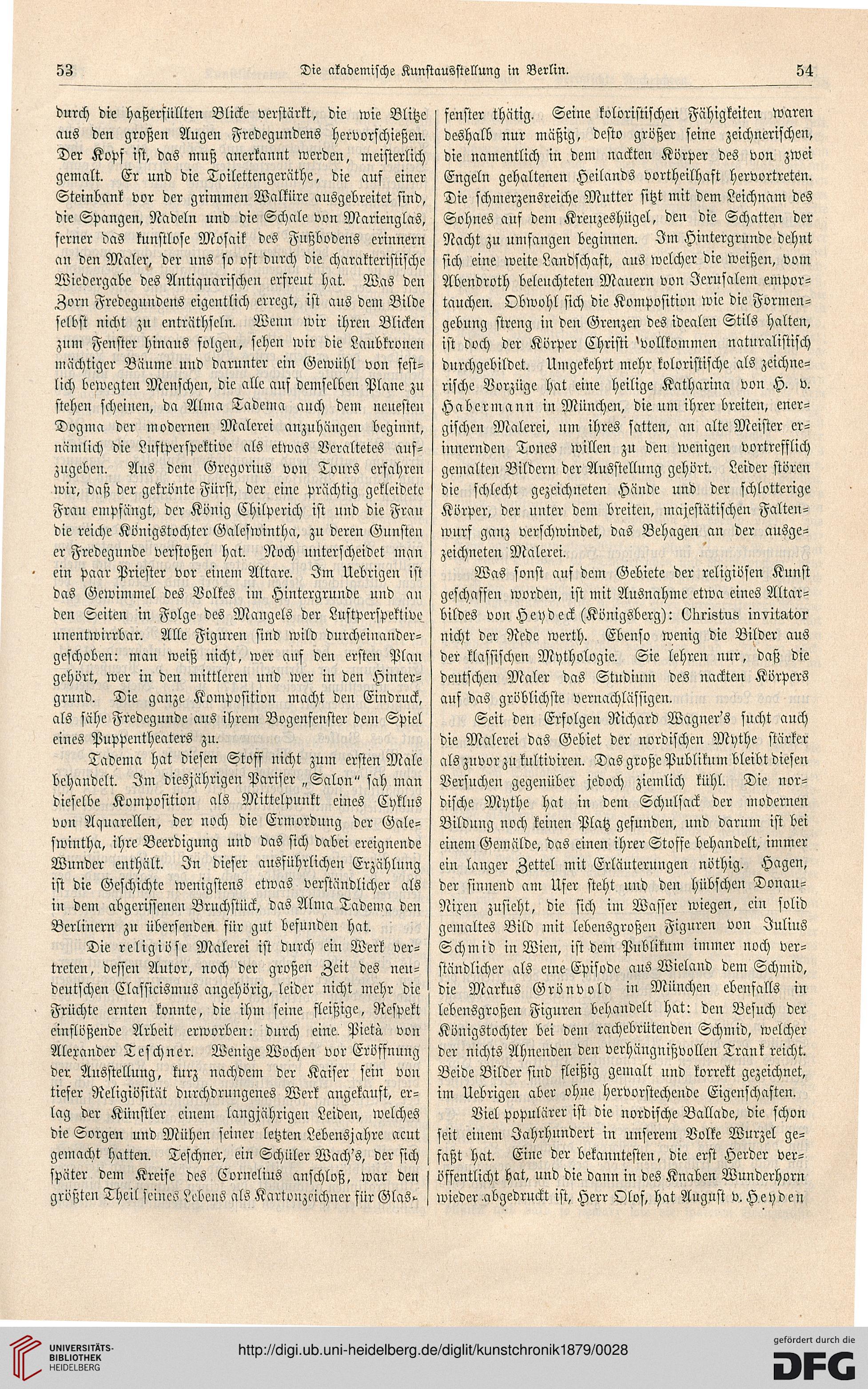53
Die akadsmische Kunstausstellung in Bsrlin.
54
durch die haßerfüllten Blicke verstärkt, die wie Blitze
aus den großen Augen Fredegundens hervorschießen.
Der Kvpf ist, das muß anerkannt werden, meisterlich
gemalt. Er und die Toilettengeräthe, die auf einer
Steinbank vor der grimmen Walküre ausgebreitet sind,
die Spangen, Nadeln und die Schale von Marienglas,
ferner das kunstlose Mosaik des Fußbodens crinnern
an den Maler, der uns so oft dnrch die charakteristische
Wiedergabe des Antiguarischcn erfreut hat. W.as dcn
Zorn Fredegundens eigentlich erregt, ist aus dem Bilde
selbst nicht zu enträthscln. Wenn tvir ihren Blicken
zum Fenster hinaus solgen, sehen wir die Laubkronen
mächtiger Bäume und darunter ein Gewühl von fest-
lich bewcgten Mcnschcn, dic alle auf demsclben Plane zu
stehen schcinen, da Alma Tadema auch dcm ncuesten
Dogma der modcrnen Malerci anzuhängen beginnt,
nämlich die Luftperspektive als etwas Veraltetes anf-
zugeben. Aus dcm Gregvrius vvn Tonrs erfahrcn
wir, daß der gekrönte Fürst, der cine prächtig gekleidete
Frau empfängt, dcr Kvnig Chilperich ist nnd die Frau
die reiche Königstochter Galeswintha, zu deren Gunsten
er Fredegunde verstoßen hat. Noch nnterscheidet man
ein paar Priester vor einem Altare. Jm Uebrigen ist
das Gewimmel des Volkes im Hintergrunde und an
den Seiten in Folge des Mangels der Luftperspektive
unentwirrbar. Alle Figuren sind wild durcheinander-
geschoben: man weiß nicht, wer anf den ersten Plan
gehört, wer in den mittleren und wer in den Hinter-
grund. Die ganze Komposition macht den Eindruck,
als sähe Fredegunde aus ihrem Bogenfenster dem Spiel
eines Puppentheaters zu.
Tadema hat diesen Stoff nicht zum ersten Male
behandclt. Jm dieSjährigen Pariser „Salon" sah man
dieselbe Komposition als Mittelpunkt eines Cyklus
vvn Aguarellen, der uoch die Ermordung der Gale-
swintha, ihre Beerdigung und das sich dabei ereignende
Wunder enthält. In dieser ausführlichen Erzählung
ist die Geschichte wenigstens etwas verständlicher als
in dem abgerissenen Bruchstück, das Alma Tadema den
Berlinern zu übersenden für gut befunden hat.
Die religivse Malerei ist durch eiu Werk ver-
treten, dessen Autor, noch der großen Zeit des neu-
deutschen Classicismus angehörig, leider nicht mehr dic
Früchte ernten kvnnte, die ihm seine fleißige, Respekt
einflößende Arbeit erworben: durch eine. Pietü von
Alepander Teschner. Wenige Wochen vor Eröffnung
der. Ausstellung, kurz nachdem der Kaiser sein vvn
tiefer Religiösität dnrchdrungenes Werk angekauft, er-
lag der Künstler einem langjährigen Leideu, welches
die Sorgen und Mühcn seiner letzten Lebensjahre acut
gemacht hatten. Teschner, ein Schlller Wach's, der sich
später dem Kreise des Cvrnelius anschloß, war den
größten Thcil seincs LcbcnS als Kartvnzcichner für Glas-
fenster thätig. Seine koloristischen Fähigkeiten waren
deshalb nur mäßig, desto größer seine zeichnerischen,
die namentlich in dem nackten Körper des von zwei
Engeln gehaltenen Heilands vortheilhaft hervortreten.
Die schmerzensreiche Mutter sitzt mit dem Leichnam des
Sohnes auf dem Kreuzeshügel, den die Schatten der
Nacht zu umfangen beginnen. Jm Hintergrunde dehnt
sich eine weite Landschaft, aus wclcher die weißen, vom
Abendroth belenchtcten Mauern von Jcrusalem empor-
tauchen. Obwohl sich die Kompositivn wie die Formen-
gebung streng in den Grenzen des idealen Stils halten,
ist dvch der Körper Christi 'vollkommen naturalistisch
durchgebildet. Umgekehrt mehr kvloristische als zeichne-
rische Vorzüge hat eine heilige Katharina von H. v.
Habermann in München, die um ihrer breiten, ener-
gischen Malerei, uin ihres satten, an alte Meister er-
innernden Tones willcn zu den wenigen vortrefflich
gemalten Bildern der Ausstellung gehört. Leider störcn
die schlecht gezcichneten Hände und der schlotterige
Körper, der unter dem breiten, majestätischen Falten-
tvurf ganz verschwindet, das Behagen an der ausge-
zeichneten Malerei.
Was sonst auf dem Gebiete der religiösen Kunst
geschaffen worden, ist mit Ausnahme ettva eines Altar-
bildes Vvn Hepdeck (Königsberg): Oliristns invits-tor
nicht der Rede werth. Ebenso wenig die Bilder aus
der klassischen Mpthologie. Sie lehren nur, daß dic
deutschen Maler das Studium des nackten Körpers
auf das gröblichste vernachlässigen.
Seit den Erfolgen Richard Wagner's sucht auch
die Malerei das Gebiet der nordischen Mpthe stärker
als zuvor zu kultiviren. Das große Publikum bleibt diesen
Versuchen gegenüber jedoch ziemlich kühl. Die nor-
dische Mpthe hat in dem Schulsack der modernen
Bildung noch keinen Platz gefunden, und darum ist bei
einem Gemälde, das einen ihrer Stoffe behandelt, inimer
ein langer Zettel mit Erläuterungen nöthig. Hagen,
der sinnend am Ufer steht und den hübschen Donau-
Nixen zusieht, die sich im Wasser wiegen, cin solid
gemaltes Bild mit lebensgroßen Figuren von Julius
Schmid in Wien, ist dem Publikum immer uoch ver-
ständlicher als eme Episvde aus Wieland dem Schmid,
die Markus Grönvold in München ebenfalls in
lebensgroßen Figuren behandelt hat: den Besuch der
Königstochter bei dem rachebrütenden Schmid, welcher
der nichts Ahnenden den verhängnißvollen Trank reicht.
Beide Bilder sind fleißig gemalt und korrekt gezeichnet,
im Uebrigen aber ohne hervorstechende Eigenschaften.
Viel populärer ist die nordische Ballade, die schon
feit einem Jahrhundert in unserem Volke Wurzel ge-
faßt hat. Eine der bekanntesten, die erst Herder ver-
öffentlicht hat, und die dann in des Knaben Wunderhorn
wieder abgedruckt ist, Herr Olof, hat August v. Hepden
Die akadsmische Kunstausstellung in Bsrlin.
54
durch die haßerfüllten Blicke verstärkt, die wie Blitze
aus den großen Augen Fredegundens hervorschießen.
Der Kvpf ist, das muß anerkannt werden, meisterlich
gemalt. Er und die Toilettengeräthe, die auf einer
Steinbank vor der grimmen Walküre ausgebreitet sind,
die Spangen, Nadeln und die Schale von Marienglas,
ferner das kunstlose Mosaik des Fußbodens crinnern
an den Maler, der uns so oft dnrch die charakteristische
Wiedergabe des Antiguarischcn erfreut hat. W.as dcn
Zorn Fredegundens eigentlich erregt, ist aus dem Bilde
selbst nicht zu enträthscln. Wenn tvir ihren Blicken
zum Fenster hinaus solgen, sehen wir die Laubkronen
mächtiger Bäume und darunter ein Gewühl von fest-
lich bewcgten Mcnschcn, dic alle auf demsclben Plane zu
stehen schcinen, da Alma Tadema auch dcm ncuesten
Dogma der modcrnen Malerci anzuhängen beginnt,
nämlich die Luftperspektive als etwas Veraltetes anf-
zugeben. Aus dcm Gregvrius vvn Tonrs erfahrcn
wir, daß der gekrönte Fürst, der cine prächtig gekleidete
Frau empfängt, dcr Kvnig Chilperich ist nnd die Frau
die reiche Königstochter Galeswintha, zu deren Gunsten
er Fredegunde verstoßen hat. Noch nnterscheidet man
ein paar Priester vor einem Altare. Jm Uebrigen ist
das Gewimmel des Volkes im Hintergrunde und an
den Seiten in Folge des Mangels der Luftperspektive
unentwirrbar. Alle Figuren sind wild durcheinander-
geschoben: man weiß nicht, wer anf den ersten Plan
gehört, wer in den mittleren und wer in den Hinter-
grund. Die ganze Komposition macht den Eindruck,
als sähe Fredegunde aus ihrem Bogenfenster dem Spiel
eines Puppentheaters zu.
Tadema hat diesen Stoff nicht zum ersten Male
behandclt. Jm dieSjährigen Pariser „Salon" sah man
dieselbe Komposition als Mittelpunkt eines Cyklus
vvn Aguarellen, der uoch die Ermordung der Gale-
swintha, ihre Beerdigung und das sich dabei ereignende
Wunder enthält. In dieser ausführlichen Erzählung
ist die Geschichte wenigstens etwas verständlicher als
in dem abgerissenen Bruchstück, das Alma Tadema den
Berlinern zu übersenden für gut befunden hat.
Die religivse Malerei ist durch eiu Werk ver-
treten, dessen Autor, noch der großen Zeit des neu-
deutschen Classicismus angehörig, leider nicht mehr dic
Früchte ernten kvnnte, die ihm seine fleißige, Respekt
einflößende Arbeit erworben: durch eine. Pietü von
Alepander Teschner. Wenige Wochen vor Eröffnung
der. Ausstellung, kurz nachdem der Kaiser sein vvn
tiefer Religiösität dnrchdrungenes Werk angekauft, er-
lag der Künstler einem langjährigen Leideu, welches
die Sorgen und Mühcn seiner letzten Lebensjahre acut
gemacht hatten. Teschner, ein Schlller Wach's, der sich
später dem Kreise des Cvrnelius anschloß, war den
größten Thcil seincs LcbcnS als Kartvnzcichner für Glas-
fenster thätig. Seine koloristischen Fähigkeiten waren
deshalb nur mäßig, desto größer seine zeichnerischen,
die namentlich in dem nackten Körper des von zwei
Engeln gehaltenen Heilands vortheilhaft hervortreten.
Die schmerzensreiche Mutter sitzt mit dem Leichnam des
Sohnes auf dem Kreuzeshügel, den die Schatten der
Nacht zu umfangen beginnen. Jm Hintergrunde dehnt
sich eine weite Landschaft, aus wclcher die weißen, vom
Abendroth belenchtcten Mauern von Jcrusalem empor-
tauchen. Obwohl sich die Kompositivn wie die Formen-
gebung streng in den Grenzen des idealen Stils halten,
ist dvch der Körper Christi 'vollkommen naturalistisch
durchgebildet. Umgekehrt mehr kvloristische als zeichne-
rische Vorzüge hat eine heilige Katharina von H. v.
Habermann in München, die um ihrer breiten, ener-
gischen Malerei, uin ihres satten, an alte Meister er-
innernden Tones willcn zu den wenigen vortrefflich
gemalten Bildern der Ausstellung gehört. Leider störcn
die schlecht gezcichneten Hände und der schlotterige
Körper, der unter dem breiten, majestätischen Falten-
tvurf ganz verschwindet, das Behagen an der ausge-
zeichneten Malerei.
Was sonst auf dem Gebiete der religiösen Kunst
geschaffen worden, ist mit Ausnahme ettva eines Altar-
bildes Vvn Hepdeck (Königsberg): Oliristns invits-tor
nicht der Rede werth. Ebenso wenig die Bilder aus
der klassischen Mpthologie. Sie lehren nur, daß dic
deutschen Maler das Studium des nackten Körpers
auf das gröblichste vernachlässigen.
Seit den Erfolgen Richard Wagner's sucht auch
die Malerei das Gebiet der nordischen Mpthe stärker
als zuvor zu kultiviren. Das große Publikum bleibt diesen
Versuchen gegenüber jedoch ziemlich kühl. Die nor-
dische Mpthe hat in dem Schulsack der modernen
Bildung noch keinen Platz gefunden, und darum ist bei
einem Gemälde, das einen ihrer Stoffe behandelt, inimer
ein langer Zettel mit Erläuterungen nöthig. Hagen,
der sinnend am Ufer steht und den hübschen Donau-
Nixen zusieht, die sich im Wasser wiegen, cin solid
gemaltes Bild mit lebensgroßen Figuren von Julius
Schmid in Wien, ist dem Publikum immer uoch ver-
ständlicher als eme Episvde aus Wieland dem Schmid,
die Markus Grönvold in München ebenfalls in
lebensgroßen Figuren behandelt hat: den Besuch der
Königstochter bei dem rachebrütenden Schmid, welcher
der nichts Ahnenden den verhängnißvollen Trank reicht.
Beide Bilder sind fleißig gemalt und korrekt gezeichnet,
im Uebrigen aber ohne hervorstechende Eigenschaften.
Viel populärer ist die nordische Ballade, die schon
feit einem Jahrhundert in unserem Volke Wurzel ge-
faßt hat. Eine der bekanntesten, die erst Herder ver-
öffentlicht hat, und die dann in des Knaben Wunderhorn
wieder abgedruckt ist, Herr Olof, hat August v. Hepden