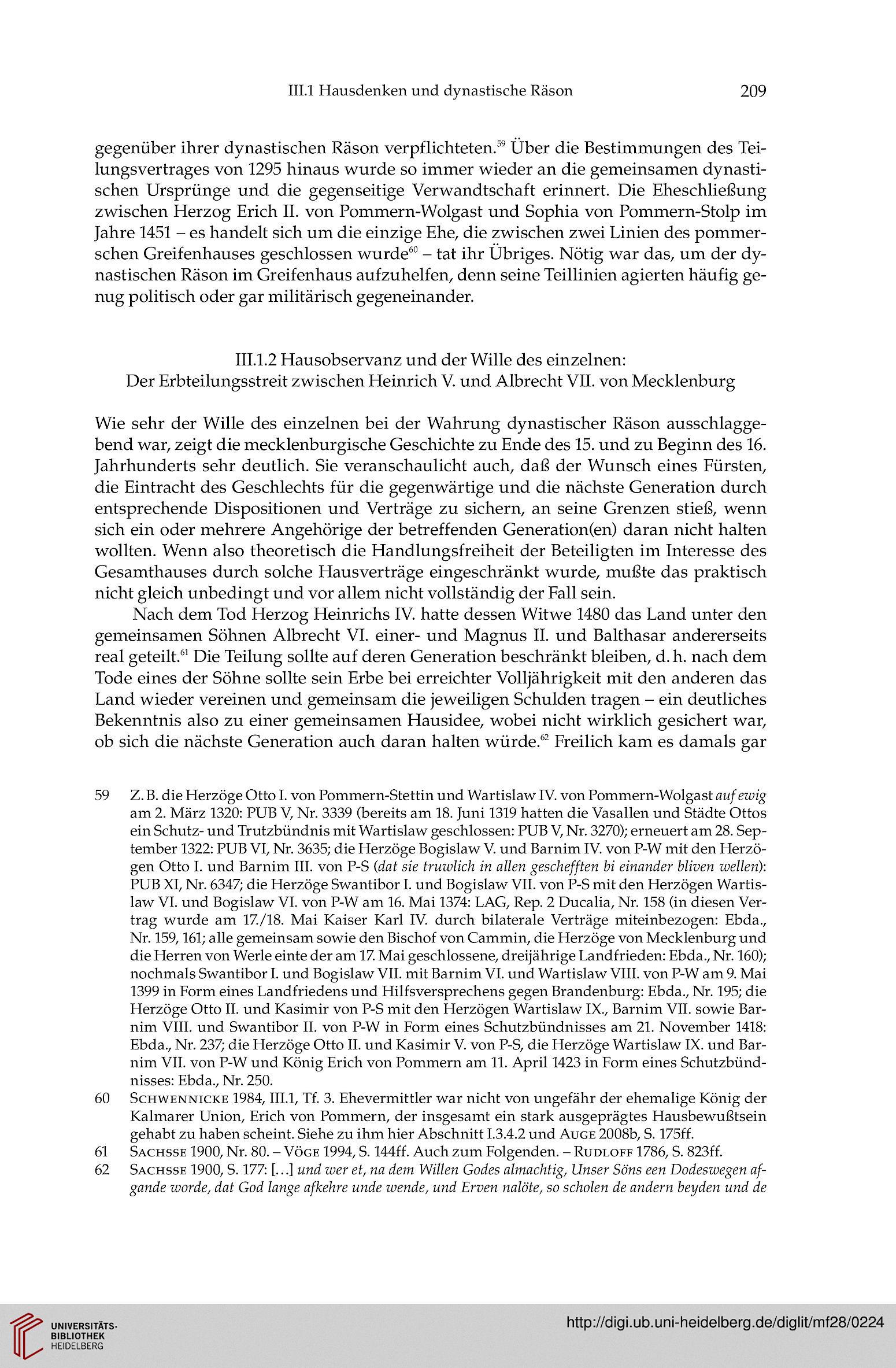111.1 Hausdenken und dynastische Räson
209
gegenüber ihrer dynastischen Räson verpflichteten.^ Über die Bestimmungen des Tei-
lungsvertrages von 1295 hinaus wurde so immer wieder an die gemeinsamen dynasti-
schen Ursprünge und die gegenseitige Verwandtschaft erinnert. Die Eheschließung
zwischen Herzog Erich II. von Pommern-Wolgast und Sophia von Pommern-Stolp im
Jahre 1451 - es handelt sich um die einzige Ehe, die zwischen zwei Linien des pommer-
schen Greifenhauses geschlossen wurde"" - tat ihr Übriges. Nötig war das, um der dy-
nastischen Räson im Greifenhaus aufzuhelfen, denn seine Teillinien agierten häufig ge-
nug politisch oder gar militärisch gegeneinander.
111.1.2 Hausobservanz und der Wille des einzelnen:
Der Erbteilungsstreit zwischen Heinrich V. und Albrecht VII. von Mecklenburg
Wie sehr der Wille des einzelnen bei der Wahrung dynastischer Räson ausschlagge-
bend war, zeigt die mecklenburgische Geschichte zu Ende des 15. und zu Beginn des 16.
Jahrhunderts sehr deutlich. Sie veranschaulicht auch, daß der Wunsch eines Fürsten,
die Eintracht des Geschlechts für die gegenwärtige und die nächste Generation durch
entsprechende Dispositionen und Verträge zu sichern, an seine Grenzen stieß, wenn
sich ein oder mehrere Angehörige der betreffenden Generationen) daran nicht halten
wollten. Wenn also theoretisch die Handlungsfreiheit der Beteiligten im Interesse des
Gesamthauses durch solche Hausverträge eingeschränkt wurde, mußte das praktisch
nicht gleich unbedingt und vor allem nicht vollständig der Fall sein.
Nach dem Tod Herzog Heinrichs IV. hatte dessen Witwe 1480 das Land unter den
gemeinsamen Söhnen Albrecht VI. einer- und Magnus II. und Balthasar andererseits
real geteilt."* Die Teilung sollte auf deren Generation beschränkt bleiben, d. h. nach dem
Tode eines der Söhne sollte sein Erbe bei erreichter Volljährigkeit mit den anderen das
Land wieder vereinen und gemeinsam die jeweiligen Schulden tragen - ein deutliches
Bekenntnis also zu einer gemeinsamen Hausidee, wobei nicht wirklich gesichert war,
ob sich die nächste Generation auch daran halten würde."" Freilich kam es damals gar
59 Z. B. die Herzoge Otto I. von Pommern-Stettin und Wartisiaw IV. von Pommern-Wolgast HM/ewig
am 2. März 1320: PUB V Nr. 3339 (bereits am 18. Juni 1319 hatten die Vasallen und Städte Ottos
ein Schutz- und Trutzbündnis mit Wartisiaw geschlossen: PUB V Nr. 3270); erneuert am 28. Sep-
tember 1322: PUB VI, Nr. 3635; die Herzoge Bogislaw V. und Barnim IV. von P-W mit den Herzo-
gen Otto I. und Barnim III. von P-S (dof sie IrnwEcE iw öden gescdejjfen M einander Minen weilen):
PUB XI, Nr. 6347; die Herzoge Swantibor I. und Bogislaw VII. von P-S mit den Herzogen Wartis-
iaw VI. und Bogislaw VI. von P-W am 16. Mai 1374: LAG, Rep. 2 Ducalia, Nr. 158 (in diesen Ver-
trag wurde am 17/18. Mai Kaiser Karl IV. durch bilaterale Verträge miteinbezogen: Ebda.,
Nr. 159,161; alle gemeinsam sowie den Bischof von Cammin, die Herzoge von Mecklenburg und
die Herren von Werle einte der am 17. Mai geschlossene, dreijährige Landfrieden: Ebda., Nr. 160);
nochmals Swantibor I. und Bogislaw VII. mit Barnim VI. und Wartisiaw VIII. von P-W am 9. Mai
1399 in Form eines Landfriedens und Hilfsversprechens gegen Brandenburg: Ebda., Nr. 195; die
Herzoge Otto II. und Kasimir von P-S mit den Herzogen Wartisiaw IX., Barnim VII. sowie Bar-
nim VIII. und Swantibor II. von P-W in Form eines Schutzbündnisses am 21. November 1418:
Ebda., Nr. 237; die Herzoge Otto II. und Kasimir V. von P-S, die Herzoge Wartisiaw IX. und Bar-
nim VII. von P-W und König Erich von Pommern am 11. April 1423 in Form eines Schutzbünd-
nisses: Ebda., Nr. 250.
60 ScHWENNiCKE 1984,111.1, Tf. 3. Ehevermittler war nicht von ungefähr der ehemalige König der
Kalmarer Union, Erich von Pommern, der insgesamt ein stark ausgeprägtes Hausbewußtsein
gehabt zu haben scheint. Siehe zu ihm hier Abschnitt 1.3.4.2 und AuGE 2008b, S. 175ff.
61 SACHSSE 1900, Nr. 80. - VÖGE 1994, S. 144ff. Auch zum Folgenden. - RuDLOFF 1786, S. 823ff.
62 SACHSSE 1900, S. 177: [...] Mud wer et, no de?n Widen Godes MnMcdü'g, Unser Sons een Dodeswegew of-
gonde worde, dof God Mnge o/dedre nnde wende, nnd Emen nMö'fe, so scdoien de ondern deyden nnd de
209
gegenüber ihrer dynastischen Räson verpflichteten.^ Über die Bestimmungen des Tei-
lungsvertrages von 1295 hinaus wurde so immer wieder an die gemeinsamen dynasti-
schen Ursprünge und die gegenseitige Verwandtschaft erinnert. Die Eheschließung
zwischen Herzog Erich II. von Pommern-Wolgast und Sophia von Pommern-Stolp im
Jahre 1451 - es handelt sich um die einzige Ehe, die zwischen zwei Linien des pommer-
schen Greifenhauses geschlossen wurde"" - tat ihr Übriges. Nötig war das, um der dy-
nastischen Räson im Greifenhaus aufzuhelfen, denn seine Teillinien agierten häufig ge-
nug politisch oder gar militärisch gegeneinander.
111.1.2 Hausobservanz und der Wille des einzelnen:
Der Erbteilungsstreit zwischen Heinrich V. und Albrecht VII. von Mecklenburg
Wie sehr der Wille des einzelnen bei der Wahrung dynastischer Räson ausschlagge-
bend war, zeigt die mecklenburgische Geschichte zu Ende des 15. und zu Beginn des 16.
Jahrhunderts sehr deutlich. Sie veranschaulicht auch, daß der Wunsch eines Fürsten,
die Eintracht des Geschlechts für die gegenwärtige und die nächste Generation durch
entsprechende Dispositionen und Verträge zu sichern, an seine Grenzen stieß, wenn
sich ein oder mehrere Angehörige der betreffenden Generationen) daran nicht halten
wollten. Wenn also theoretisch die Handlungsfreiheit der Beteiligten im Interesse des
Gesamthauses durch solche Hausverträge eingeschränkt wurde, mußte das praktisch
nicht gleich unbedingt und vor allem nicht vollständig der Fall sein.
Nach dem Tod Herzog Heinrichs IV. hatte dessen Witwe 1480 das Land unter den
gemeinsamen Söhnen Albrecht VI. einer- und Magnus II. und Balthasar andererseits
real geteilt."* Die Teilung sollte auf deren Generation beschränkt bleiben, d. h. nach dem
Tode eines der Söhne sollte sein Erbe bei erreichter Volljährigkeit mit den anderen das
Land wieder vereinen und gemeinsam die jeweiligen Schulden tragen - ein deutliches
Bekenntnis also zu einer gemeinsamen Hausidee, wobei nicht wirklich gesichert war,
ob sich die nächste Generation auch daran halten würde."" Freilich kam es damals gar
59 Z. B. die Herzoge Otto I. von Pommern-Stettin und Wartisiaw IV. von Pommern-Wolgast HM/ewig
am 2. März 1320: PUB V Nr. 3339 (bereits am 18. Juni 1319 hatten die Vasallen und Städte Ottos
ein Schutz- und Trutzbündnis mit Wartisiaw geschlossen: PUB V Nr. 3270); erneuert am 28. Sep-
tember 1322: PUB VI, Nr. 3635; die Herzoge Bogislaw V. und Barnim IV. von P-W mit den Herzo-
gen Otto I. und Barnim III. von P-S (dof sie IrnwEcE iw öden gescdejjfen M einander Minen weilen):
PUB XI, Nr. 6347; die Herzoge Swantibor I. und Bogislaw VII. von P-S mit den Herzogen Wartis-
iaw VI. und Bogislaw VI. von P-W am 16. Mai 1374: LAG, Rep. 2 Ducalia, Nr. 158 (in diesen Ver-
trag wurde am 17/18. Mai Kaiser Karl IV. durch bilaterale Verträge miteinbezogen: Ebda.,
Nr. 159,161; alle gemeinsam sowie den Bischof von Cammin, die Herzoge von Mecklenburg und
die Herren von Werle einte der am 17. Mai geschlossene, dreijährige Landfrieden: Ebda., Nr. 160);
nochmals Swantibor I. und Bogislaw VII. mit Barnim VI. und Wartisiaw VIII. von P-W am 9. Mai
1399 in Form eines Landfriedens und Hilfsversprechens gegen Brandenburg: Ebda., Nr. 195; die
Herzoge Otto II. und Kasimir von P-S mit den Herzogen Wartisiaw IX., Barnim VII. sowie Bar-
nim VIII. und Swantibor II. von P-W in Form eines Schutzbündnisses am 21. November 1418:
Ebda., Nr. 237; die Herzoge Otto II. und Kasimir V. von P-S, die Herzoge Wartisiaw IX. und Bar-
nim VII. von P-W und König Erich von Pommern am 11. April 1423 in Form eines Schutzbünd-
nisses: Ebda., Nr. 250.
60 ScHWENNiCKE 1984,111.1, Tf. 3. Ehevermittler war nicht von ungefähr der ehemalige König der
Kalmarer Union, Erich von Pommern, der insgesamt ein stark ausgeprägtes Hausbewußtsein
gehabt zu haben scheint. Siehe zu ihm hier Abschnitt 1.3.4.2 und AuGE 2008b, S. 175ff.
61 SACHSSE 1900, Nr. 80. - VÖGE 1994, S. 144ff. Auch zum Folgenden. - RuDLOFF 1786, S. 823ff.
62 SACHSSE 1900, S. 177: [...] Mud wer et, no de?n Widen Godes MnMcdü'g, Unser Sons een Dodeswegew of-
gonde worde, dof God Mnge o/dedre nnde wende, nnd Emen nMö'fe, so scdoien de ondern deyden nnd de