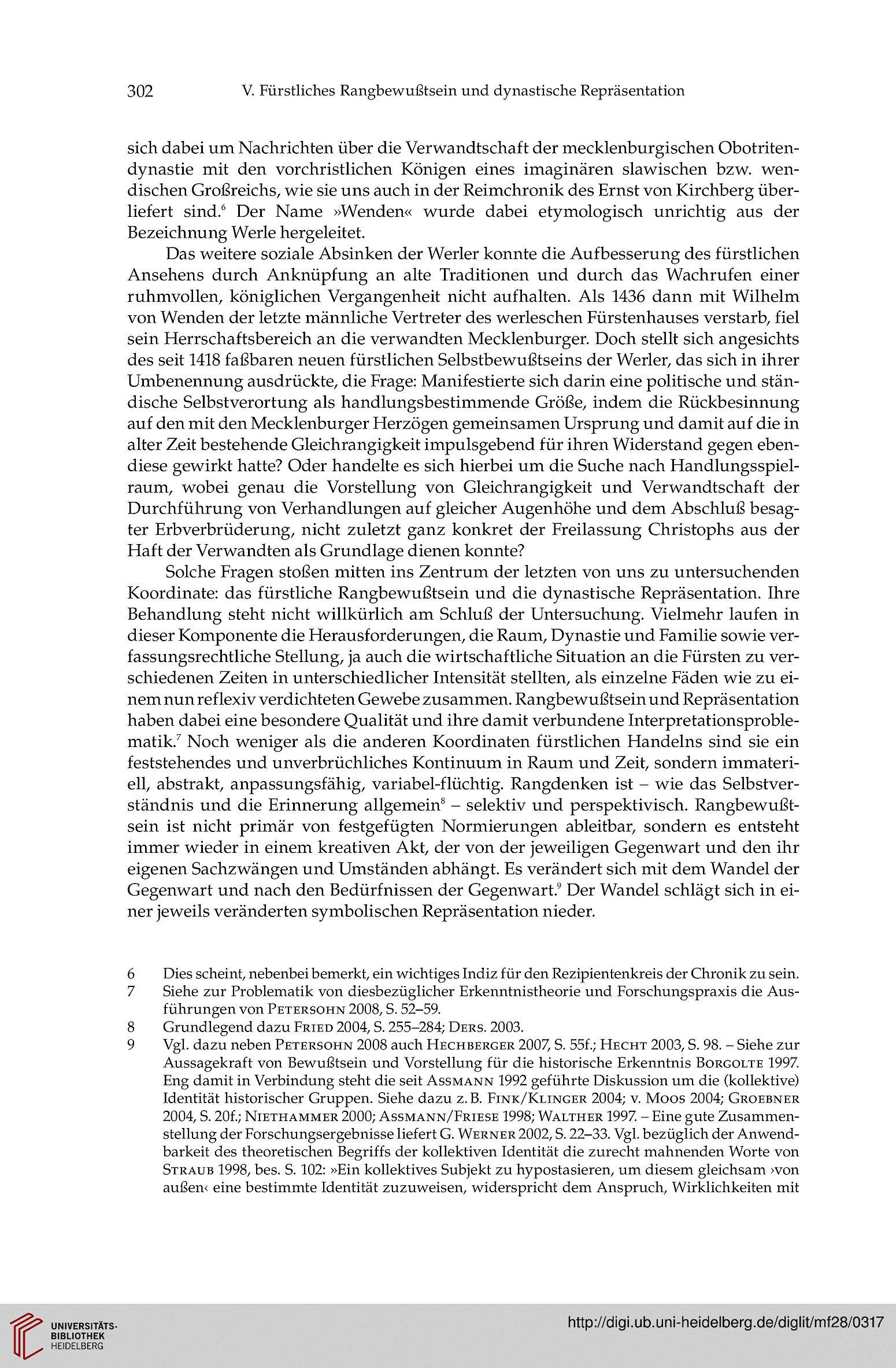302
V. Fürstliches Rangbewußtsein und dynastische Repräsentation
sich dabei um Nachrichten über die Verwandtschaft der mecklenburgischen Obotriten-
dynastie mit den vorchristlichen Königen eines imaginären slawischen bzw. wen-
dischen Großreichs, wie sie uns auch in der Reimchronik des Ernst von Kirchberg über-
liefert sind." Der Name »Wenden« wurde dabei etymologisch unrichtig aus der
Bezeichnung Werle hergeleitet.
Das weitere soziale Absinken der Werler konnte die Aufbesserung des fürstlichen
Ansehens durch Anknüpfung an alte Traditionen und durch das Wachrufen einer
ruhmvollen, königlichen Vergangenheit nicht aufhalten. Als 1436 dann mit Wilhelm
von Wenden der letzte männliche Vertreter des werleschen Fürstenhauses verstarb, fiel
sein Herrschaftsbereich an die verwandten Mecklenburger. Doch stellt sich angesichts
des seit 1418 faßbaren neuen fürstlichen Selbstbewußtseins der Werler, das sich in ihrer
Umbenennung ausdrückte, die Frage: Manifestierte sich darin eine politische und stän-
dische Selbstverortung als handlungsbestimmende Größe, indem die Rückbesinnung
auf den mit den Mecklenburger Herzogen gemeinsamen Ursprung und damit auf die in
alter Zeit bestehende Gleichrangigkeit impulsgebend für ihren Widerstand gegen eben-
diese gewirkt hatte? Oder handelte es sich hierbei um die Suche nach Handlungsspiel-
raum, wobei genau die Vorstellung von Gleichrangigkeit und Verwandtschaft der
Durchführung von Verhandlungen auf gleicher Augenhöhe und dem Abschluß besag-
ter Erbverbrüderung, nicht zuletzt ganz konkret der Freilassung Christophs aus der
Haft der Verwandten als Grundlage dienen konnte?
Solche Fragen stoßen mitten ins Zentrum der letzten von uns zu untersuchenden
Koordinate: das fürstliche Rangbewußtsein und die dynastische Repräsentation. Ihre
Behandlung steht nicht willkürlich am Schluß der Untersuchung. Vielmehr laufen in
dieser Komponente die Herausforderungen, die Raum, Dynastie und Familie sowie ver-
fassungsrechtliche Stellung, ja auch die wirtschaftliche Situation an die Fürsten zu ver-
schiedenen Zeiten in unterschiedlicher Intensität stellten, als einzelne Fäden wie zu ei-
nem nun reflexiv verdichteten Gewebe zusammen. Rangbewußtsein und Repräsentation
haben dabei eine besondere Qualität und ihre damit verbundene Interpretationsproble-
matik/ Noch weniger als die anderen Koordinaten fürstlichen Handelns sind sie ein
feststehendes und unverbrüchliches Kontinuum in Raum und Zeit, sondern immateri-
ell, abstrakt, anpassungsfähig, variabel-flüchtig. Rangdenken ist - wie das Selbstver-
ständnis und die Erinnerung allgemein" - selektiv und perspektivisch. Rangbewußt-
sein ist nicht primär von festgefügten Normierungen ableitbar, sondern es entsteht
immer wieder in einem kreativen Akt, der von der jeweiligen Gegenwart und den ihr
eigenen Sachzwängen und Umständen abhängt. Es verändert sich mit dem Wandel der
Gegenwart und nach den Bedürfnissen der Gegenwart? Der Wandel schlägt sich in ei-
ner jeweils veränderten symbolischen Repräsentation nieder.
6 Dies scheint, nebenbei bemerkt, ein wichtiges Indiz für den Rezipientenkreis der Chronik zu sein.
7 Siehe zur Problematik von diesbezüglicher Erkenntnistheorie und Forschungspraxis die Aus-
führungen von PETERSOHN 2008, S. 52-59.
8 Grundlegend dazu FRIED 2004, S. 255-284; DERS. 2003.
9 Vgl. dazu neben PETERSOHN 2008 auch HECHBERGER 2007) S. 55f.; HECHT 2003, S. 98. - Siehe zur
Aussagekraft von Bewußtsein und Vorstellung für die historische Erkenntnis BoRGOLTE 1997.
Eng damit in Verbindung steht die seit AssMANN 1992 geführte Diskussion um die (kollektive)
Identität historischer Gruppen. Siehe dazu z. B. FiNK/KLiNGER 2004; v. Moos 2004; GROEBNER
2004, S. 20f.; NIETHAMMER 2000; AssMANN/FRiESE 1998; WALTHER 1997. - Eine gute Zusammen-
stellung der Forschungsergebnisse liefert G. WERNER 2002, S. 22-33. Vgl. bezüglich der Anwend-
barkeit des theoretischen Begriffs der kollektiven Identität die zurecht mahnenden Worte von
STRAUB 1998, bes. S. 102: »Ein kollektives Subjekt zu hypostasieren, um diesem gleichsam >von
äußern eine bestimmte Identität zuzuweisen, widerspricht dem Anspruch, Wirklichkeiten mit
V. Fürstliches Rangbewußtsein und dynastische Repräsentation
sich dabei um Nachrichten über die Verwandtschaft der mecklenburgischen Obotriten-
dynastie mit den vorchristlichen Königen eines imaginären slawischen bzw. wen-
dischen Großreichs, wie sie uns auch in der Reimchronik des Ernst von Kirchberg über-
liefert sind." Der Name »Wenden« wurde dabei etymologisch unrichtig aus der
Bezeichnung Werle hergeleitet.
Das weitere soziale Absinken der Werler konnte die Aufbesserung des fürstlichen
Ansehens durch Anknüpfung an alte Traditionen und durch das Wachrufen einer
ruhmvollen, königlichen Vergangenheit nicht aufhalten. Als 1436 dann mit Wilhelm
von Wenden der letzte männliche Vertreter des werleschen Fürstenhauses verstarb, fiel
sein Herrschaftsbereich an die verwandten Mecklenburger. Doch stellt sich angesichts
des seit 1418 faßbaren neuen fürstlichen Selbstbewußtseins der Werler, das sich in ihrer
Umbenennung ausdrückte, die Frage: Manifestierte sich darin eine politische und stän-
dische Selbstverortung als handlungsbestimmende Größe, indem die Rückbesinnung
auf den mit den Mecklenburger Herzogen gemeinsamen Ursprung und damit auf die in
alter Zeit bestehende Gleichrangigkeit impulsgebend für ihren Widerstand gegen eben-
diese gewirkt hatte? Oder handelte es sich hierbei um die Suche nach Handlungsspiel-
raum, wobei genau die Vorstellung von Gleichrangigkeit und Verwandtschaft der
Durchführung von Verhandlungen auf gleicher Augenhöhe und dem Abschluß besag-
ter Erbverbrüderung, nicht zuletzt ganz konkret der Freilassung Christophs aus der
Haft der Verwandten als Grundlage dienen konnte?
Solche Fragen stoßen mitten ins Zentrum der letzten von uns zu untersuchenden
Koordinate: das fürstliche Rangbewußtsein und die dynastische Repräsentation. Ihre
Behandlung steht nicht willkürlich am Schluß der Untersuchung. Vielmehr laufen in
dieser Komponente die Herausforderungen, die Raum, Dynastie und Familie sowie ver-
fassungsrechtliche Stellung, ja auch die wirtschaftliche Situation an die Fürsten zu ver-
schiedenen Zeiten in unterschiedlicher Intensität stellten, als einzelne Fäden wie zu ei-
nem nun reflexiv verdichteten Gewebe zusammen. Rangbewußtsein und Repräsentation
haben dabei eine besondere Qualität und ihre damit verbundene Interpretationsproble-
matik/ Noch weniger als die anderen Koordinaten fürstlichen Handelns sind sie ein
feststehendes und unverbrüchliches Kontinuum in Raum und Zeit, sondern immateri-
ell, abstrakt, anpassungsfähig, variabel-flüchtig. Rangdenken ist - wie das Selbstver-
ständnis und die Erinnerung allgemein" - selektiv und perspektivisch. Rangbewußt-
sein ist nicht primär von festgefügten Normierungen ableitbar, sondern es entsteht
immer wieder in einem kreativen Akt, der von der jeweiligen Gegenwart und den ihr
eigenen Sachzwängen und Umständen abhängt. Es verändert sich mit dem Wandel der
Gegenwart und nach den Bedürfnissen der Gegenwart? Der Wandel schlägt sich in ei-
ner jeweils veränderten symbolischen Repräsentation nieder.
6 Dies scheint, nebenbei bemerkt, ein wichtiges Indiz für den Rezipientenkreis der Chronik zu sein.
7 Siehe zur Problematik von diesbezüglicher Erkenntnistheorie und Forschungspraxis die Aus-
führungen von PETERSOHN 2008, S. 52-59.
8 Grundlegend dazu FRIED 2004, S. 255-284; DERS. 2003.
9 Vgl. dazu neben PETERSOHN 2008 auch HECHBERGER 2007) S. 55f.; HECHT 2003, S. 98. - Siehe zur
Aussagekraft von Bewußtsein und Vorstellung für die historische Erkenntnis BoRGOLTE 1997.
Eng damit in Verbindung steht die seit AssMANN 1992 geführte Diskussion um die (kollektive)
Identität historischer Gruppen. Siehe dazu z. B. FiNK/KLiNGER 2004; v. Moos 2004; GROEBNER
2004, S. 20f.; NIETHAMMER 2000; AssMANN/FRiESE 1998; WALTHER 1997. - Eine gute Zusammen-
stellung der Forschungsergebnisse liefert G. WERNER 2002, S. 22-33. Vgl. bezüglich der Anwend-
barkeit des theoretischen Begriffs der kollektiven Identität die zurecht mahnenden Worte von
STRAUB 1998, bes. S. 102: »Ein kollektives Subjekt zu hypostasieren, um diesem gleichsam >von
äußern eine bestimmte Identität zuzuweisen, widerspricht dem Anspruch, Wirklichkeiten mit