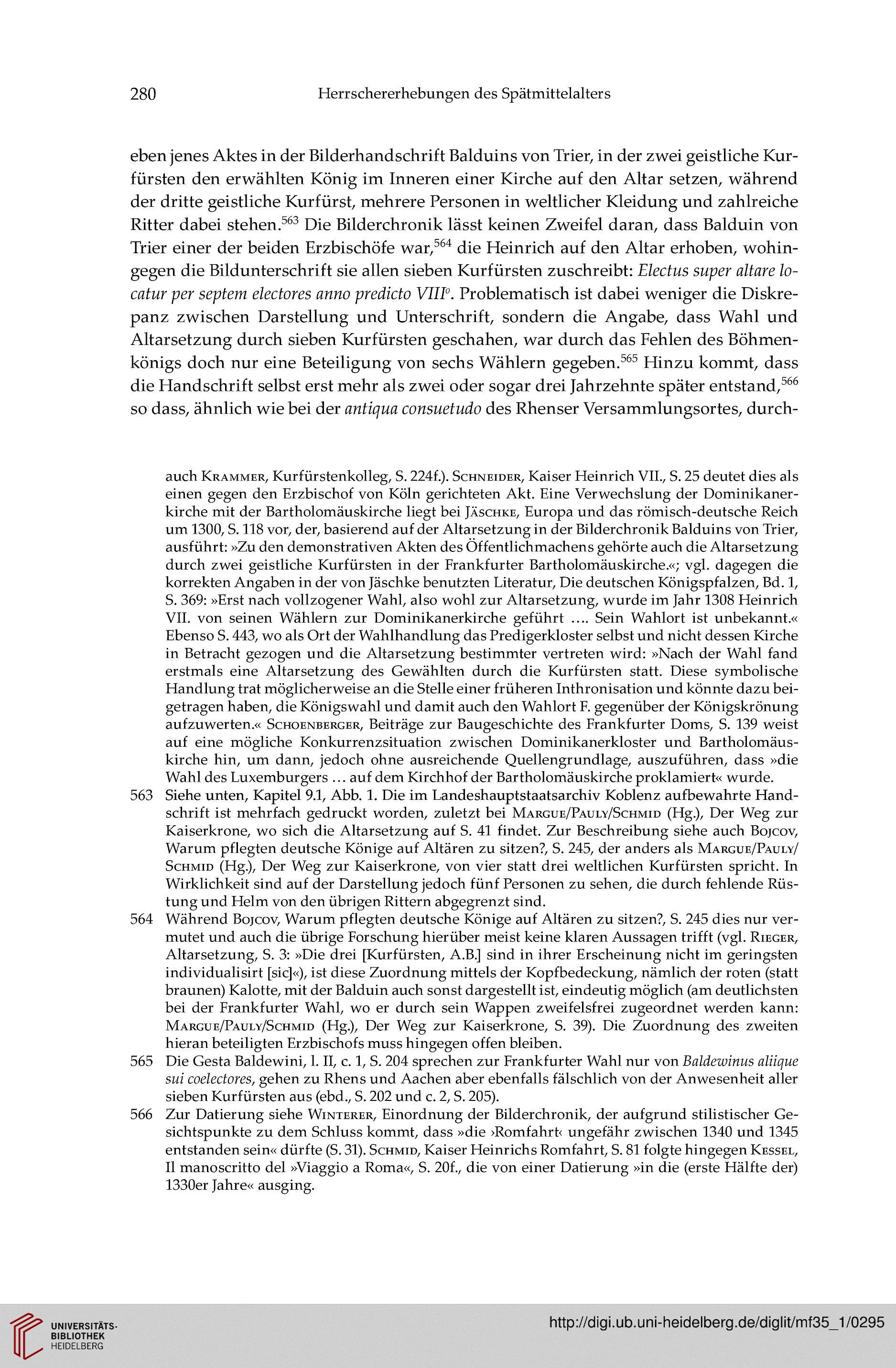280
Herrschererhebungen des Spätmittelalters
ebenjenes Aktes in der Bilderhandschrift Balduins von Trier, in der zwei geistliche Kur-
fürsten den erwählten König im Inneren einer Kirche auf den Altar setzen, während
der dritte geistliche Kurfürst, mehrere Personen in weltlicher Kleidung und zahlreiche
Ritter dabei stehen Die Bilderchronik lässt keinen Zweifel daran, dass Balduin von
Trier einer der beiden Erzbischöfe war,^4 die Heinrich auf den Altar erhoben, wohin-
gegen die Bildunterschrift sie allen sieben Kurfürsten zuschreibt: EUcfus super allere lo-
calrtr per seplera elecfores anno predzefo WH' . Problematisch ist dabei weniger die Diskre-
panz zwischen Darstellung und Unterschrift, sondern die Angabe, dass Wahl und
Altarsetzung durch sieben Kurfürsten geschahen, war durch das Fehlen des Böhmen-
königs doch nur eine Beteiligung von sechs Wählern gegeben.Hinzu kommt, dass
die Handschrift selbst erst mehr als zwei oder sogar drei Jahrzehnte später entstand,^
so dass, ähnlich wie bei der aniap/a eonsMcludo des Rhenser Versammlungsortes, durch-
auch KRAMMER, Kurfürstenkolleg, S. 224f.). SCHNEIDER, Kaiser Heinrich VII., S. 25 deutet dies als
einen gegen den Erzbischof von Köln gerichteten Akt. Eine Verwechslung der Dominikaner-
kirche mit der Bartholomäuskirche liegt bei jÄscHKE, Europa und das römisch-deutsche Reich
um 1300, S. 118 vor, der, basierend auf der Altarsetzung in der Bilderchronik Balduins von Trier,
ausführt: »Zu den demonstrativen Akten des Öffentlichmachens gehörte auch die Altarsetzung
durch zwei geistliche Kurfürsten in der Frankfurter Bartholomäuskirche.«; vgl. dagegen die
korrekten Angaben in der von Jäschke benutzten Literatur, Die deutschen Königspfalzen, Bd. 1,
S. 369: »Erst nach vollzogener Wahl, also wohl zur Altarsetzung, wurde im Jahr 1308 Heinrich
VII. von seinen Wählern zur Dominikanerkirche geführt .... Sein Wahlort ist unbekannt.«
Ebenso S. 443, wo als Ort der Wahlhandlung das Predigerkloster selbst und nicht dessen Kirche
in Betracht gezogen und die Altarsetzung bestimmter vertreten wird: »Nach der Wahl fand
erstmals eine Altarsetzung des Gewählten durch die Kurfürsten statt. Diese symbolische
Handlung trat möglicherweise an die Stelle einer früheren Inthronisation und könnte dazu bei-
getragen haben, die Königswahl und damit auch den Wahlort F. gegenüber der Königskrönung
aufzuwerten.« ScHOENBERGER, Beiträge zur Baugeschichte des Frankfurter Doms, S. 139 weist
auf eine mögliche Konkurrenzsituation zwischen Dominikanerkloster und Bartholomäus-
kirche hin, um dann, jedoch ohne ausreichende Quellengrundlage, auszuführen, dass »die
Wahl des Luxemburgers ... auf dem Kirchhof der Bartholomäuskirche proklamiert« wurde.
563 Siehe unten, Kapitel 9.1, Abb. 1. Die im Landeshauptstaatsarchiv Koblenz aufbewahrte Hand-
schrift ist mehrfach gedruckt worden, zuletzt bei MARGUE/PAULY/ScHMiD (Hg.), Der Weg zur
Kaiserkrone, wo sich die Altarsetzung auf S. 41 findet. Zur Beschreibung siehe auch Bojcov,
Warum pflegten deutsche Könige auf Altären zu sitzen?, S. 245, der anders als MARGUE/PAULY/
ScHMiD (Hg.), Der Weg zur Kaiserkrone, von vier statt drei weltlichen Kurfürsten spricht. In
Wirklichkeit sind auf der Darstellung jedoch fünf Personen zu sehen, die durch fehlende Rüs-
tung und Helm von den übrigen Rittern abgegrenzt sind.
564 Während Bojcov, Warum pflegten deutsche Könige auf Altären zu sitzen?, S. 245 dies nur ver-
mutet und auch die übrige Forschung hierüber meist keine klaren Aussagen trifft (vgl. RiEGER,
Altarsetzung, S. 3: »Die drei [Kurfürsten, A.B.] sind in ihrer Erscheinung nicht im geringsten
individualisirt [sic]«), ist diese Zuordnung mittels der Kopfbedeckung, nämlich der roten (statt
braunen) Kalotte, mit der Balduin auch sonst dargestellt ist, eindeutig möglich (am deutlichsten
bei der Frankfurter Wahl, wo er durch sein Wappen zweifelsfrei zugeordnet werden kann:
MARGUE/PAULY/ScHMiD (Hg.), Der Weg zur Kaiserkrone, S. 39). Die Zuordnung des zweiten
hieran beteiligten Erzbischofs muss hingegen offen bleiben.
565 Die Gesta Baldewini, 1. II, c. 1, S. 204 sprechen zur Frankfurter Wahl nur von BaMewzhHS aEz'tpzr
SM/ coch'Aou's, gehen zu Rhens und Aachen aber ebenfalls fälschlich von der Anwesenheit aller
sieben Kurfürsten aus (ebd., S. 202 und c. 2, S. 205).
566 Zur Datierung siehe WtNTERER, Einordnung der Bilderchronik, der aufgrund stilistischer Ge-
sichtspunkte zu dem Schluss kommt, dass »die >Romfahrt< ungefähr zwischen 1340 und 1345
entstanden sein« dürfte (S. 31). ScHMiD, Kaiser Heinrichs Romfahrt, S. 81 folgte hingegen KESSEL,
11 manoscritto del »Viaggio a Roma«, S. 20f., die von einer Datierung »in die (erste Hälfte der)
1330er Jahre« ausging.
Herrschererhebungen des Spätmittelalters
ebenjenes Aktes in der Bilderhandschrift Balduins von Trier, in der zwei geistliche Kur-
fürsten den erwählten König im Inneren einer Kirche auf den Altar setzen, während
der dritte geistliche Kurfürst, mehrere Personen in weltlicher Kleidung und zahlreiche
Ritter dabei stehen Die Bilderchronik lässt keinen Zweifel daran, dass Balduin von
Trier einer der beiden Erzbischöfe war,^4 die Heinrich auf den Altar erhoben, wohin-
gegen die Bildunterschrift sie allen sieben Kurfürsten zuschreibt: EUcfus super allere lo-
calrtr per seplera elecfores anno predzefo WH' . Problematisch ist dabei weniger die Diskre-
panz zwischen Darstellung und Unterschrift, sondern die Angabe, dass Wahl und
Altarsetzung durch sieben Kurfürsten geschahen, war durch das Fehlen des Böhmen-
königs doch nur eine Beteiligung von sechs Wählern gegeben.Hinzu kommt, dass
die Handschrift selbst erst mehr als zwei oder sogar drei Jahrzehnte später entstand,^
so dass, ähnlich wie bei der aniap/a eonsMcludo des Rhenser Versammlungsortes, durch-
auch KRAMMER, Kurfürstenkolleg, S. 224f.). SCHNEIDER, Kaiser Heinrich VII., S. 25 deutet dies als
einen gegen den Erzbischof von Köln gerichteten Akt. Eine Verwechslung der Dominikaner-
kirche mit der Bartholomäuskirche liegt bei jÄscHKE, Europa und das römisch-deutsche Reich
um 1300, S. 118 vor, der, basierend auf der Altarsetzung in der Bilderchronik Balduins von Trier,
ausführt: »Zu den demonstrativen Akten des Öffentlichmachens gehörte auch die Altarsetzung
durch zwei geistliche Kurfürsten in der Frankfurter Bartholomäuskirche.«; vgl. dagegen die
korrekten Angaben in der von Jäschke benutzten Literatur, Die deutschen Königspfalzen, Bd. 1,
S. 369: »Erst nach vollzogener Wahl, also wohl zur Altarsetzung, wurde im Jahr 1308 Heinrich
VII. von seinen Wählern zur Dominikanerkirche geführt .... Sein Wahlort ist unbekannt.«
Ebenso S. 443, wo als Ort der Wahlhandlung das Predigerkloster selbst und nicht dessen Kirche
in Betracht gezogen und die Altarsetzung bestimmter vertreten wird: »Nach der Wahl fand
erstmals eine Altarsetzung des Gewählten durch die Kurfürsten statt. Diese symbolische
Handlung trat möglicherweise an die Stelle einer früheren Inthronisation und könnte dazu bei-
getragen haben, die Königswahl und damit auch den Wahlort F. gegenüber der Königskrönung
aufzuwerten.« ScHOENBERGER, Beiträge zur Baugeschichte des Frankfurter Doms, S. 139 weist
auf eine mögliche Konkurrenzsituation zwischen Dominikanerkloster und Bartholomäus-
kirche hin, um dann, jedoch ohne ausreichende Quellengrundlage, auszuführen, dass »die
Wahl des Luxemburgers ... auf dem Kirchhof der Bartholomäuskirche proklamiert« wurde.
563 Siehe unten, Kapitel 9.1, Abb. 1. Die im Landeshauptstaatsarchiv Koblenz aufbewahrte Hand-
schrift ist mehrfach gedruckt worden, zuletzt bei MARGUE/PAULY/ScHMiD (Hg.), Der Weg zur
Kaiserkrone, wo sich die Altarsetzung auf S. 41 findet. Zur Beschreibung siehe auch Bojcov,
Warum pflegten deutsche Könige auf Altären zu sitzen?, S. 245, der anders als MARGUE/PAULY/
ScHMiD (Hg.), Der Weg zur Kaiserkrone, von vier statt drei weltlichen Kurfürsten spricht. In
Wirklichkeit sind auf der Darstellung jedoch fünf Personen zu sehen, die durch fehlende Rüs-
tung und Helm von den übrigen Rittern abgegrenzt sind.
564 Während Bojcov, Warum pflegten deutsche Könige auf Altären zu sitzen?, S. 245 dies nur ver-
mutet und auch die übrige Forschung hierüber meist keine klaren Aussagen trifft (vgl. RiEGER,
Altarsetzung, S. 3: »Die drei [Kurfürsten, A.B.] sind in ihrer Erscheinung nicht im geringsten
individualisirt [sic]«), ist diese Zuordnung mittels der Kopfbedeckung, nämlich der roten (statt
braunen) Kalotte, mit der Balduin auch sonst dargestellt ist, eindeutig möglich (am deutlichsten
bei der Frankfurter Wahl, wo er durch sein Wappen zweifelsfrei zugeordnet werden kann:
MARGUE/PAULY/ScHMiD (Hg.), Der Weg zur Kaiserkrone, S. 39). Die Zuordnung des zweiten
hieran beteiligten Erzbischofs muss hingegen offen bleiben.
565 Die Gesta Baldewini, 1. II, c. 1, S. 204 sprechen zur Frankfurter Wahl nur von BaMewzhHS aEz'tpzr
SM/ coch'Aou's, gehen zu Rhens und Aachen aber ebenfalls fälschlich von der Anwesenheit aller
sieben Kurfürsten aus (ebd., S. 202 und c. 2, S. 205).
566 Zur Datierung siehe WtNTERER, Einordnung der Bilderchronik, der aufgrund stilistischer Ge-
sichtspunkte zu dem Schluss kommt, dass »die >Romfahrt< ungefähr zwischen 1340 und 1345
entstanden sein« dürfte (S. 31). ScHMiD, Kaiser Heinrichs Romfahrt, S. 81 folgte hingegen KESSEL,
11 manoscritto del »Viaggio a Roma«, S. 20f., die von einer Datierung »in die (erste Hälfte der)
1330er Jahre« ausging.